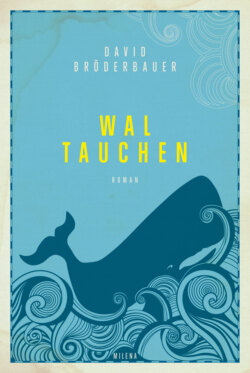Читать книгу WALTAUCHEN - David Bröderbauer - Страница 7
Schmetterlingskind
ОглавлениеDie Zeit hat aus meinem Knaben-Ich eine konturarme Schaufensterpuppe gemacht, die auch bei näherer Betrachtung seltsam unscharf bleibt. Was von ihm übrig ist, ist vage, zumindest erinnere ich mich an vieles nur ungefähr, ganz im Gegenteil zu meinem Bruder, Ich erinnere mich genau, sagt er, wenn ich eine Erinnerungslücke offenbare, und erklärt dann, wie es in Wahrheit gewesen ist, nämlich so und so. Gefolgt von der Bemerkung, dass ich doch Geschichte oder so was studiert habe und mich trotzdem an nichts erinnern kann. Ich sage nicht, dass man Familiengeschichte nicht so behandeln kann wie Thukydides den Peloponnesischen Krieg, aus Erinnerungsfragmenten kann man nicht Ursachen und Umstände rekonstruieren und dann erklären, genauso ist es gewesen, schon gar nicht, wenn verschiedene Menschen mit verschiedener Wahrnehmung beteiligt gewesen sind. Würde ich das sagen, würde mein Bruder sagen, wie überheblich ich nicht bin, also sage ich auch nicht, dass sich die Erlebnisse aus der Kindheit kausalen Erklärungen entziehen, dass Kindheitserinnerungen höchstens der mythischen Geschichtsauffassung Homers vergleichbar sind, in der Schicksal und Götter den Arm der Helden führen, dass im Erinnern am Ende immer die Erzählung über die Fakten siegt und dass Erklärungen oft nichts anderes als nachgereichte Rechtfertigungen sind.
Wie viel auch Fragment ist, an die Fahrt zum Aichingerteich kann ich mich noch gut erinnern. Das verdankt sich dem Umstand, dass die Erinnerung daran eine Reproduktion ist, eine Fotografie, gemacht an jenem Tag und bis heute von mir aufbewahrt. Sie zeigt einen Knaben mit goldblondem Haar, die Kamera schaut von oben auf ihn hinab, auf den gesenkten Kopf, der das Strahlen in seinem Gesicht nur erahnen lässt. Im Rücken des Knaben sieht man unscharf das Grün einer Wiese, das vom Orange seines T-Shirts überstrahlt wird. Der Knabe wendet der Kamera die Schulter zu, auf der ein Schmetterling Platz genommen hat. Nicht irgendein Schmetterling, sondern ein Schwalbenschwanz, der schönste Schmetterling, den sich der Knabe vorstellen kann, mit kunstvoll geschwungenen, frucadegelben Flügeln, die mit schwarzen Mustern bemalt sind, am Unterrand vier blaue Punkte, dunkelblau wie tiefes Wasser, daneben ganz am Rand noch ein roter, und die Flügelenden in die feinsten Spitzen auslaufend.
Der Vater fährt das Insekt auf dem Weg zum Aichingerteich an, es klatscht auf die Windschutzscheibe und der Vater steigt tatsächlich auf die Bremse, bleibt stehen, um nachzusehen, ob es noch lebt. Sein Vater ist zu der Zeit beeindruckt von Schmetterlingen, weil er in der Sonntagsbeilage einer Boulevardzeitung auf eine Bildergeschichte gestoßen ist, die zeigt, wie sich aus Raupen Schmetterlinge entwickeln – eine Tatsache, die jedem Kind bekannt ist, die sein Vater aber erst mit vierzig Jahren durch einen Zeitungsartikel lernt. Der Schmetterling lebt noch und setzt sich, weil er benommen ist oder weil ihn das Orange des T-Shirts anlockt, nach einem kurzen Flugversuch auf die Schulter des Knaben. Nicht auf die Schulter des Bruders, nicht auf die des Vaters, sondern auf seine. Er strahlt, auserwählt fühlt er sich, ein schamhafter Stolz steigt in ihm hoch, der Stolz eines Jünglings, der zum Ritter geschlagen wird, ein geadeltes Schmetterlingskind. Nicht bewegen, sagt der Vater, und der Knabe bewegt sich nicht, hält in Wahrheit schon seit einer halben Minute die Luft an, um den Schmetterling nicht zu verscheuchen. Der Vater holt die Kamera aus dem Auto und drückt so vorsichtig auf den Auslöser, dass man das Klicken der Kamera nicht hört. Für einen Augenblick erstarren Knabe und Schmetterling in vollkommener Reglosigkeit, als wären sie präpariert.
Zumindest erinnere ich mich so daran, wenn ich die Fotografie ansehe. Auch eine Erinnerung an danach ist noch vorhanden, als der Knabe unter Wolken im trüben Moorwasser des Aichingerteichs schwimmen lernen muss. Er mag den Aichingerteich nicht, unter Wasser sieht man keine dreißig Zentimeter, so schmutzig ist es. Der Vater sagt, Moorwasser ist gesund, er hat sich in den Kopf gesetzt, dass es heute sein muss, Schwimmen ist ja auch nicht schwer, der Bub muss sich nur einmal anstrengen und nicht immer so trotzig sein, und als der Bub mit verschränkten Armen dasteht, ein trotziger Achill, der sich weigert, in die Schlacht zu ziehen, packt ihn der Vater und trägt ihn ins Wasser, beide noch das T-Shirt an und in der Unterhose. Er wehrt sich nicht, schlägt nicht aus, schreit nicht, er hält einfach die Luft an und geht unter. Mit Trotz hat er seinen Vater noch jedes Mal bezwungen. Der Trotz verleiht ihm ungeheure Kraft, er macht ihn unbesiegbar, unüberwindbar, der Trotz verwandelt ihn in eine uneinnehmbare Festung. Die Anmaßung des Vaters weckt in ihm einen heiligen Zorn, schließlich kann er länger die Luft anhalten als jeder andere, alle wären sie längst ertrunken, müssten sie so lange unter Wasser bleiben wie er. Er weiß besser als sein Vater, wie man schwimmt, er hat es sich schließlich selbst beigebracht, man darf sich nur möglichst nicht bewegen, dann treibt man auf der Oberfläche, ohne unterzugehen. Aber diesmal lenkt sein Vater nicht ein, er fasst ihn um die Taille und fordert ihn auf, Schwimmbewegungen zu machen, Und wenn wir bis morgen hier stehen. Erst wenn er mit Armen und Beinen strampelt, lässt ihn der Vater los. Augenblicklich geht er unter und augenblicklich zieht ihn sein Vater wieder hoch. Er schluckt Wasser, hustet, versucht dem Griff zu entkommen, aber sein Vater hält ihn fest. Nochmal, sagt der Vater, und erst als es dem Knaben gelingt, mit strampelnden Bewegungen ein paar Meter zurückzulegen, bevor er doch wieder untergeht, lässt es der Vater sein. Mehr kann man da nicht machen, sagt er, und der Knabe weiß nicht, ob der Vater nur wieder die Geduld verloren hat und der Unterricht eine Fortsetzung finden wird, oder ob es das ein für alle Mal gewesen ist. Er weiß nur, dass er nicht schwimmen lernen will, nur untertauchen will er, im seichten Wasser treiben, dort wo es nicht zu tief ist, diese Schwerelosigkeit spüren, das will er.
Als sie nachhause fahren, ist der Himmel wolkenverhangen und grau wie Vulkanasche. Feine Tropfen sammeln sich auf der Windschutzscheibe, vor ihnen Blitz und Donner. Dann geraten sie in die Regenfront, von einer Sekunde auf die andere ist sie da, als hätten sie eine unsichtbare Wand durchstoßen in eine Welt aus Regen. So heftig regnet es, dass sein Vater auf Schritttempo herabbremsen und die Warnblinkanlage einschalten muss. Auf Sicht fahren sie weiter, niemand spricht. Schließlich taucht das Ortsschild am Straßenrand auf. Da begreift er, dass der Sommer wirklich vorbei ist. Das bedeutet, dass er bis zum nächsten Jahr warten muss, bevor er wieder tauchen kann. Dass er bis zum nächsten Sommer zuhause üben muss, in seinem Zimmer. Und üben will er, er will der beste Taucher der Welt werden.