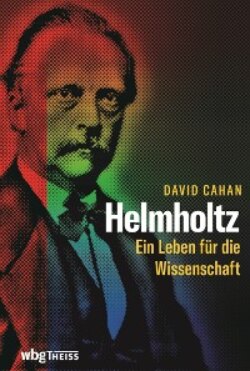Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Der Junge aus Potsdam Vorfahren
ОглавлениеFamilie spielte für Hermann Helmholtz’ Leben eine ganz wesentliche Rolle; etwas über seine Familie zu erfahren, bedeutet also auch, etwas über ihn zu erfahren. Fast sein gesamtes Leben umgab und unterstützte ihn sein Familienkreis.
Helmholtz’ Großvater väterlicherseits, August Wilhelm Helmholtz, war als Inspekteur von Tabakwarenlagern für die preußische Regierung tätig. Er hatte in eine Familie hugenottischer réfugiés (die Familie Sauvage) eingeheiratet, von dieser Seite hatte Helmholtz demnach französische Vorfahren. Sein Vater, August Ferdinand Julius Helmholtz, wurde 1792 in Berlin geboren und evangelisch getauft. Im Winter 1807/08, zur Zeit der französischen Besetzung Preußens, hörte Ferdinand in Berlin als Gymnasiast die hochgradig nationalistischen »Reden an die deutsche Nation« des Philosophen Johann Gottlieb Fichte. Er war davon zutiefst berührt und begann, die französischen Besetzer zu hassen. Kurz darauf traf er Fichtes Sohn, Immanuel Herrmann Fichte, und die beiden erkannten einander als Seelenverwandte. Auch die Frau von Fichte senior, Marie Johanne Fichte, wurde Ferdinand zur Vertrauten. Im Jahre 1811 schrieb er sich an der theologischen Fakultät der neuen, reformorientierten Berliner Universität ein, wo er sich von nun an ganz Johann Gottlieb Fichtes Vorlesungen und seinem philosophischen System des transzendentalen Idealismus widmete. Fichtes Philosophie blieb für Ferdinands Denken immer zentral und inspirierte ihn sein gesamtes weiteres Leben. Fichte hatte die Religion zurück in die Philosophie geholt, weshalb Ferdinand glaubte, es bedürfe vollkommener Beseeltheit und Religiosität, um Fichtes Philosophie verstehen zu können. Für ihn war Fichte ein endloser Quell tiefer, göttlicher Weisheit, aus dem Gott persönlich sprach.1 Die große Anziehungskraft von Fichtes Philosophie lag für Ferdinand in ihrem religiösen Fundament – was später Anlass zu Spannungen zwischen Vater und Sohn geben sollte. Mit seiner Begeisterung für Fichte brachte Ferdinand seinen Sohn jedenfalls in Kontakt mit einer der wichtigsten philosophischen Strömungen Deutschlands sowie einer der bedeutendsten deutschen Universitäten.
Nach Napoleons Rückschlägen in Russland und dem Rückzug seiner Armee gen Westen rief der preußische König Friedrich Wilhelm III. (1797 – 1840) sein Volk dazu auf, für das Vaterland die Waffen gegen Napoleon zu ergreifen. Im Mai 1813 verließ Ferdinand wie die meisten seiner Kommilitonen die Universität, um sich der preußischen Armee anzuschließen. Vermutlich hatten auch Fichtes Vorlesungen von 1812/13 das Ihre dazu beigetragen. Die Art, wie Fichte über die Freiheit und die Rolle des Staates sprach, motivierte viele seiner Studenten, sich zu Preußen zu bekennen. Ferdinand kämpfte in den sogenannten Befreiungskriegen (1813–1815) gegen die französischen Besatzer und war Teil der nationalistischen und antifranzösischen Bewegung, die sich in ganz Preußen entwickelte. Während seiner Stationierung in den schlesischen Bergen (der preußische Monarch hatte sich nach Breslau zurückgezogen) vertraute Ferdinand seinem »Bruder« Immanuel Herrmann Fichte an, wie furchtbar langweilig seine militärischen Pflichten waren – er war mit Kanonen und mit den Ärmsten der Armen befasst. Solange es keine Kämpfe gebe, sei das Militärleben aber immerhin ein wenig wie Urlaub. Dennoch hasste er das ständige Putzen und Marschieren und vor allem die Tatsache, dass er nicht bezahlt wurde. Er sehnte sich danach, seinen geschwächten Körper zu regenerieren. Wie viele seiner ultrapatriotischen Landsleute verabscheute er die Russen, die ebenso wie Briten und Österreicher eine Allianz mit Preußen gegen Frankreich eingegangen waren und die gesamte Umgebung verwüstet hatten. Die Russen seien unglaublich unzivilisiert, so Ferdinand, fast wie wilde Nomaden, was sich auch in ihrer Art zu kämpfen zeige. Von den französischen Streitkräften hielt er kaum mehr und wollte nicht glauben, dass die Preußen vor ihnen davongelaufen waren und ihnen, wie er schreibt, dieses schöne Land zum Plündern überlassen hatten. Er beneidete Immanuel Herrmann, der zu Hause bei seinen »lieben Eltern« geblieben war, wo er sein bisheriges intellektuelles Leben weiterführen konnte. Sich selbst betrachtete er als »armen Teufel«, der nach Erlösung dürste, sprach von sich aber auch als bereits »wiedergeboren«. Sein Schicksal liege vollkommen in Gottes Hand. Zwei Monate später erlag das preußische Heer Napoleons Truppen in der Schlacht von Dresden. Den Rest seines Lebens sollte Ferdinand den französischen Kaiser hassen – wenn nicht sogar alle Franzosen. 65 Jahre später schrieb Hermann Helmholtz über die Befreiungskriege: »Die älteren unter uns haben noch die Männer jener Periode gekannt, die einst als die ersten Freiwilligen in das Heer traten, stets bereit, sich in die Erörterung metaphysischer Probleme zu versenken, wohlbelesen in den Werken der großen Dichter Deutschlands, noch glühend vor Zorn, wenn vom ersten Napoleon, von Begeisterung und Stolz, wenn von den Taten der Befreiungskriege die Rede war.«2 Ferdinand hatte seine Kriegserinnerungen und seine Einstellung gegenüber Frankreich an den Sohn weitergegeben.
Im September 1813 stieg Ferdinand zum Second-Lieutnant auf. Er wollte seine Universitätsstudien wieder aufnehmen und fragte Johann Gottlieb Fichte um Rat bezüglich seines beruflichen Werdegangs. Fichte jedoch wies ihn schroff ab, diese Entscheidung müsse er schon selber treffen. Nach dem Ersten Pariser Frieden wurde Ferdinand aus dem Militärdienst entlassen, da er an einer leichten Form einer chronischen, nicht weiter spezifizierten Nervenkrankheit litt. Im Oktober schrieb er sich an der Universität für Philologie ein, weil er hoffte, seinen Lebensunterhalt damit bestreiten zu können. Philosophie blieb aber seine wahre Leidenschaft.3 Als 1814 jedoch Fichte verstarb und seine philosophischen Ansätze aus der Mode kamen – Hegel übernahm 1818 seine Stelle in Berlin –, blieb Ferdinand intellektuell isoliert zurück.
Noch immer fand er moralische Unterstützung und Zuneigung bei »Mutter Fichte«, wie sich Fichtes Witwe nannte, die eine Nichte des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock und eine überaus fromme Frau war. Als Ferdinand auf Badekur ging, sorgte sich Mutter Fichte um seinen Gesundheitszustand und gab ihm Ratschläge, wie er ihn verbessern könne. Er wünschte sich, dass ihre Liebe seiner Heilung zuträglich sein möge und ihn, wie er sagte, der großen, tugendhaften christlichen Gemeinde würdig machen werde. Er hoffte, ihr keine Last zu werden, wenngleich er sich bewusst war, für immer ihrer Liebe und Hilfe zu bedürfen. Seine eigene Familie, so erzählte er es Mutter Fichte, wolle, dass er wieder so wie sie lebte – vermutlich war damit das Leben eines kleinen Regierungsbeamten aus der unteren Mittelschicht gemeint. Er gehöre aber doch zu denjenigen Individuen, die sich weiterentwickelt und über sie erhoben hätten. Beschämt und voller Schuldgefühle gestand er ihr dies und fürchtete dabei, seine gesamte Verwirrtheit, Bedeutungslosigkeit und Torheit vor ihrem heiligen Blick preisgegeben zu haben.4
Nach seinem Universitätsabschluss unterrichtete Ferdinand einige Jahre lang an der Cauerschen Erziehungsanstalt in Berlin, einem naturwissenschaftlich orientierten Privatinternat (zu seinen Schülern zählte beispielsweise der zukünftige Berliner Chemiker und Physiker Heinrich Gustav Magnus, ein späterer Förderer von Hermann Helmholtz). Mit dieser Stelle war Ferdinands Auskommen zwar gesichert, emotional blieb er jedoch instabil. Er schüttete Immanuel Herrmann Fichte sein Herz aus und gestand, dass er sich davor fürchte, Neues auszuprobieren, und sich überhaupt vor dem Leben ängstige. Er war gedrückter Stimmung und verfluchte eine Welt, die ihn nicht nach seinen Idealen leben ließ und ihm stattdessen die alten Sorgen um Existenz und Annehmlichkeiten aufzwang. Der Versuch, sich über die materielle Existenz zu erheben und nach Höherem zu streben, hatte ihn viel Kraft gekostet und seinen Willen und Körper geschwächt. Allzu oft überkamen ihn Momente der Depression, des Selbsthasses und Weltschmerzes, in denen Ferdinand sich nach Erlösung sehnte. Sie lähmten ihn und ließen ihn in Selbstzweifeln, Selbstmitleid und Selbstvorwürfen schwelgen. Er berichtete Fichte, wie er schon »Mutter Fichte« gegenüber geäußert hatte, dass er seiner Familie entkommen müsse, deren Leben und Wesen ihm so fremd seien. Ferdinand wünschte sich, dass Fichte mit ihm nach Italien reiste, wo er sich Heilung für Körper und Geist erhoffte. Er fühlte sich schwach, niedergeschlagen und mutlos. Das höchste Ziel seines wissenschaftlichen Strebens sei es, schrieb er Fichte, nur ein einziges Mal die Geschichte der Natur aus dem höheren Licht der Wissenschaftslehre zu beleuchten, womit er sich auf Johann Gottlieb Fichtes Theorie bezog. Es gehe ums Tun, nicht um Gelehrsamkeit und Bücher. Gott und Italiens üppige Landschaften würden seinen Geist erfrischen und seinen Körper wiederherstellen, so glaubte er. Aus der Italienreise wurde jedoch nichts, stattdessen mussten er und Immanuel Herrmann sich damit zufriedengeben, in Deutschland und der Schweiz auf Wanderschaft zu gehen, bis ihnen das Geld ausging. Ferdinand sollte nie nach Italien kommen und nach 1822, als Fichte nach Saarbrücken zog, um dort als Gymnasiallehrer zu arbeiten, sah er seinen besten Freund nie wieder.5
Im Herbst des Jahres 1820 holten zwei Ereignisse Ferdinand zumindest zeitweilig aus seiner Depression. Am 1. Oktober fing er als Lehrer an einem Potsdamer Gymnasium an. Nach einer einjährigen Probezeit sollte er dort sein gesamtes Arbeitsleben beschäftigt bleiben. Diese neue Stelle bedeutete mehr Sicherheit. Das zweite Ereignis war die Eheschließung mit Caroline Auguste Penne.
Wenig ist über Helmholtz’ Mutter bekannt, die von Ferdinand und ihren gemeinsamen Freunden Lina genannt wurde. Sie kam 1797 in Breslau als Tochter eines Hannoveraner Artillerieoffiziers zur Welt. Helmholtz selbst gab später an, sie habe von einer emigrierten englischen Familie abgestammt. Verbreitet ist die Meinung, dass sie väterlicherseits mit William Penn verwandt war, einem wichtigen Vertreter der anglo-amerikanischen Quäker-Bewegung und Gründer der Kolonie Pennsylvania.6 Helmholtz’ Äußerung von 1876 ist jedoch offenbar die einzige (schriftlich überlieferte), die er in dieser Richtung je getan hat. Tatsächlich findet sich in der umfangreichen genealogischen Literatur zu Penn und seiner Familie keinerlei Hinweis auf eine Verbindung zu Helmholtz’ Mutter oder ihre etwaigen Vorfahren. Auf jeden Fall stammte Lina (zumindest mütterlicherseits) wie Ferdinand von einer Familie hugenottischer réfugiés ab, deren Familienname ebenfalls Sauvage lautete.
Helmholtz’ Mutter verfügte nur über geringe Schulbildung und war nicht sehr belesen, ihre Familie war weder wohlhabend noch gesellschaftlich angesehen. Dennoch war sie wohl eine sensible Frau. Immanuel Herrmann Fichte berichtete einem gemeinsamen Freund, sein lieber Helmholtz habe sich in ein absolut achtbares und bewundernswertes Mädchen verliebt (Lina hatte anscheinend auch Fichtes Mutter gekannt und verehrt). Zwar sei sie nicht gerade weltgewandt, ihre Seele jedoch ungewöhnlich tief und leidenschaftlich. Fichte hielt das Paar für sehr verliebt und vermutete zu Recht, dass die beiden bald heiraten würden. Am 5. Oktober 1820, vier Tage, nachdem Ferdinand seine Gymnasialstelle angetreten hatte, war es so weit.7
Eine Woche später erzählte Ferdinand Fichte, er sei ausnahmsweise einmal »so glücklich«, lächle ihn doch ein heiliger Engel ständig mit himmlischer Freude an. Die Liebe einer Frau war für ihn das Höchste überhaupt, und er befand, dass wahrhaftig nicht einmal die Engel im Himmel reiner, heiliger und unschuldiger sein könnten als seine ihn liebende Ehefrau. Mit ihr wollte er von der Erde aufsteigen und in den ewigen Frühling eines anderen Lebens schweben. Seine neue Stelle und Linas Liebe hatten ihn gerettet. Für den Moment hatte er himmlische Glückseligkeit auf Erden gefunden, wozu Linas großartige irdische (lies: häusliche) Fähigkeiten nicht unerheblich beitrugen.8 Diese kamen nun in ihrem neuen Heim in Potsdam zum Tragen.
Potsdam
Potsdam liegt inmitten malerischer, bewaldeter Hügel, die die Havel und das sandige Haveltal mit seinen feuchten Niederungen umgeben. Mit ihren wunderbaren, damals noch unberührten Seen und der Nähe zu Berlin war die Gegend der ideale Ort für die Sommerresidenz des preußischen Königs sowie für viele adelige Landsitze. Für die Hohenzollern und ihre Entourage war Potsdam in Bezug auf Berlin das, was Versailles den Bourbonen für Paris war: ein königlicher Palast mit Park (Sanssouci) und zweiter Wohnsitz für den König. Aber es war auch eine Garnisonsstadt, die den preußischen Militärstab beherbergte und voller Soldaten war. Die Präsenz des preußischen Staats und Militärs gehörte zu Potsdam wie seine wunderbaren Gärten, die königliche Gärtner-Lehranstalt und seine Wahrzeichen wie Nikolaikirche und Garnisonkirche, um nur zwei zu nennen. Einige Nachfahren der Hugenotten lebten in Potsdam in der Nähe des Zentrums, das der Wilhelmsplatz bildete, und verliehen der Stadt etwas französisches Flair.9 (Siehe Abb. 1.1.)
Potsdams Wirtschaft hatte unter den Napoleonischen Kriegen stark gelitten. Fast zwei Generationen sollte es dauern – nahezu Helmholtz’ gesamte Jugend –, bis die Stadt sich vollständig erholt hatte. Napoleons Truppen hatten das preußische Oberkommando und die Armee aus Potsdam vertrieben. Über zwei Jahre lang (1896 – 1898) hielten französische Soldaten die Stadt besetzt und verwüsteten sie. Die Gewerbebetriebe vor Ort mussten schließen, und die Folge war eine Depression. Zwar kehrte die preußische Armee irgendwann zurück, die Wirtschaft lief aber nur schleppend wieder an und erholte sich nur teilweise. Die Stadtbevölkerung stieg von 21 000 (1821) auf ungefähr 31 000 (1849), darunter waren jedoch ebenso viele Arme wie königliche Soldaten. Unter Friedrich Wilhelm III. wurden einige Villen wieder aufgebaut, was der Wirtschaft etwas Auftrieb gab, im Allgemeinen wuchs jedoch die Armut in der Stadt, und produzierendes Gewerbe und Handel verharrten bis 1850 auf niedrigem Niveau.
Andererseits lebten in Potsdam jedoch auch viele Staatsbeamte. Das Herrscherhaus und der königliche Hofstaat prägten das Stadtbild nachhaltig. Friedrich Wilhelm III. beauftragte Karl Friedrich Schinkel, einen der bedeutendsten Architekten Preußens, und den ebenso angesehenen Gartenkünstler Peter Joseph Lenné mit der Neugestaltung Potsdams, und die beiden veränderten das Erscheinungsbild der Stadt vollkommen. Nach 1826 baute Schinkel die Nikolaikirche wieder auf und machte sie zum architektonischen Zentrum der Stadt. Der italienbegeisterte Friedrich Wilhelm IV. (1840 – 1861) ließ während seiner Regierungszeit die Potsdamer Parks und Gärten großzügig erweitern und suchte, ihnen eine südländische Note zu verleihen.
Abb.1.1:Friedrich August Schmidt, Potsdam vom Babelsberg, 1830/40. bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Dietmar Katz.
1832 errichtete man eine optische Telegraphenstation auf dem später so genannten Telegraphenberg und verband damit verschiedene Gebiete Preußens sowohl untereinander als auch mit Potsdam, das dadurch zu einer Art Kommunikationszentrum für Preußen wurde. Die Telegraphenverbindung und die Eisenbahnlinie Potsdam-Berlin (Inbetriebnahme 1838) galten bald schon als Symbole der Modernität. Die Potsdamer Bevölkerung hatte weiterhin mit der schwierigen Wirtschaftslage zu kämpfen, jedoch sorgten die Präsenz von König und Regierung und die Investitionen in die Infrastruktur für eine gewisse Erholung der Stadt.10
Potsdams liberale Mittelklasse trieb die kulturelle Entwicklung der Stadt voran. Viele Bürger traten Vereinen bei, die sich den verschiedensten öffentlichen und privaten Zwecken widmeten. Zu nennen ist beispielsweise der Potsdamer Kunstverein, der 1834 von Wilhelm Puhlmann gegründet wurde, einem Militärarzt und Freund der Familie Helmholtz. Er stieg zu einem der führenden Kunstsammler auf und war maßgeblich an der Förderung der Künste in Berlin und der Region beteiligt. Sein Leben lang verband ihn eine enge Freundschaft mit dem Maler Adolph von Menzel. Puhlmann und Ferdinand Helmholtz waren außerdem aktiv in der Potsdamer Friedensgesellschaft, die mit Stipendien mittellose talentierte Jugendliche aus der Region Berlin-Potsdam unterstützte, um ihnen ein Kunststudium zu ermöglichen.11
Das Potsdam, in das Helmholtz hineingeboren wurde, war also gleichermaßen ein Zentrum des preußischen Hofes und Militärs wie der Künstler und Bürger, ein Zentrum allerdings, das sich von den Schrecken der Napoleonischen Kriege noch erholen musste. Es waren die schöne Natur rund um die Stadt mit ihren wenigen Einwohnern, ihre kriselnde Wirtschaft sowie ihre Kunst und Architektur, die Helmholtz’ Heimatgefühl ausmachten.
Familie und frühe Kindheit
Die frisch verheirateten Helmholtzens lebten in einem Haus am Wilhelmsplatz 14. Hier brachte Lina am 31. August 1821 das erste ihrer sechs Kinder zur Welt: Herrmann Ludwig Ferdinand Helmholtz. Von seinen drei Vornamen war der erste am »germanischsten«, stand für Deutschlands militärische Stärke und Einheit. Ferdinand Helmholtz hatte den Namen zu Ehren seines »Bruders« Immanuel Herrmann Fichte gewählt. (Bis zu seinem Medizinstudium schrieb Helmholtz seinen Namen mit zwei r, erst dann entschied er sich für die modernere Schreibweise.) Seinen zweiten Namen verdankte er Christian Ludwig Mursinna, einem alten Großonkel und Generalchirurg der preußischen Armee. Auf dem dritten, Ferdinands eigenem Namen, hatte Lina bestanden. Mit diesen drei Namen also hofften seine Eltern, ihm Traditionsbewusstsein mitzugeben, Familiensinn und Ehre, und so seinen Charakter zu formen. Der Nachname leitet sich übrigens von einem altgermanischen Namen ab, vermutlich Helmbold oder Helmhold. Wie schon seine Eltern wurde der Sohn evangelisch getauft. Die Taufe fand am 7. Oktober mit ganzen 23 Taufpaten12 in der Heilig-Geist-Kirche statt. Von Geburt an und für den Rest seines Lebens umgab und beschützte ihn seine Familie.
In den ersten Wochen verursachte er seiner Mutter beim Stillen anscheinend unbeschreibliche Schmerzen. (Sehr viel später sollte er diesen intimen körperlichen Vorgang in ein epistemologisches Argument für seine empirische Theorie der Wahrnehmung verwandeln, indem er das Trinken an der Brust zu einem seitens des Säuglings erlernten Akt erklärte.) Seinen Vater, der sich wie immer überarbeitet fühlte und sich viele Sorgen machte, erfüllte er mit großem Stolz. Ferdinand schrieb an Fichte, sein Sohn sei, wie alle sagten, wirklich ein »kleiner Riese« und ungewöhnlich intelligent für sein Alter.13
Im Oktober 1822 zog die Familie in ein zweistöckiges Haus mit drei Schlafzimmern in der Hoditzstraße 10 (heute Wilhelm-Staab-Straße 8), nahe beim Wilhelmsplatz. Hier wuchs Helmholtz auf und zugleich mehr und mehr in jene Kultur hinein, die sein Zuhause prägte. Der Einfluss der Fichtes war sogar äußerlich sichtbar, denn Ferdinand richtete den Salon mit einem Lesepult und einem Sofa ein, die früher dem Meister persönlich gehört hatten und die nun er in Ehren hielt. Außerdem stand dort noch ein großer Bücherschrank von seinem »Bruder« Fichte, in dem Ferdinand seine, wie er befand, »besseren« philologischen und wissenschaftlichen Arbeiten verwahrte. Ein kleines Mahagoni-Regal beherbergte unter anderem Werke von Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca und Johann Diederich Gries. Die Bücherregale waren wie der Rest des Heims der Familie Helmholtz mit Ikonen der Hochkultur geschmückt: Büsten von Venus, Sokrates, Aristides und Goethe – und auch von Johann Gottlieb Fichte. Bevor »Bruder« Fichte aus Berlin wegzog, hatte sich Ferdinand allerlei Bücher von ihm geliehen, darunter Romane von Sir Walter Scott, die er mit großem Genuss las, wie auch die Werke eines der bekanntesten Romantiker der Zeit, Lord Byron.14 Dank Ferdinand atmete das Zuhause der Helmholtzens Hochkultur, und die Familie durfte sich der breiten kulturellen Elite der deutschen Gesellschaft, dem Bildungsbürgertum, zurechnen. Dieses Zuhause und derlei Objekte repräsentierten Ferdinands kulturelle Realität und Ambitionen, sie gaben den kulturellen Grundton vor und dienten dem jungen Hermann als Vorbild und Inspiration.
Mit einem Jahr war Hermann laut Ferdinand gesund, wohlgeraten, brav und machte ihm viel Freude. Er widmete der Erziehung seines Sohnes viel Zeit. Die beiden Eltern hatten immer Geldsorgen und befürchteten, Ferdinands Lohn würde nicht ausreichen. So waren sie gezwungen, Untermieter aufzunehmen.15
Seit Ferdinand seine neue Arbeitsstelle und einen Sohn hatte, war er voller Tatendrang – zumindest eine Zeit lang. Er fühlte sich seinen beruflichen Pflichten besser gewachsen und berichtete Fichte, dass ihm sein Hermann lauter selige Momente verschaffe. Dennoch zog es ihn fort aus Potsdam, wo er sich isoliert fühlte. Er verfügte nicht einmal über genug Geld, um nach Berlin zu reisen. Linderung fand er in christlicher Frömmigkeit. Nur wer kurzsichtig sei, so belehrte er Fichte, könne das Leben für unendlich halten, dabei halte das Jenseits doch noch schönere Tage bereit. Seine Briefe an Fichte sind überladen mit romantischen und (teils) inkohärenten Gedanken über Kunst, Religion, Gott und das Leben. Es gebe, so behauptete Ferdinand, eine unendliche Geisterwelt, so wie es auch eine physische Welt gebe, und beide hingen letztendlich vom unendlichen Universum ab. In guter Fichte’scher Manier erklärte Ferdinand, es sei das innere, spirituelle, geistige Leben, das den Menschen ausmache, und wenn überhaupt, dann seien Harmonie und Bildung dort zu finden. Er riet Fichte dazu, Gottes Willen zu befolgen. Diese philosophischen Grübeleien führten zu einer quasi tödlichen Schlussfolgerung: Oft sehnte Ferdinand sich nach der Ruhe des »kühlen Grabes« und wünschte sich, er könne sich dort bald niederlegen. Denn seine geistige und körperliche Schwäche gestatte es ihm ansonsten nicht, Ruhe, Liebe und Errettung zu erlangen.16 Schon früh erlebte Hermann hautnah die Frömmigkeit seines Vaters, seine romantische Verklärtheit und vermutlich auch seine Depressionen.
Weihnachten 1822, Hermann Helmholtz war 16 Monate alt, schrieb sein Vater (wieder einmal) in einem Brief an Fichte über seine innere geistige Leere, die Banalität seiner Existenz und darüber, dass er und Lina all ihre Hoffnungen auf den Sohn setzten. Der verleihe seinem Vater neue Kraft für die Arbeit und sei ein niedliches Kind, das ihn voller Hoffnung anlächle und ihm den Pfad zur tiefsten Weisheit eröffnet habe. Doch war er gleichzeitig äußerst frustriert, da seine ehrgeizigen Hoffnungen unerfüllt blieben: Als er alleine für sich eine Shakespeare-Tragödie las, fand er sie »langweilig und unerträglich«, egal wie viel Leidenschaft und Kampf darin vorkam. Er brauchte andere Menschen zu seiner Unterhaltung und Motivation. Kunst spielte eine wichtige Rolle in Ferdinands Leben und damit auch in seinem Zuhause. Wem es an Verständnis für die Kunst mangele, so befand er, dem bleibe nichts anderes, als mechanisch Regeln zu befolgen.
In Ferdinands pädagogischen und erkenntnistheoretischen Standpunkten deuten sich bereits manche der zukünftigen Ansichten seines Sohns (besonders die zum unbewussten Schluss) an. Im schulischen Grundlagenunterricht hielt Ferdinand es für absolut notwendig, die ersten Erkenntnisse dem Geist so einzuprägen, dass ihr späterer Gebrauch keinerlei Reflexion und Freiheit erforderte. Dabei dachte er zum Beispiel an lateinische Sätze: Schon um den einfachsten Satz verstehen zu können, seien zahlreiche Entscheidungen nötig, die aber alle in einem einzigen Augenblick abliefen. Der ganze Vorgang sei das Ergebnis einer kunstfertigen Reflexion, auf die man nur zurückgreifen müsse. Dafür seien aber Festigkeit und Sicherheit in den ersten, grundlegenden Urteilen erforderlich. Nur so sei Schritt für Schritt ein sicherer Lernfortschritt des Kindes möglich.
Doch in deutlichem Kontrast zu dem späteren erkenntnistheoretischen Ansatz seines Sohnes waren Ferdinands pädagogische Ansichten in strenge christliche Dogmen verpackt. Die echte Wahrheit liege in der Offenbarung Gottes. »Gott ist Liebe«, verkündete er. Nur wer stets diese einzige Offenbarung Christi, dass Gott Liebe ist, vor Augen habe und davon vollkommen überzeugt sei, dem könne sich der Weg zum Himmel öffnen.17 Frömmigkeit und Kultur waren im Hause Helmholtz allgegenwärtig.
Religion, Philosophie und sein Sohn waren jedoch nicht Ferdinands alleiniger Trost. Mittlerweile liebte er die Stadt und ihre schöne Umgebung, die er Hermann zeigte. Er bewunderte die königlichen Gärten (von außen) ebenso wie seinen eigenen kleinen Garten. Das Unterrichten verschaffte ihm hingegen wenig Freude, und er befand, dass nur Lehrer werden sollte, wer sich für keinen anderen Beruf eigne. Ferdinand glaubte, dass nur wenige seiner Lehrerkollegen nach einer höheren, freieren Bildung strebten, und hielt sie für intellektuell wenig begeisterungsfähig. Das Verhältnis zu seinen Kollegen bezeichnete er freimütig als schlecht, seinen Lohn als nicht angemessen. Er hatte das Gefühl, sein Geist verkümmere. Freude empfand er hauptsächlich, wenn er Zeit mit seinem 18 Monate alten Sohn verbrachte. Er äußerte sich selig über die ersten Sprechversuche seines Sohnes, der ihm ganz wie ein »kleiner Christus« erschien, dessen Vater natürlich er war. Der Kleine wusste sich unter (in des Vaters Augen unzivilisierten) Fremden offenbar schnell Freunde zu machen, bekam nach Auskunft des Vaters oft mitten auf der Straße oder auf der Post Süßigkeiten geschenkt und wurde von den Menschen freundlich begrüßt. Außer an seinem kleinen Sohn freute sich Ferdinand an seinem Garten mit den Blumen und all dem, was Mutter Natur sonst noch hervorbrachte. Ein Brief an Fichte, der seine kleinen Freuden erwähnt, schloss dennoch damit, dass sein Leben verdorben sei und er selbst »krank an Körper und Geist«.18
Lina sah ihre gemeinsame Welt ganz anders. Sie berichtet von einem aktiven Sozialleben: dass sie den einen oder anderen Umtrunk besuchten oder selbst ausrichteten, dass sie Karten spielten und ein paar Freunde hatten. Über ihren Sohn war sich das Ehepaar Helmholtz in jedem Fall einig. Auch Lina schreibt davon, wie viel Freude ihr Hermann bereitete. Der antworte schon ganz artig mit Ja und Nein, bemühe sich auch ums Sprechen und habe Spaß daran, Dinge zu benennen, deren Namen er schon sprechen könne. Er kenne auch bereits den Buchstaben i und suche es auf jedem Stück bedruckten Papiers, und dann freue er sich jedes Mal, wenn er eins entdecke.19
Linas Charakter unterschied sich stark von dem Ferdinands, sie war nüchtern, zupackend und optimistisch – Eigenschaften, die sie an ihren Sohn weitergab. Laut einem Bekannten der Familie hatte Hermann nicht nur dieselbe Kopfform wie seine Mutter, sondern glich ihr auch vom Wesen her – zu nennen wäre etwa ihre Art, wie sie Probleme sofort anging, ohne sich im Vorhinein Gedanken über alle Details zu machen, oder ihre einfache Sprechweise.20 Helmholtz verfügte später jedenfalls über diese Eigenschaften. Seinen ersten Kontakt mit Kunst und Bildung verdankte er wohl eher seinem Vater; Optimismus und wahrscheinlich auch ein erheblicher Anteil seiner Intelligenz und seiner Problemlösungskompetenz kamen von seiner Mutter. Sein enormes Selbstvertrauen hatte er zweifelsohne von ihr, denn Ferdinand, der sich selbst verabscheute und bemitleidete, fehlte es vollkommen.
Ferdinands und Linas Ehe war auch über Hermann hinaus fruchtbar, ganze sechs Kinder gingen daraus hervor. Mit der Geburt ihres zweiten Kindes, Hermanns erster Schwester Marie (1823 – 1867), war Ferdinand gezwungen, fast seine gesamte Freizeit mit der Familie zu verbringen, wodurch er weniger Zeit zum Lesen und stattdessen zusätzliche Geldsorgen hatte, ein Dauerthema bei ihm. Während der Schwangerschaft mit Marie ging es Lina sehr schlecht. Zu allem Übel erkrankte Hermann dann auch noch schwer an Masern. All dies schlug Ferdinand weiter auf die Stimmung, laut eigenen Angaben litt er an »Melancholie«. Zudem war sein Verhältnis zum Rektor des Gymnasiums (zumindest derzeit) angespannt. Eine geplante Eheschließung zwischen Fichte und Bertha Leithold, einer entfernten Verwandten der Familie Helmholtz, die eine von Hermanns vielen Patinnen war, trachtete er zu verhindern. Diese Einmischungsversuche belasteten die Beziehung zwischen Ferdinand und den Leitholds in Berlin langfristig. Hermann sollte später ebenfalls davon betroffen sein, als er fürs Medizinstudium nach Berlin ging.21
Im Alter von zwei Jahren hatte Hermann einen ernsten Unfall, bei dem er gegen die Kante des Küchenofens fiel. Der Vorfall nahm seine Mutter jedoch letztendlich mehr mit als ihn selbst: Ferdinand und die gemeinsamen Freunde fürchteten, Lina würde den Schock nicht überleben. Als sie sich wieder erholt hatte, bekam das Paar noch vier weitere Kinder: Julie Caroline Louise (1827 – 1894), Ferdinand Carl Ludwig (1831 – 1834), August Otto Karl (1834 – 1913), genannt Otto, und Johannes Heinrich (1837–1841). Von Hermanns Geburt im Jahre 1821 an bis in die späten 1840er widmete sich Lina ganz dem Gebären, Stillen und Großziehen ihrer sechs Kinder, von denen zwei starben, bevor sie das vierte Lebensjahr erreichten. Sie hielt das Haus blitzblank und wirtschaftete sparsam. Zumindest Ferdinand zufolge gab es jedenfalls nichts, was schöner gewesen wäre »als ein gesundes, glückliches Kind«. Seine Kinder, so befand er, waren anscheinend Gottes Weg, ihn für seine Lebenssituation zu entschädigen.22
Alles in allem bauten Ferdinand und Lina ein stabiles Familienumfeld auf und pflegten es. Sie liebten ihren Hermann zutiefst, und das Kind entwickelte eine tiefe Bindung zu ihnen. Möglicherweise schenkten seine Eltern ihm als Erstgeborenem besonders viel Aufmerksamkeit und Unterstützung – zumindest, bis nach und nach seine fünf Geschwisterchen geboren wurden. Als erstes von sechs Kindern fühlte er sich vielleicht verantwortlich für seine Geschwister, worin wiederum (im Erwachsenenalter) sein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Familie und anderen begründet liegen mag.
Seine Eltern sorgten sich furchtbar um ihn, als Hermann mit fünf Jahren lebensbedrohlich erkrankte – vermutlich ein leichter Hydrozephalus, wie Helmholtz später seinen Ärzten berichten würde. Zwei Jahre lang musste er sich davon erholen, wobei er seine Genesung im Nachhinein Gottes Güte und der Fürsorge seiner Eltern zuschrieb. Vor allem mithilfe von Sport und Bädern habe er seine Gesundheit und Kraft wiedererlangt. Insgesamt war Helmholtz nach eigenen Angaben in den ersten sieben Lebensjahren ein »kränklicher Knabe, lange an das Zimmer, oft genug an das Bett gefesselt«. Dennoch habe er stets den lebhaften Drang verspürt, sich zu unterhalten und tätig zu sein. Zumindest eines hatte diese langwierige Krankheitsphase in seiner Kindheit zur Folge: dass er sich ein Leben lang um seine Gesundheit sorgte. Hermanns Eltern verbrachten viel Zeit mit ihm, er beschäftigte sich jedoch auch allein mit »Bilderbüchern und Spiel« sowie mit »Bauhölzchen«. Die Eltern ließen den Sohn Klavierstunden nehmen, wodurch sich bei diesem jedoch nach eigener Aussage keinerlei Gefühl für die Musik an sich entwickelte. Er hielt sich selbst für einen »sehr gehorsamen Jungen« – bis auf jene eine Gelegenheit, wo er seinen Klavierlehrer so »unerträglich« fand, dass er ihm die Noten vor die Füße warf und die Stunde damit frühzeitig beendete.23 Es sollte der einzige Akt der Rebellion in seinem Leben bleiben.
Schon als Kind tastete sich Helmholtz beim Spielen mit stereometrischen Körpern an die Geometrie heran. Die Holzklötze verschafften ihm einen ersten Eindruck von Proportionalität und Form, die Geometrie selbst ein erstes Gefühl für Gesetzmäßigkeiten: »Von meinen Kinderspielen mit Bauhölzern her waren mir die Beziehungen der räumlichen Verhältnisse zu einander durch Anschauung wohl bekannt.« Aus diesem kindlichen Spiel mit Klötzen und dem Nachsinnen über die geometrischen Beziehungen mag ebenso sein erstes, unvollständiges und intuitives Verständnis von erkenntnistheoretischen Fragestellungen herrühren. Praktische Erfahrungen waren es auch, die sein erstes Verständnis von Perspektive so einprägsam machten. Beispielsweise beschrieb er später, dass Kinder Entfernungen oft falsch einschätzen:
Ich entsinne mich selbst noch deutlich des Augenblicks, wo mir das Gesetz der Perspective aufging, dass entfernte Dinge klein aussehen. Ich ging an einem hohen Thurme vorbei, auf dessen oberster Gallerie sich Menschen befanden, und muthete meiner Mutter zu, mir die niedlichen Püppchen herunter zu langen, da ich durchaus der Meinung war, wenn sie den Arm ausrecke, werde sie nach der Gallerie des Thurmes hingreifen können. Später habe ich noch oft nach der Gallerie jenes Thurmes emporgesehen, wenn sich Menschen darauf befanden, aber sie wollten dem geübteren Auge nicht mehr zu niedlichen Püppchen werden.24
Von Kindesbeinen an beschäftigte er sich also mit Geometrie (ganz greifbar) und mit Problemen der räumlichen Wahrnehmung. Auf ihre eigene Art trug seine Mutter zu dieser Sensibilität für solche Fragestellungen bei.
Diese ersten Erfahrungen mit Geometrie und sein Bewusstsein für Gesetzmäßigkeiten erwarb Helmholtz, noch bevor er auf die örtliche Elementarschule kam (irgendwann zwischen 1826 und 1829). Obwohl Schulen wie die Potsdamer Elementarschule weiterhin für konservative Werte standen, stieg ihre Zahl nach der preußischen Niederlage gegen Napoleon stetig, und ihre Lehrpläne wurden im Rahmen der preußischen Reformen überarbeitet. Vielleicht verdankte schon Ferdinand seine Anstellung zum Teil dieser Entwicklung; Hermann profitierte dann ganz zweifellos von der Bildungsreform. Zur Überraschung seiner Lehrer kannte er, wie er später sagte, die Grundlagen der Geometrie schon sehr genau, bevor er mit irgendwelchen formalen Lehrsätzen in Berührung kam. Er lernte auch schon früh lesen, wenngleich er später urteilte, sein Gedächtnis für »unzusammenhängende Dinge« sei schlecht, und als Kind habe er eine Rechts-Links-Schwäche gehabt. Damit lässt sich möglicherweise ein Stück weit erklären, warum er sich im Erwachsenenalter so sehr für das Problem der räumlichen Wahrnehmung interessierte. In der Elementarschule tat er sich im Sprachenunterricht schwerer als seine Klassenkameraden. Geschichte war noch schwieriger, Texte auswendig zu lernen, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber die Lehrer zeigten ihm »die strenge Methode der Wissenschaft, und unter ihrer Hülfe fühlte ich die Schwierigkeiten schwinden, die mich in anderen Gebieten gehemmt hatten«.25 Als er die Schule im Alter von ungefähr neun Jahren verließ, war er perfekt vorbereitet auf die Anforderungen eines strengen deutschen Gymnasiums der damaligen Zeit.