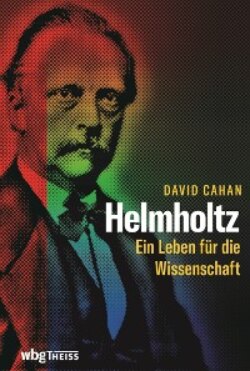Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Studentenzahlen nahmen während seines Bonner Aufenthalts trotzdem zu. Im Wintersemester 1855/56 hatte er 44 Studenten (und 50 Leichen für die Teilnehmer an den Sezierübungen); ein Jahr später (im Wintersemester 1856/57) hatte er bereits 52 Studenten (aber nur 45 Leichen). Sowohl mit der katholischen Geistlichkeit als auch mit den Vertretern der Kölner Stadtverwaltung hatte er »die aller ärgerlichsten Verhandlungen« über die Beschaffung von Leichen für das Institut führen müssen. In seinem letzten Semester in Bonn prahlte er damit, dass die Studentenzahl auf 60 angewachsen war, obgleich die Zahl der Medizinstudenten in höheren Semestern »erbärmlich klein« blieb. (Als er dort 1855 anfing, waren 78 Studenten an der medizinischen Fakultät eingeschrieben; als er die Fakultät verließ, waren es 88.) Helmholtz glaubte, die Medizinstudenten interessierten sich mehr für die Anatomie als für die Physiologie: »Die Physiologie ist den jungen Medizinern törichterweise immer Nebensache.« Und auch wenn er auf den raschen Anstieg der Studentenzahl verwies, erkannte er doch an, dass sie »keineswegs alle [kamen], um bei mir Physiologie zu hören, denn Budges und Schaaffhausens Winterkolleg blieb ziemlich besetzt, mehr als im letzten Winter. Im Sommer fielen die Zuhörer freilich mir zu.« Er nahm an, dass viele zu ihm kamen, um Anatomie und nicht Physiologie zu lernen, die sie als »zu unwichtig« erachteten.17
Das Handbuch (Teil I)
Normalerweise ging Helmholtz nicht damit hausieren, woran er arbeitete. Ludwig berichtete du Bois-Reymond im Mai 1854, dass er oft »bogenlange« Briefe von ihm erhalte. »Und doch erfährt man niemals ganz, was er treibt«, fügte er hinzu. Donders hörte, dass Helmholtz eine Studie zur physiologischen Optik in Arbeit hatte, von der Ludwig allerdings nichts wusste. Im März 1855 teilte Helmholtz du Bois-Reymond dann mit, dass er an einem Buch über physiologische Optik schrieb und die erste Hälfte im folgenden Monat druckreif sein werde: »Es wird ziemlich dickleibig.« Und das war es tatsächlich, denn es handelte sich dabei um sein Handbuch der physiologischen Optik, dessen erster Teil 1856 erschien (der zweite wurde 1860 und der dritte 1866 veröffentlicht). Die drei Bände gaben einen kritischen Überblick über den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zum Sehen, wie er sich unter Helmholtz’ Führung entwickelt hatte.18 Seine Arbeit am Handbuch und an damit in Zusammenhang stehenden Beiträgen, die er in Zeitschriften publizierte, markierte seinen Schritt weg von der Elektro- und hin zur Sinnesphysiologie.
Zum Entstehen des Buchs hatten mindestens vier Gründe beigetragen. Erstens wollte Helmholtz wahrscheinlich etwas Ähnliches zustande bringen, wie es seinem Lehrer Müller mit dessen bahnbrechendem zweibändigen Handbuch der Physiologie des Menschen (1838 – 1840) gelungen war. Auch Ludwig hatte den zweiten Band seines eigenen, enorm einflussreichen Lehrbuchs der Physiologie des Menschen (1852 und 1856) veröffentlicht und ihn Brücke, Helmholtz und du Bois-Reymond gewidmet. Und du Bois-Reymond hatte den ersten Band seiner zweibändigen Untersuchungen über thierische Elektrizität (1848 – 1884) publiziert. Helmholtz war Teil dieser Gruppe, und diese großen Veröffentlichungen – zu denen noch die Arbeiten des jüngeren, stark an der mathematischen Physiologie orientierten Adolf Fick hinzugerechnet werden sollten, eines Ludwig-Schülers und Autors der Medizinischen Physik (1856) – verschafften der organischen Physik ein nie dagewesenes Ansehen; alle zusammen trugen sie dazu bei, dass die organische Physik zur vorherrschenden Ausrichtung der Physiologie wurde. Ihre Schule war nun die führende geworden, und sie hegten die Absicht, die Physiologie zu einer exakten Wissenschaft zu machen. Das Verständnis physiologischer, speziell menschlicher physiologischer Phänomene ließen sie auf den Grundlagen von Physik und Chemie fußen und lehnten es ab, sich auf leere Worte wie »Lebenskräfte« zu berufen. Dies war längst mehr als nur ein Forschungsprogramm; es war sehr viel allgemeiner eine neue Schule des Denkens und der Praxis.
Zweitens war Helmholtz von seinem alten Berliner Kollegen und Freund Gustav Karsten dazu gedrängt worden, sein groß angelegtes Handbuch zur physiologischen Optik zu schreiben. Karsten war inzwischen Professor für Physik in Kiel und unterhielt enge Verbindungen zur Physikalischen Gesellschaft; interessanter dürfte allerdings sein, dass er auch wissenschaftlicher Herausgeber war und Helmholtz’ Buch gerne in eine bestimmte von ihm betreute Reihe aufnehmen wollte. Am Ende erschien es als Teil einer anderen von Karsten herausgegebenen Reihe, nämlich als Band 9 der Allgemeinen Encyclopädie der Physik. Ein wichtiges (wenn nicht das wichtigste) Zielpublikum des Buchs waren Ärzte. Dennoch war es keine bloße Zusammenfassung der vorhandenen Literatur über die Dioptrik des Auges (also sein Thema). Denn obwohl Helmholtz es beim Schreiben möglichst vermied, für praktizierende Ärzte allzu wissenschaftlich-technisch daherzukommen, wahrte er trotzdem höchstes wissenschaftliches Niveau, indem er die Messergebnisse der bisherigen Forschung überprüfte und selbst neue Messungen durchführte. All das bedeutete, dass er gut zwei Jahre (1854 – 1856) mit der Arbeit daran verbrachte, länger als geplant. Drittens führten ihn seine Arbeiten auf dem Gebiet der Farbenlehre, der Theorie der Akkommodation und der sinnlichen Wahrnehmung »schliesslich zu dem Entschluss, die ganze Physiologische Optik neu durchzuarbeiten«, was er, wie er sagte, in seinem Handbuch getan habe. Tatsächlich verpflichtete er sich, indem er sich auf die Abfassung eines Handbuchs einließ, zur Abdeckung des gesamten Gebiets der physiologischen Optik – ein Feld, das in den 1850er- und 1860er-Jahren mit Blick auf seine thematische Vielfalt und die Anzahl der Veröffentlichungen regelrecht explodierte.19 Ursprünglich hatte er daher nur eine begrenzte Vorstellung davon, wie groß sein Recherche- und Zeitaufwand für dieses Handbuch tatsächlich sein würde. Und viertens und letztens dürfte ihn der armselige Zustand der Bonner anatomischen und physiologischen Einrichtungen darin bestärkt haben, das Handbuch zu schreiben – denn er konnte dort zwar synthetisch arbeiten, aber nicht viel experimentieren.
Teil I des Handbuchs, der allein rund 190 Seiten umfasst, war der Dioptrik des Auges gewidmet. Helmholtz begann mit der Beschreibung der Anatomie des Auges: allgemeiner Aufbau, Sehnenhaut, Hornhaut, Uvea, Netzhaut, Kristalllinse, das Kammerwasser und der Glaskörper, die die Linse umgeben, sowie die das Auge stützenden Umgebungsstrukturen. Anschließend wandte er sich der eigentlichen physiologischen Optik des Auges zu und widmete sich nach einer kurzen allgemeinen Erörterung der physikalischen Eigenschaften des Lichts seinem Hauptthema, der Dioptrik des Auges. Hierzu legte er in acht Paragraphen – unter Verwendung zahlreicher illustrativer Strichzeichnungen und mathematischer Gleichungen – folgende Sachverhalte dar: die Brechungsgesetze in Systemen mit sphärischen Oberflächen, die Brechung von Lichtstrahlen im Auge, Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut, den Mechanismus der Akkommodation, die Farbzerstreuung im Auge, monochromatische Abweichungen (Astigmatismus), entoptische Erscheinungen und schließlich den Augenspiegel und das Augenleuchten. Er versicherte seinen Lesern, dass er alle physiologisch-optischen Tatsachen und Phänomene, über die er in seinem Buch berichte, persönlich beobachtet oder erlebt respektive Experimente dazu durchgeführt habe.20 Dank seiner ausführlichen Heranziehung der einschlägigen Literatur geriet das Handbuch zu einer Synthese der modernen physiologisch-optischen Studien zur Dioptrik des Auges. Komplettiert um die Teile II und III wurde es zu einer Art Bibel der physiologischen Optik, der Augenheilkunde, Sinnesphysiologie und experimentellen Psychologie – obwohl es nicht unumstritten blieb, vor allem mit Blick auf die im dritten Teil vorgelegte Theorie des Sehens. Teil I jedenfalls war der am wenigsten neuartige und gewiss auch der am wenigsten kontroverse der drei Teile.
Wandern in den Alpen
Bis Juni 1856 hatte Helmholtz den ersten Teil des Handbuchs fertiggestellt. Thomson hatte es nicht geschafft, Helmholtz zu treffen, als er durch Bonn kam; er lud ihn nach Kreuznach ein, doch Helmholtz konnte wegen seiner Lehrverpflichtungen nicht fort und hoffte, dass Thomson auf seiner Rückreise wieder durch Bonn kommen werde, dessen »sehr schöne« Umgebung den Thomsons gewiss gefallen werde. Wie er berichtete, ging es ihm gut und hatte Olga, was natürlich viel wichtiger war, in Bonn nicht mehr so stark unter Halsproblemen zu leiden. Er klagte, dass er durch den Umzug nach Bonn Zeit verloren habe, dass er Anatomie unterrichten müsse, die er »seit 6 Jahren nicht mehr vorgetragen hatte«, und dass dies alles seine Forschung verlangsamt habe.21
Die Thomsons waren in diesem Sommer in den Südwesten Deutschlands, genauer nach Schwalbach, zurückgekehrt, wo Margaret sich erneut in Kurbehandlung begab. Thomson dankte Helmholtz nachträglich für die Übersendung des »Drahtes des gemessenen galvanischen Widerstandes«, den er zum Einsatz gebracht hatte. Er plante, den Freund in Bonn zu besuchen, und Helmholtz, dessen letzte Vorlesung am 8. August stattfand und der sich gerade einer medizinischen Behandlung mit Marienbader Quellwasser unterzog, empfahl ihm, dies noch vor dem 12. August zu tun, da er danach in die Schweiz reisen werde. Anfang August besuchte Thomson ihn dann für zwei Tage in Bonn, und die beiden planten, dass Helmholtz eine Woche später zu den Thomsons nach Schwalbach kommen sollte.22
Dieser Kurort wurde damit zu Helmholtz’ erster Station während seiner Sommerferien. Thomson erwartete ihn am Bahnhof und lud ihn gleich an seinen Tisch ein: »[K]urz ich war wieder ganz, wie im vorigen Jahre sein Gast«, erzählte Helmholtz seiner Frau. Thomson »war wieder sehr liebenswürdig und lebendig«, und die beiden Männer verbrachten ungestört den Tag miteinander. Helmholtz, der bemerkte, dass die weiblichen Kurgäste in Schwalbach hofften, ihren Teint zu verbessern, schaffte es immerhin zweimal, von dem »eiskalten kohlensauren Wasser« der örtlichen Quelle zu trinken. Thomson begleitete ihn am Morgen des nächsten Tages zum Bahnhof, wobei sie über Akustik (Experimente mit Sirenen) sprachen. An seinen Vater schrieb er über ihn: »Er ist gegenwärtig jedenfalls einer der ersten mathematischen Physiker und von einer Schnelligkeit des Erfindens, wie ich sie noch bei keinem anderen Gelehrten gesehen habe.« Thomson und er hatten gemeinsam Experimente durchgeführt: an einem Tag mit einer Sirene, am nächsten Morgen mit Kombinationstönen, und Helmholtz machte sich bald einen von Thomsons Vorschlägen zu eigen, wie man Kombinationstöne hörbar machen könne.23
Von Schwalbach aus fuhr Helmholtz nach Frankfurt am Main, um sich dort mit seinem Bonner Kollegen und Freund Karl Otto Weber zu treffen, der ihn in die Schweiz begleitete. Zunächst reisten sie nach Heidelberg, doch Kirchhoff war nicht da und Bunsen stand kurz vor der Abreise; sein Netzwerk ließ ihn ausnahmsweise einmal im Stich. Also kletterten sie zum Schloss hinauf, »was in bekannter Schönheit glänzte«, und spazierten dann durch die bewaldeten Hügel und die Felder, deren Schönheit und Frische er mehr als zuvor zu schätzen wusste. Er bedauerte es, Olga nicht mitgenommen zu haben, da der Anstieg nicht allzu schwer gewesen war. »Durch die Nähe der Berge und den schönen Wald ist Heidelberg schöner als Bonn«, wie er ihr mitteilte, »aber es fehlt der Fluß, und es ist wahrscheinlich viel weniger wohnlich, als Bonn, so daß man die hiesigen Schönheiten nicht mit Neid anzusehen braucht.« Am nächsten Morgen machten sich Weber und er dann nach Basel auf.24
Dort besuchten sie das Kunstmuseum, denn auch Weber war Kunstliebhaber. Sie sahen Zeichnungen von Hans Holbein (»von wirklich ausgezeichneter Vollendung«), die Helmholtz für ihre außerordentliche »Kraft, [ihren] Character und [ihr] dramatisches Leben« schätzte, obwohl es ihnen seiner Meinung nach an »Grazie« mangelte. Er bekam auch Zeichnungen von Albrecht Dürer zu Gesicht (»von höchst ausgezeichneter Art«), und erst jetzt entwickelte er »große Achtung vor diesen Meistern«. Die Ölgemälde des Museums fand er hingegen »von der bekannten barbarischen Art«. Im Anschluss besuchten er und Weber das mittelalterliche Basler Münster und gingen schwimmen. Basel hinterließ »einen sehr angenehmen Eindrucke«. In der Nacht reisten sie weiter nach Lausanne, »durch ein herrlich romantisches Thal des nördlichen Jura«. Unterwegs erteilte Weber einige Lektionen in Geologie.25
Auf dieser Reise zog er die französischsprachigen Schweizer den Deutschschweizern vor. Ihm gefiel es, dass Erstere »sehr höfliche, gebildete, und offenbar sehr fleißige und ordentliche Leute« waren und seiner Meinung nach die Ausländer nicht so übervorteilten wie ihre Landsleute in Zürich und im Berner Umland: »Die Leute machen durchaus den Eindruck, als wenn sie gesellige Bildung und Ehrenhaftigkeit höher schätzen als den Geldgewinn, und als ob sie unanständige Arten des Gewinns verschmähten.« Doch auch wenn er die »Bildung« höher bewertete als den »Gelderwerb«, so versäumte er es dennoch nicht, die exakten Preise in dem »höchst reinlichen Gasthof« zu vermerken, in dem er nächtigte und Speisen »von ausgezeichneter Beschaffenheit« zu sich nahm.26
Ebenso angetan war er vom Genfer See mit dem Rhonetal: »Das merkwürdigste in dieser Fahrt war ein Wasserfall (dessen Namen in das Deutsche zu übersetzen unanständig ist) Pissevache [also Kuhpisse] genannt«. Er prahlte ironisch damit, dass er »fließend französisch« sprach und »vorläufig glücklicher Weise noch nicht wieder in die Verlegenheit gekommen [bin], mir eine Nagelscheere zu kaufen«. Helmholtz kannte seine Grenzen: »So geht es einem Ehemanne, wenn er sein französisch sprechendes Frauchen nicht mitnimmt.«27
Anschließend wanderten er und Weber von Martigny nach Chamonix (am Mont Blanc), bestiegen die dazwischenliegenden Berge und waren als Lohn für ihre Anstrengungen vollkommen nassgeschwitzt. Weber erwies sich als der robustere und schnellere Kletterer; Helmholtz kam kaum hinterher. Weil Weber sich weigerte, langsamer zu gehen, ließ sich Helmholtz einfach hinter ihn zurückfallen und erreichte schließlich »mit vielem Schweiß« Chamonix. Von dort blickte er auf den Mont Blanc und seine Gletscher, »also mitten in der größesten Alpenwelt«. Es war regnerisch und bewölkt, im Hotel war es eiskalt, und sie waren durchgefroren, aber wenigstens das Essen war anständig. Weber und er bestellten »einen sehr guten starken Rothwein« und sie unterhielten sich, während Helmholtz zur Feier ihrer Reise eine Zigarre rauchte.28 Er erfreute sich an einfachen Genüssen.
Die Pause tat beiden gut, und mit der Wiederkehr der Sonne am nächsten Tag sahen sie den Gipfel des Mont Blanc und die nahe gelegenen Gebirgszüge der Savoyen und der Berner Alpen, »so daß man rings am Horizont die höchsten Berge Europas vertheilt sah«. Sie heuerten einen Führer an, der sie durch das Mer de Glace, »den größesten Gletscher Europas«, führen sollte, den Helmholtz sehr detailliert beschrieb, wobei er anmerkte, dass Goethe ihn ebenfalls erwähnt habe. Gemeinsam überquerten sie den Gletscher, was Helmholtz ziemlich gefährlich fand; und hätte er geahnt, wie gefährlich es tatsächlich war, hätte er es, wie er sagte, gar nicht erst versucht: »[I]ch finde es unverantwortlich, daß man daraus einen Touristenweg gemacht hat, und namentlich Frauen darüber gehen läßt.« Nachdem sie erschöpft und in mürrischer Stimmung an ihrem Ziel angekommen waren, speisten sie »zwischen einigen märkischen und mecklenburgischen Landadel, denen ich allerdings die schlimmsten englischen Touristen vorgezogen haben würde«. Am nächsten Tag ruhten sie sich aus, »um die Füße zu erholen«.29
An seinem 35. Geburtstag (am 31. August 1856) fand sich Helmholtz in Interlaken wieder, von wo aus er Olga in sarkastischem Ton dazu gratulierte, dass sie einen Mann habe, der »Dir zuweilen davonreist und Dich daher nicht immer quält, sondern Dir auch einige Ferien gönnt«. Mit seinem Humor versuchte er, den heiklen Umstand etwas abzumildern, dass Weber nach Bonn zurückkehren, er selbst aber noch einen Tag dranhängen wollte, um »eine wissenschaftliche Reise nach Zürich« zu unternehmen. Die Männer waren von der Besteigung des Faulhorns und der anschließenden Wanderung zum Giessbach erschöpft; dieser Weg erwies sich als ihre bis dahin schwierigste Strecke. Nachdem er den Mont Blanc gesehen hatte, fand Helmholtz die Berner Bergkette weniger beeindruckend; dennoch sei sie »mannigfaltiger und landschaftlich schöner als die Montblanckette, und gefällt und erfrischt deshalb immer von neuem«. Seine Füße schmerzten sehr – er nannte sich Olgas »Ehekrüppel«. Einige Tage später war er zurück in Bonn.30
Der Herbst dieses Jahres brachte eine weitere Ehrung und auch ein Problem mit du Bois-Reymond mit sich, der ihn als korrespondierendes Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften vorschlug. »Du kannst es indessen als abgemacht betrachten«, wie er ihm schrieb. In seinem Dankesbrief hob Helmholtz ausdrücklich darauf ab, was diese Ehrung für ihn und seine Bonner Kollegen bedeute (nämlich Verschiedenes): »Wenn das Resultat günstig ausfällt, wird es außer der innerlichen Ermutigung, die jede Anerkennung urteilsfähiger Leute gibt, auch für meine gesellschaftliche Stellung hier in Bonn von Wichtigkeit sein. In Königsberg würde es in letzterer Beziehung wenig Einfluß gehabt haben; aber hier sind leider die meisten Kollegen stolzer auf Äußerlichkeiten als wissenschaftliche Bedeutung und beurteilen die letztere nur nach dem Erfolge.« Die Akademie wählte ihn einstimmig zum korrespondierenden Mitglied für Anatomie und Physiologie. Du Bois-Reymond war hingegen verärgert über das, was er als Helmholtz’ Undank empfand, und warf ihm vor, ihm nicht für seinen Nominierungsvorschlag gedankt zu haben. Helmholtz antwortete sofort und demütig – »bitte ich Dich feierlichst und reumütig um Verzeihung« –, war aber der Meinung, dass er ihm bereits gedankt habe. »Ich habe Dir schon früher geschrieben«, führte er zu seiner Entlastung an und bezog sich dabei auf seine frühere Aussage in Bezug auf Bonn. Weiter erklärte er: »Aber auch für das eigene Bewußtsein ist eine solche Anerkennung immer eine Stärkung und Ermunterung, namentlich, wenn man unter Volk leben muß, die meistens gar keinen Sinn für wissenschaftliche Wirksamkeit haben; wenigstens unter unsern Naturforschern ist dies sehr der Fall, unter den philologisch historischen Leuten sind allerdings achtbare Köpfe und Charaktere, deren Studien den meinigen aber zu fern liegen.«31 Nie hat er ein Gefühl der Zugehörigkeit oder der Achtung für seine Bonner Kollegen aus den Naturwissenschaften empfunden.
Auf der anderen Seite des Rheins war die Begeisterung von Helmholtz als Wissenschaftler weniger stark ausgeprägt. Vor allem Claude Bernard glaubte, dass Helmholtz – im Gegensatz zu ihm selbst, der sich immer auf der Suche nach neuen Fakten sah (zumindest bis in die späten 1850er-Jahre) – nur nach den Gesetzen für bekannte Phänomene suchte: »Ich habe also das Ziel gehabt, die Analyse zu erweitern«, wie sich Bernard in seinem Notizbuch selber lobte, »denn es gibt diejenigen, die sich nur damit beschäftigen, nach dem Gesetz der Dinge zu suchen, die bekannt sind, die aber nicht versuchen, etwas Neues zu lernen. Helmholtz, du Bois Reymond usw. gehören in diese Kategorie. Ich dagegen wollte die Seite der Neuerung vertreten.« Und weiter: »Mir ist gesagt worden, dass ich finde, was ich nicht suche, während Helmholtz nur das findet, was er sucht. Das stimmt, aber die zweite Richtung ist schlecht, wenn [sie nur] alleinig [auftritt].«32 An Neid mangelte es auf beiden Seiten des Rheins nicht.
Wie wir hören oder Über Kombinationstöne
Der erste Teil des Handbuchs erschien im Herbst 1856. Viele Forscher warteten bereits gespannt auf sein Erscheinen. Mitte Dezember fragte Maxwell bei Thomson schriftlich an: »Wo ist Helmholtz über das Auge zu finden?« Und zwei Wochen später fragte wiederum Thomson bei Helmholtz an: »Wann wird Ihr Buch über das Auge fertig sein, oder ist es bereits so weit? Ich stelle fest, dass die Leute sehr daran interessiert sind, vor allem an den Anpassungen.« Er teilte ihm außerdem mit, dass er alles über dessen von Siemens und Halske hergestelltes Galvanometer erfahren habe und es auch gerne erwerben wolle, und dass das atlantische Telegraphenkabel gerade produziert werde und im Mai des folgenden Jahres verlegt werden solle, sodass, wie er hoffte, die ersten transatlantischen telegraphischen Mitteilungen (zwischen Irland und Neufundland) bis Juli möglich wären. In seiner Antwort ging Helmholtz auf seine jüngsten Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem Gebiet der physiologischen Optik und Akustik ein. Mit dem zweiten Teil des Handbuchs sei er jedoch noch nicht viel weitergekommen, wie er sagte, da er sich nun so intensiv mit der physiologischen Akustik befasse. Schon 1848/49 hatte er (in den Fortschritten der Physik) neuere Arbeiten zur theoretischen Akustik und zu akustischen Phänomenen besprochen. (Die Zeitschrift war mit ihren Veröffentlichungen mehrere Jahre im Rückstand, und so erschienen seine beiden Rezensionen erst 1852 und 1854.)
Irgendwann Ende des Jahres 1855 oder Anfang 1856 begann Helmholtz damit, sich intensiv und mit Publikationsabsichten der Akustik zuzuwenden. So bestellte er zum Beispiel bei Ferdinand Sauerwald in Berlin eine nach seinen Wünschen gefertigte Doppelsirene; bei der Untersuchung der Tartini-Töne zeigte er sich sehr zufrieden mit ihr. Anfang Mai 1856 vollendete er seine Schrift über die Tartini-Töne, mit der er hoffte, das Verhältnis zwischen dem Hören einerseits und der Konsonanz und Dissonanz von Tönen andererseits zu vereinfachen; sie erschien noch vor Monatsende. Anfang Juni referierte er zu diesem Thema vor dem Naturhistorischen Verein der preussischen Rheinlande und Westphalens. Seine umfassende Darstellung des Themas brachte er jedoch erst später in diesem Jahr in einem langen Beitrag über Kombinationstöne in den Annalen heraus. Was die Arbeit am zweiten Teil des Handbuchs anging, so glaubte er, dass er mindestens für ein Jahr nicht mehr dazu kommen werde.33
Während die breite Anerkennung einer mathematischen (harmonischen) Beziehung zwischen Klängen und Musik bis zu den alten Griechen zurückreichte, wurde erst mit der Erfindung der harmonischen Analyse zwischen dem 17. und dem frühen 19. Jahrhundert ein mathematisch-physikalisches Werkzeug zur Analyse akustischer Phänomene verfügbar. Den Höhepunkt dieser Entwicklung kennzeichnete in den 1820er-Jahren Joseph Fouriers Methode der harmonischen Analyse, die auf ein Verständnis thermischer Phänomene abzielte und die mathematische Grundlage bildete, auf der sich die akustische Theorie in den 1840er-Jahren erstmals neu strukturieren konnte. (Fourier und viele seiner Vorgänger waren sich über die Verwandtschaft zwischen ihren mathematischen Analysen und der Analyse akustischer Phänomene natürlich im Klaren.) Ihre genialste Anwendung fand die akustische Theorie dann letztendlich in Helmholtz’ Theorie der Kombinationstöne von 1856,34 die die Grundlagen für die physiologische Akustik im modernen Sinne legte, und zwar sowohl für Helmholtz’ eigene spätere Arbeiten als auch für das Forschungsfeld als Ganzes.
Seine Analyse begann mit einer erneuten Untersuchung eines älteren (1839 – 1849), ansonsten vergessenen Streits zwischen den Physikern Georg Ohm und August Seebeck über die mathematische Definition des Tons.35 Ohm war vor allem für sein elektrisches Gesetz berühmt geworden, das das Verhältnis zwischen Stromstärke, Spannung und Widerstand in einem Leiter ausdrückt (dass nämlich die Spannung gleich der Stromstärke mal dem Widerstand ist). Daneben war er allerdings auch für sein akustisches Gesetz bekannt, das für die auditive Wahrnehmung von zentraler Bedeutung ist: Musikalische Töne sind periodischer Natur, wobei das Ohr eine Ansammlung von Tönen wahrnimmt, die aus reinen harmonischen Tönen besteht; und wie er behauptete, löst das Ohr diese durch die Fourier-Analyse in einfache oder zusammengesetzte Töne auf. Seebeck seinerseits hatte zuvor (1819) erhebliche Verbesserungen an Charles Cagniard de la Tours Sirene zur Erzeugung von Tönen einer bestimmten Frequenz vorgenommen und machte deutsche und andere Wissenschaftler auf ihre mögliche Verwendung in der akustischen Analyse aufmerksam. Ohm verwendete die Fourier-Analyse zur Darstellung von Wellenschwingungen im Ohr, die durch einen Ton in einer bestimmten Höhe erzeugt werden – faktisch verwandelte er das Ohr damit in einen harmonischen Analysator. Seebeck zeigte dagegen, dass Ohms Analyse mathematische Fehler enthielt, die sein Gesetz beeinträchtigten, und dass es von spezifischen empirischen Fakten abhängig war, darunter solche physiologischer und physikalischer Art. Seebecks Analyse besagte, dass die sogenannten Obertöne eines Klanges »Kombinationstöne« erzeugten; deshalb, so urteilte er, sei der Grundton auch lauter zu hören als die Obertöne. Damit hatte Seebeck Ohm in diesem Disput nun anscheinend geschlagen, denn Letzterer konnte nicht erklären, warum der Grundton eines Sirenenklangs viel leichter zu hören war als seine Obertöne. Darüber hinaus vermutete Seebeck, dass die Klangfarbe eines Tons irgendwie von seinen höheren Teiltönen bestimmt werde. Diese Fragestellungen und die darauf jeweils gegebenen Antworten stellten den Rahmen von Helmholtz’ eigener Analyse dar. Außerdem bildeten seine lebenslange Leidenschaft für die Musik sowie seine kürzlich abgeschlossene Arbeit über das Auge (also Teil I des Handbuchs) einen Teil des Hintergrunds, vor dem sich seine Hinwendung zur physiologischen Akustik abspielte. Anregungen gingen vielleicht aber auch von seinen jüngsten philosophischen Untersuchungen zur menschlichen Sinnesphysiologie (1852), zur richtigen wissenschaftlichen Methode (Goethe 1853) und zur menschlichen Wahrnehmung (1855) aus.
Helmholtz trat als Fürsprecher des Ohm’schen Gesetzes auf, und auch wenn er einige Zweifel daran und an seiner experimentellen Grundlage gehabt haben mag, so war er dennoch der Auffassung, dass es ihm die Mittel zum Verständnis von Kombinationstönen an die Hand gab. Mit einer Sirene zur Tonerzeugung, Stimmgabeln zur Frequenzeinstellung und Resonatoren (Resonanzkörpern) zum Hören war er in der Lage, den Grundton von den höheren Teiltönen zu unterscheiden und Kombinationstöne erster Ordnung zu erzeugen. Von hier aus gelangte er dann zu einer Definition des Tons und erkannte die zentrale Bedeutung der Obertöne für seine Schwebungstheorie der Konsonanz und für das Verständnis der Klangfarbe. Durch seine experimentellen Arbeiten erschloss sich ihm die Bedeutung der Obertöne (das heißt der höheren Teiltöne) für akustische Phänomene und deren mathematische Darstellung, und mithilfe seiner Resonatoren gelang es ihm, entweder seine neu entdeckten »Summentöne« oder die bereits bekannten »Differenztöne« zu hören. Wie er herausfand, hatten diese Kombinationstöne ihren Ursprung in den Gehörknöchelchen des Mittelohrs und waren auf die nichtlineare Reaktion des Ohrs zurückzuführen. Genau das, so schloss er später, machte sie weitgehend objektiv, auch wenn sie (als Zeichen – und nicht als Abbildungen – der äußeren Wirklichkeit) einer kontinuierlichen Interpretation durch den Verstand im Rahmen eines Prozesses bedurften, den er als »unbewussten Schluss« bezeichnete. Insgesamt präsentierte er sich hier teils als Philosoph, teils als empirischer Forscher und teils als mathematischer Wissenschaftler. Später kehrte er erneut zu diesen und verwandten akustischen und philosophischen Fragen zurück und entwickelte sie in der Lehre von den Tonempfindungen (1863) sowie in »Tatsachen in der Wahrnehmung« (1878) weiter.36
Marktwert: Preußen übertrumpft Baden
Nach den Wirren des Jahres 1848 verstärkte Baden, wie eine Reihe anderer deutscher Staaten auch, sein Engagement im Bereich der akademischen Bildung. Besonders fasste man die Naturwissenschaften ins Auge, von denen man erhoffte, sie würden sich für die Landwirtschaft, die Medizin und die Industrie als hilfreich erweisen. Den seit Langem bestehenden Forderungen einer liberal gesinnten Mittelklasse nach Modernisierung wurde damit Rechnung getragen. Kostspielige neue chemische Institute entstanden an der Polytechnischen Schule in Karlsruhe (1851) und in Heidelberg (1855), dort speziell für Bunsen. Heidelberg erhielt 1849 auch ein modernes anatomisches Institut. Obwohl in der dortigen Fakultät einige die zunehmende Bedeutung der experimentellen Physiologie für die Medizin durchaus erkannten, entschloss sich der Staat erst 1858 dazu, ein neues physiologisches Institut zu errichten und den gemeinsamen Lehrstuhl für Anatomie und Physiologie aufzuspalten. Doch führte das Bestreben, die Medizin landesweit zu reformieren und das medizinische Angebot in Heidelberg zu stärken – ebenso wie der Wunsch, mit Preußen in kultureller Hinsicht konkurrieren zu können – zu der Bereitschaft, außerordentliche Ressourcen aufzuwenden, um einen herausragenden Physiologen für Baden zu gewinnen.37
Die 1850er- und mehr noch die 1860er-Jahre waren Boomjahre, in deutschen Landen ebenso wie im sonstigen Mittel- und Westeuropa. Das Wachstum in den Bereichen Eisenbahnnetz, Eisen- und Stahlindustrie, Maschinenbau, Kohle-, Textil- und Schwerindustrie generell sowie ähnlich auch in der Landwirtschaft und dazu noch die Entdeckung von Goldvorkommen in Kalifornien und Australien ließen die deutsche Wirtschaft bis zur Großen Depression von 1873 kontinuierlich wachsen. Bei den Regierungen saß das Geld dementsprechend recht locker. Mitte der 1850er-Jahre, als Baden vermehrt in das Hochschulwesen investierte und Heidelberg sein Engagement für die Physiologie verstärken wollte, wurde ein Wissenschaftler wie Helmholtz hoch gehandelt. Im Mai 1857 informierte ihn Bunsen, dass Heidelberg einen neuen Physiologen bekommen werde, und gab der Hoffnung Ausdruck, dass das Helmholtz sein würde (und nicht Brücke, du Bois-Reymond oder Ludwig). In Heidelberg war man bereit, viel Geld zu zahlen, um ihn dorthin zu locken, und als Professor für Physiologie würde er ein finanziell gut ausgestattetes Institut leiten. Es gab dort etwa 120 Medizinstudenten und ungefähr 40 weitere Studenten, die gegebenenfalls medizinische Kurse belegen würden. In Heidelberg schätze man ihn sehr, betonte Bunsen, und wollte wissen, ob Helmholtz an der Stelle interessiert sei und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Dem badischen Innenministerium teilte er mit, dass von den vier infrage kommenden Kandidaten (Helmholtz, Brücke, du Bois-Reymond und Ludwig, in dieser Reihenfolge) Helmholtz »unzweifelhaft […] der genialste, begabteste und vielseitig gebildetste« sei, wie es seine beigefügte Publikationsliste zeige.38
Helmholtz berichtete du Bois-Reymond das Wesentliche aus Bunsens Brief und lehnte eine Bewerbung ab, weil er glaubte, dass du Bois-Reymond dorthin gehen wolle und Heidelberg ihm ohnehin »keine fundamentalen Vorteile« gegenüber dem bieten könne, was er bereits in Bonn habe. Er wollte du Bois-Reymond nicht im Wege stehen und teilte ihm mit, dass er Bunsen gebeten habe, nur mit ihm zu verhandeln. Ergänzend fügte er hinzu, dass er dem preußischen Ministerium »eine gewisse Verpflichtung persönlicher Dankbarkeit« schulde, weil es ihn Olgas Gesundheit wegen nach Bonn gebracht habe.39 Dies war ein Akt des Eigeninteresses, der Freundschaft und von »Noblesse oblige« – oder es schien zumindest so.
Eigentlich deprimierte ihn seine Entscheidung jedoch, da er die Bonner Akademikerszene »leider sehr faul« fand, keine Chance auf ein neues Anatomiegebäude sah und zu Recht annahm, dass dies vor allem auf die mangelnde Kooperation des Senats der Universität zurückzuführen war. Der hatte sich mehrere Jahre lang gegen den Verkauf von Grundstücken aus Hochschulbesitz gesperrt, um auf diesem Wege das notwendige Kapital für den Neubau von Institutsgebäuden zu beschaffen. Also saß er auch weiterhin in seinem »alten Schmutzloche« der Anatomie, ohne Assistent, und tat nichts für das Fach. Von einigen seiner Bonner Kollegen aus wissenschaftlichen oder Medizinerkreisen fühlte er sich ebenso beleidigt wie vom Ministerium; die »niedrigen [d. h. pekuniären] Motive«, die manche Bonner Fakultätsmitglieder an den Tag legten, empfand er als beschämend und ihr Verhalten als unwürdig. Besonders nagte es an ihm, wenn die altgedienten Fakultätsangehörigen in die Art und den Stundenplan von Lehrveranstaltungen hineinredeten, die von Privatdozenten oder von ihm selbst gegeben wurden. Helmholtz erklärte, dass er und Busch (und in der Vergangenheit auch Budge) »die Fortschrittspartei in der Fakultät bildete[n]«, sie aber jetzt, da er und Busch allein »der kompakten Reaktionspartei gegenüber[stünden]«, keine Chance mehr hätten. Sowohl in der medizinischen als auch in der philosophischen Fakultät wusste er von Fällen, in denen sich Nachwuchswissenschaftler, um habilitiert zu werden, offiziell hatten verpflichten müssen, keine Veranstaltungen anzubieten, die den Veranstaltungen der älteren Kollegen irgendetwas nehmen könnten. Ein solches Verhalten fand er moralisch »scandalosa« und war einigermaßen erstaunt, wenn andere nicht auch so dachten. Es verärgerte ihn auch, dass die Kollegen seinen Physiologiekurs für Medizinstudenten zur gleichen Zeit wie die anorganische Chemie angesetzt hatten. Sie legten ihm gegenüber einfach keinerlei Wohlwollen an den Tag, so sein Empfinden. Er konnte anscheinend nichts anderes tun, als sich um seinen Garten zu kümmern, und stürzte sich mit neuem Elan in seine Arbeit: »Ich habe allmählich ziemlichen Stoff zur Reform der physiologischen Akustik angesammelt«, teilte er du Bois-Reymond mit, und dass er auf einige Instrumente warte, um das Werk abschließen zu können.40
Du Bois-Reymond antwortete von Berlin aus, dass er seit sechs Monaten mit Kirchhoff darüber verhandelt habe, nach Heidelberg zu gehen, und, wie Helmholtz und Brücke auch, kürzlich von Bunsen gehört habe und nach seinen Bedingungen gefragt worden sei. Wenn Heidelberg seine Forderungen erfülle, werde er akzeptieren, denn wenn Helmholtz den Ruf erhielte und annähme, dann wäre er, du Bois-Reymond, faktisch gezwungen, die Position von Helmholtz in Bonn zu übernehmen, wie er mit Bedauern feststellte. Du Bois-Reymond hatte Berlin gegenüber seine Vorstellungen geäußert, obgleich er wusste, dass sie nicht erfüllt werden würden. Daher ging er davon aus, (entgegen seinem Willen) nach Heidelberg zu gehen, was er als »eine Art Niederlage« für sich betrachtete. Immerhin bestand, wie er dachte, der einzige wesentliche Unterschied zwischen Heidelberg und Bonn darin, dass Heidelberg eine reine Physiologiestelle im Angebot hatte. Doch er schätzte das Interesse Heidelbergs an seiner Person völlig falsch ein, wenn er glaubte, dass sein akademisches Schicksal aus Entscheidungen resultiere, die Helmholtz betrafen. Dieser teilte ihm umgehend die Neuigkeit mit, dass die medizinische Fakultät in Heidelberg gerade Friedrich Wilhelm Delffs, ihren Professor für pharmazeutische, physiologische und organische Chemie, nebst dem Prodekan der Fakultät zu Verhandlungen mit ihm entsandt habe. Delffs hatte er mitgeteilt, dass er einen Wechsel für ein Gehalt von weniger als 2000 Talern nicht in Betracht ziehen werde und sich weder vorstellen könne, dass Baden so viel für einen Professor der Physiologie zahlen würde, noch, dass Preußen ihn auf seine Bitte hin nach Baden entlassen würde.41
Helmholtz hoffte jedoch insgeheim, dass die Interessensbekundung vonseiten Badens ihm ein Druckmittel gegen Preußen in die Hand geben würde, um seine Lage in Bonn zu verbessern. Er bat du Bois-Reymond, sich dahingehend mit ihm zu verschwören, dass er (du Bois-Reymond) das Ministerium nicht über seine Absichten informieren oder zumindest behaupten werde, es sei unwahrscheinlich, dass er nach Heidelberg gehen werde. Helmholtz glaubte, dass Arnold den Lehrstuhl und das Institut für Physiologie zwar als sein Eigentum ansehe, ihn aber abtreten würde, wenn ihm der neue Physiologe gefiele. Außerdem ließ er du Bois-Reymond wissen, dass die Heidelberger Fakultät einen russischen Studenten gebeten hatte, sowohl seine als auch du Bois-Reymonds Vorlesungen zu besuchen und über ihre Lehrmethoden und -fähigkeiten zu berichten. Der Russe äußerte sich erwartungsgemäß kritisch zu ihren physikalisch ausgerichteten Physiologievorlesungen. Du Bois-Reymond hielt ihn für einen Lügner.42
Tatsächlich tat Helmholtz mehr, als nur seinen Garten in Schuss zu halten. Er präsentierte den Offiziellen der Bonner Universität das Schreiben von Bunsen und berichtete ihnen, dass Delffs nach Bonn gekommen sei, um mit ihm zu verhandeln. Demnach sei er, Helmholtz, entweder der einzige Kandidat oder »primo loco «, außerdem beinhalte das Angebot auch ein neues Institut für Physiologie. Dass er Bonn nun von diesen Entwicklungen unterrichte, geschehe in der Hoffnung, dass die Universität und ihr Senat ihre Meinung ändern und endlich etwas Grundbesitz verkaufen würden, um Kapital für ein neues Institutsgebäude zu beschaffen. Helmholtz war der Meinung, dass seine Kollegen (einschließlich seines Dekans) zu wenig Vertrauen in seine wissenschaftliche Arbeit hätten und nicht bereit seien, ihn ausreichend zu unterstützen. Deshalb sah er auch keine Chance, jemals ein neues Institutsgebäude zu bekommen – alles in allem »eine sehr niederdrückende Aussicht« für ihn. Der Mangel an geeigneten Räumlichkeiten hindere ihn daran, die gesteckten Arbeitsziele zu erreichen, wie er sagte, und deprimiere ihn, weil er und Busch keinen Einfluss auf die Fakultätsmehrheit hätten, die alle ihre Vorschläge ablehne und ihnen sogar noch Steine in den Weg lege. All dies erklärte, warum er das Angebot aus Baden noch nicht abgelehnt hatte, obwohl er weiterhin dankbar war für die frühere Unterstützung des Ministeriums bei seinem Wechsel von Königsberg nach Bonn. Für sein Bleiben stellte er zwei Bedingungen: die Zustimmung zum Institutsneubau und eine Erhöhung seines Gehalts um 400 auf 1600 Taler. Ein Beamter der Bonner Universitätsverwaltung notierte: »Welch ein entsetzlicher Schlag ein Verlust von Helmholtz für uns wäre, darf ich mich jeder Ausführung enthalten. Mit seinem Fortgehen würde unsere Hochschule sich eines Mannes beraubt sehen, welcher nicht allein durch seine genialen wissenschaftlichen Leistungen, das ihm angeborene glückliche Lehramt und seinen moralischen Werth schon jetzt als eine ihrer Hauptzierden betrachtet werden muß […].« Darüber hinaus stelle Helmholtz sich, wie der Mann ergänzte, gemeinsam mit Busch gegen die älteren (oder wissenschaftlich schwachen), wenig fortschrittlich eingestellten Mitglieder der medizinischen Fakultät, und wenn diese besiegt werden sollten, dann nur durch die Bemühungen von Helmholtz und Busch. Helmholtz bezeichnete er als »die Preußische Standarte der Wissenschaft im Westen [Preußens]«; das Ansehen Bonns werde ohne Helmholtz sinken. Er nahm an, dass das Ministerium seine Meinung teilte. Es möge daher alles ihm Mögliche unternehmen, um Helmholtz’ Bedingungen zu erfüllen, die er allesamt für gerechtfertigt hielt. Das preußische Ministerium antwortete mit einer Gehaltserhöhung von 400 Talern, deutete weitere Erhöhungen an und versprach ein neues Anatomiegebäude, sobald es die finanziellen Verhältnisse erlaubten.43 Es war zügig aktiv geworden.
Zehn Tage später teilte Kirchhoff Helmholtz im Vertrauen mit, dass nur er für die Stelle empfohlen worden sei, das (badische) Ministerium ihn »auf das Dringendste« haben wolle und bald ein formelles Angebot auf den Weg gebracht werde. Und er ergänzte, dass alle in Heidelberg, wo Helmholtz bereits Freunde hatte, sein Kommen befürworteten. Mitte Juli lehnte Helmholtz als Reaktion auf die Gehaltsaufstockung das Heidelberger Angebot offiziell ab und äußerte gegenüber du Bois-Reymond, seine Entscheidung sei »definitiv«.44
Helmholtz stellte mit seinem geschickten Agieren im Wettbieten zwischen Preußen und Baden um seine Dienste strategisches Verhandlungsgeschick unter Beweis und dies, ohne dabei jemandem zu nahe zu treten. Er hatte sein Ansehen und die Bedeutung der Physiologie ins Feld geführt, um eine 25-prozentige Gehaltserhöhung und das erneuerte Versprechen auf ein neues Institutsgebäude herauszuschlagen. Selbst die Kleinigkeiten entwickelten sich jetzt in seinem Sinne. Ludwig berichtete, dass der Inhaber einer Wiener Firma für wissenschaftliche Instrumente ein Fotoalbum mit den größten zeitgenössischen Naturwissenschaftlern zusammenstellte und »natürlich« auch eine Aufnahme von Helmholtz haben wollte. Endlich floss Helmholtz zudem die überfällige Bezahlung für seine Vorlesungstätigkeit aus seinen Königsberger Tagen zu. Justus Olshausen, der ihm das Geld weiterleitete, war der Meinung, dass Helmholtz gut daran getan habe, nicht nach Heidelberg zu gehen, »welches gar nicht in dem Rufe steht« wie Bonn.45
Als er die Heidelberger Verhandlungen und einen Besuch seines Vaters und seiner Schwester Julie in Bonn hinter sich hatte, unternahm Helmholtz Mitte August (wieder ohne Olga) eine weitere Wandertour in der Schweiz. Da er auf dem Weg zur Rigi war, durchquerte er Zürich nur und hatte keine Zeit, seine dortigen Freunde zu besuchen. Am Ziel angekommen, traf er sich mit Freunden aus Bonn sowie mit seinem Freund Heine, dem Hallenser Mathematiker. Anschließend machten er und ein russischer Arzt sich auf den Weg nach Riffelhaus und zum Monte Rosa, etwa 2500 Meter über dem Meeresspiegel gelegen. Sie durchwanderten das Rhonetal, dessen Gletscher Helmholtz als überwältigend und wie einen »Krystallpalast« erlebte. Nach so vielem Wandern waren seine Lederstiefel ruiniert und er musste sich für den Aufstieg auf den Monte Rosa ein Paar Bergschuhe kaufen. Er kletterte – langsam und ohne Rucksack – so hoch, dass seine Nase blutete. Der Russe und er wollten auf die italienische Seite hinüber, von wo aus er plante, zum Lago Maggiore zu wandern, bevor er sich wieder ins Rheintal und dann zurück nach Bonn aufmachte.46
Ein philosophischer Familiendisput
Da er auf dem Gebiet der physiologischen Akustik tätig war, musste sich Helmholtz auch mit einigen »philosophischen« Problemen befassen, die ebenso persönlicher wie intellektueller Art waren. Eines davon betraf seinen Vater, dessen Gesundheit sich weiter verschlechterte. Ferdinand klagte seinem alten Freund Fichte gegenüber über das Altern und sein schwindendes Erinnerungsvermögen, »Gehirndruck und dergleichen«. Im Herbst 1856, nach 36 Jahren Lehrtätigkeit, war er aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes gezwungen, in den Ruhestand zu treten. Seit Ferdinand und Fichte sich bei Hermanns Taufe im Jahr 1821 zum letzten Mal gesehen hatten, war Letzterer zu einem produktiven Philosophen geworden, dessen Schriften eine Bandbreite von der Theologie, Ethik und Metaphysik bis hin zur Anthropologie und Psychologie aufwiesen. Seine generelle Haltung war antimaterialistisch und pro-christlich, aber auch liberal. Hermanns Schriften studierte er eifrig und war ein großer Bewunderer seines Patensohnes geworden. Er las, was Helmholtz über die Krafterhaltung geschrieben hatte, und brachte das Prinzip auf sein eigenes psychologisches System »zur Anwendung«; er las dessen Ausführungen über Goethe, und er versuchte, Helmholtz’ Zeichentheorie der Wahrnehmung in seiner eigenen Psychologie (1864, 1873) zu verwenden. In seinem Tagebuch vermerkte er, dass Hermann ihm gerade »einen wichtigen Brief […] mit einsichtsvollen Äußerungen« über das Verhältnis von Naturwissenschaft und Philosophie geschickt habe, und schrieb über ihn an Ferdinand: »[…] Du weißt, wie ungemein ich seinen Geist schätze. Auch leuchtet sein gediegenes Urteil aus jeder seiner Zeilen hervor. Ich glaube durchaus, mich mit ihm verständigen zu können […].« Fichte fand, dass Hermanns philosophischer Standpunkt – er nannte ihn kantianisch – auch für seine, Ferdinands, philosophische Anschauung relevant sei, und teilte diesem mit, dass Hermanns (und anderer) empirische Erkenntnisse über die Sinnesphysiologie und sein Verständnis von ihr »Aufmerksamkeit« in der Psychologie erregt hätten. Zudem stellte er fest, dass alle neueren physiologischen und psychologischen Befunde Hermanns sowohl mit seiner, Fichtes, Anthropologie (1856) als auch mit dem Buch, das er damals über Psychologie schrieb, im Einklang standen. »Mir selber könnte nichts Erwünschteres sein, als bei Deinem Sohne einen vollständigen Vortrag über Physiologie zu hören.«47 Ferdinand war ohne Zweifel stolzer denn je auf die intellektuellen Leistungen und das Ansehen seines Sohnes.
Nicht alle deutschen Philosophen waren so voller Bewunderung. Auch wenn sein Einfluss vor allem außerhalb der akademischen Welt lag, gehörte Arthur Schopenhauer doch zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Philosophie des 19. Jahrhunderts, insbesondere zu Zeiten der sich zuspitzenden Debatte über den Materialismus und des aufkommenden Neukantianismus. Seine Betonung der Emotionen, des Willens, des Irrationalen und der Askese, ganz zu schweigen von seiner Kritik an Optimismus und Fortschritt, waren für jemanden wie Helmholtz weder interessant noch ansprechend. Dennoch gab es einen Berührungspunkt, der zu Kontroversen führte: Schopenhauer und seine Anhänger glaubten, dass die Veröffentlichung von Schopenhauers Schrift Ueber das Sehn und die Farben (Erstausgabe 1816, Zweitausgabe 1854), die Goethes Farbenlehre propagierte und weiter ausbaute, ihren Verfasser als Farbtheoretiker und Sehforscher qualifiziere. Wie sein dilettierender Kollege Goethe war auch Schopenhauer frustriert von der Reaktion der Fachwelt, die er als Missachtung und mangelnde Anerkennung gegenüber seiner herausragenden Arbeit auf dem Gebiet der Farbenlehre und seines philosophisch tiefgründigen Verständnisses vom Sehen empfand.48 So kam es, dass Helmholtz zwar bereits mehrere wissenschaftliche Gegner hatte, in Schopenhauer jedoch seinen ersten (wenn auch nicht letzten) Feind fand. Schopenhauer stand in einer antirationalistischen philosophischen und kulturellen Denktradition Deutschlands, die sich an manchen Stellen als Naturwissenschaft tarnte und bis zum Ende der Nazizeit lebendig blieb.
Bereits im Juni 1853 war Schopenhauer auf Helmholtz aufmerksam geworden. Am Anfang tat er ihn als Teil einer sich angeblich selbst genügenden akademischen Clique ab und hielt dessen Schrift über Goethe für einen Versuch, sich lieb Kind zu machen. (Er wandte sich auch gegen Ferdinand, seinen früheren Freund; die beiden hatten 1811/12 gemeinsam Fichtes Vorlesungen in Berlin besucht.) Helmholtz’ Aufsatz über Goethe fand er »abgeschmackt« und schalt seinen eigenen Freund und Fürsprecher Julius Frauenstädt dafür, Helmholtz in Sachen Farben und Sehen seiner (Schopenhauers) ebenbürtig zu erachten (das sei, als würde man den Mont Blanc mit einem Maulwurfshügel vergleichen). Im Januar 1856 hatte Schopenhauer Helmholtz jedenfalls als »Lump« erkannt und behauptete, dass jener es in seinem Kant-Gedenkvortrag versäumt habe, Schopenhauers Beiträge zur Farbenlehre zu erwähnen; sogar abgekupfert habe er von ihm und anderen. Helmholtz’ Aufsatz über Goethe hielt Schopenhauer für wertlos, und den über die Wechselwirkung der Kräfte für kaum besser.49
Nachdem Hermann ihm im September desselben Jahres ein Exemplar des Handbuchs (Teil I) übersandt hatte, richtete Ferdinand seine Aufmerksamkeit auf Francis Bacons erkenntnistheoretische Ansichten zum Verhältnis von empirischem und apriorischem Wissen und auf Schopenhauer. Er griff den Vorwurf Frauenstädts auf, dass Hermann in seinem Kant-Gedenkvortrag Schopenhauers erkenntnistheoretische Positionen plagiiert habe. Ferdinand nahm Hermann natürlich in Schutz und wies darauf hin, dass Schopenhauers eigene Ansichten bereits bei Kant und Johann Gottlieb Fichte zu finden seien. Hermann erwiderte darauf, er habe sich »sehr gefreut«, dass es Ferdinand gut gehe und er weiterhin philosophisch schreibe (wenn auch nicht veröffentliche). Wie er fand, war nun der richtige Moment dafür gekommen, dass ältere Männer wie sein Vater einer jüngeren Generation die Bedeutung Kants und Johann Gottlieb Fichtes neu erklärten, »da der philosophische Rausch und zugehörige Katzenjammer der naturphilosophischen Systeme von Hegel und Schelling vorüber zu sein scheint, und die Leute wieder anfangen, sich für Philosophie zu interessieren«. Hegels idealistische Philosophie fand er schlimmer als einfach nur nutzlos, da sie versuche, sich selbst an die Stelle der Wissenschaft zu setzen. Ebenso wenig beeindruckt war er vom Werk Immanuel Herrmann Fichtes, der auf seine eigene Art genau das Gleiche tue. Schelling, Hegel und Fichte junior hatten es ihm zufolge allesamt versäumt, ihre philosophischen Ansichten auf eine empirische Grundlage zu stellen, weshalb sie zwangsläufig scheitern mussten. (Tatsächlich war er vom philosophischen Werk des jungen Fichte besonders unbeeindruckt und teilte dies seinem Vater auch mit.) Er glaubte, dass sich die Philosophie vor allem mit den Bedingungen wissenschaftlicher Erkenntnis befassen sollte, also mit Epistemologie. Kant und vielleicht auch Fichte senior hätten dies immerhin verstanden, wie er hinzufügte. Was Schopenhauer anging, so führte Helmholtz seinen jüngsten Erfolg darauf zurück, dass er auf Kant aufsetze.50
Ferdinand verteidigte seinen alten Freund Immanuel Herrmann Fichte mit Nachdruck. Obwohl er gesundheitlich angeschlagen war – er spürte immer noch Druck auf dem Gehirn, seine Hand zitterte so sehr, dass er kaum schreiben konnte, und seine Augen versagten –, zeigte er sich entschlossen, philosophisch »aufzuholen«, inneren Frieden zu finden und eine Art von »Einheit« in sein Leben zu holen, bevor ihn sich der Tod, wie er schon spürte, greifen würde. Aber er fühlte sich noch stark genug, seinen Sohn scharf zu kritisieren für seine philosophischen Überlegungen, die Ferdinand für nicht hinreichend durchdacht hielt, und sein »Vorurtheil« gegenüber Fichte juniors Werk. Ferdinand nahm an, dass Hermann vielleicht durch sein naturwissenschaftliches Interesse (das heißt den Empirismus) zu weit getrieben worden sei und so die Bedeutung apriorischer Ideale und ihre Wechselwirkung mit den Dingen in der Welt aus dem Blick verloren habe. Um wahres Wissen hervorzubringen, müssten Ferdinand zufolge Denken und Beobachten in ständiger Wechselwirkung miteinander tätig sein. Das Problem mit Schelling, Hegel und ihren Anhängern lag – so belehrte der inzwischen pensionierte, unveröffentlichte Amateurphilosoph seinen Sohn – darin, dass sie die Bedeutung des Empirischen für den Erkenntnisprozess vergessen hatten, während das Problem mit Männern wie Moleschott und Vogt das sei, dass sie versuchten, alles auf bloße Materie und ihre Wechselwirkung zu reduzieren. Fichte hingegen sei frei von den Unzulänglichkeiten sowohl der Idealisten wie auch der Materialisten. Er habe gewusst, wie man sich wissenschaftliche Erkenntnis für philosophische Zwecke zunutze mache, um »Seelenerkenntniss« zu erlangen – noch etwas, das Hermann nicht vergessen sollte. Im Weiteren belehrte Ferdinand den Sohn über Fichtes Verständnis von der Natur und den Eigenschaften der Seele, wobei er selbst dahingehend milde Kritik an dem Philosophen übte, dass dieser darin zu weit gegangen sei. Am wichtigsten aber sei, dass die Philosophie an dem einen oder anderen Punkt die Befunde der Naturwissenschaft in sich aufnehmen müsse, um die »Selbsterkenntniss« und damit das Verständnis der Seele zu erweitern. Nicht einmal die Nutzanwendungen der Wissenschaften auf das gesellschaftliche Leben des Menschen seien so wichtig wie dies. Was Schopenhauer betraf, so wies Ferdinand dessen Vorwürfe an Hermanns Adresse zurück und hielt ihm seinerseits vor, auf der öffentlichen Bühne jene Achtung zu suchen, die er unter den Philosophen nicht zu erlangen vermochte.51
Hermann antwortete seinem alternden und kranken Vater freundlich und ergeben, dass er ihm weitgehend zustimme und Fichtes Anthropologie nun erneut durchdenken, wenn nicht gar noch einmal lesen werde. Das Problem mit »mathematischen Naturforschern« wie ihm selbst sei, dass sie, wie er einräumte, so sehr damit beschäftigt seien, Hypothesen an den Tatsachen zu überprüfen, »dass wir eine vielleicht zu grosse Furcht vor einer kühneren Benutzung der wissenschaftlichen Thatsachen haben, die bei anderen Gelegenheiten doch berechtigt sein kann«. Er verwahrte sich dagegen, ein Anhänger von Moleschott und Vogt zu sein, die er beide nicht als Wissenschaftler betrachtete. Wie tiefschürfend die Entdeckungen eines Naturwissenschaftlers auch immer sein mochten, rechtfertigten sie doch nicht, irgendwelche Aussagen über die Seele zu treffen. Folglich waren freilich Ferdinands Äußerungen über die Feindseligkeit vieler Naturwissenschaftler gegenüber der Philosophie ebenso wenig gerechtfertigt – die meisten Wissenschaftler stünden ihr ohnehin »indifferent« gegenüber, so Helmholtz. Hinzu komme noch, dass die meisten Probleme zwischen Philosophen und Naturwissenschaftlern Männern wie Schelling und Hegel geschuldet seien. Auch von Lotze hielt er nicht viel. Es waren vielmehr Kant und erkenntnistheoretische Fragen, die ihn nach eigenem Bekunden interessierten. Was Schopenhauer betraf, so stimmte er mit seinem Vater überein: Was er von ihm gelesen hatte, mochte er nicht. Erst viel später, und dann auch nur mit einem kurzen, wenig wohlwollenden Seitenblick, sollte er ihn in gedruckter Form erneut erwähnen. Dieser friedliche philosophische Austausch zwischen Ferdinand und Hermann hatte sich über Jahrzehnte hinweg angebahnt und stand, wenn auch nur auf einer rationalen, intellektuellen Oberfläche, möglicherweise stellvertretend für unausgesprochene emotionale Spannungen, die ihm zugrunde lagen. In gewisser Weise trugen Vater und Sohn eine Art Materialismusstreit innerhalb der Familie aus;52 in einem anderen Sinne hatten sie kaum richtig angefangen, miteinander zu reden.
Die Physiologie der musikalischen Harmonie
Im Juni 1857 stellte Helmholtz vor der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde eine neue Erfindung vor, das »Telestereoskop«. Es handelte sich um ein verbessertes Stereoskop, das dem Betrachter (mittels Spiegeln) klarere, von ihrem räumlichen Hintergrund abgehobene Bilder von Objekten zeigte, deren Umrisse oder Oberflächen nicht flach waren (zum Beispiel Landschaften). Das Instrument war nach Helmholtz’ Dafürhalten leicht zu bauen und konnte nicht nur bei der Beobachtung von nahen und fernen Objekten seine Nützlichkeit erweisen, sondern auch als »ein amusantes optisches Spielwerk«. Eine örtliche Zeitung griff die Geschichte auf, die nun »die Runde durch die politischen Zeitungen« machte, und so musste er auf Poggendorffs Bitte hin das Ganze für die Annalen aufschreiben.53
Auch auf dem Treffen der Naturforscherversammlung in Bonn im September 1857 stellte Helmholtz seine Erfindung vor. Rund 1000 Menschen nahmen daran teil, obwohl Helmholtz den Eindruck hatte, dass »die bedeutendsten [Wissenschaftler] meist fehlten«. Er fand die Veranstaltung »wohl sehr interessant«, allerdings war sie für ihn »auch eine wahre Hetzjagd«, obschon er die meisten gesellschaftlichen Zusammenkünfte mied. Dove und Wittich quartierten sich bei Familie Helmholtz ein. Olga und er hatten Besucher nur für eine Mahlzeit (dies »machte mich für den folgenden Tag caput«) und servierten zwischen den Sitzungen reichlich Kaffee und Tee, minimierten ansonsten jedoch die Zahl ihrer Gäste. Helmholtz fürchtete, dass der schlechte Zustand seines Anatomieinstituts seinem Ansehen unter denjenigen, die es während der Tagung besuchten, schaden würde. Es war das erste Mal, dass er bei einer Zusammenkunft der Naturforscherversammlung sprach, und dies sollte sich nur noch bei vier weiteren Gelegenheiten wiederholen (1858, 1869, 1872 und 1889). Die Nützlichkeit des Telestereoskops stieß bei einer Reihe von Nutzern derweil auf gute Resonanz. So zum Beispiel bei Brücke, der ihn wissen ließ, dass das Gerät »sehr schlau« sei, oder bei Anton Danga, einem »schlichten Mann« aus der Pfalz, der schrieb, wie fasziniert er von den Bildern sei, die Helmholtz’ Telestereoskop hervorbrachte. Dessen Beitrag zur Naturforscherversammlung bestand allerdings in mehr als nur der im Plenum gehaltenen Präsentation seiner Erfindung. Er zeigte den Besuchern auch seinen Myographen für Messungen in den Nerven, hielt einen kurzen Vortrag über die Bewegungen der Gehörknöchelchen und sprach über Kombinationstöne. Er betätigte sich damit sowohl in der Sektion Anatomie (zweimal) als auch in der Sektion Physik als Referent. (Alles in allem hielt er auf dieser Tagung vier Vorträge.) Daneben diskutierte er mit anderen Teilnehmern über den Geldbedarf in der Wissenschaft – besonders mit Blick auf Summen, welche die finanziellen Ressourcen des einzelnen Wissenschaftlers überstiegen. Später erhielt er, zu seiner Überraschung, von König Maximilian II. von Bayern (scheinbar unaufgefordert) eine jährliche Summe aus genau diesem Anlass. (Der König war sehr an Helmholtz’ akustischen Studien interessiert und bat ihn im Gegenzug darum, ihm vierteljährlich einen kurzen Bericht über seine Ergebnisse zu erstatten.) Am Ende wurde er auch Prinzessin Elisabeth von Preußen als »Erfinder des Augenspiegels« vorgestellt.54
Im Winter 1857, »[i]n der Vaterstadt Beethovens, des gewaltigsten unter den Heroen der Tonkunst«, hielt Helmholtz einen öffentlichen Vortrag über die physiologischen Ursachen für musikalische Harmonie. Bei dieser Gelegenheit versuchte er zu erklären, was Physik und Physiologie zum Verständnis von Musik und musikalischen Phänomenen beitragen konnten. Er vertrat die Meinung, dass Musik, mehr als jede andere Kunst, bis dato einer wissenschaftlichen Analyse entgangen sei. Die anderen schönen Künste, die konkrete Materialien nutzten und natürliche und menschliche Objekte darstellten, seien dadurch wissenschaftlichen und ästhetischen Untersuchungen leichter zugänglich. Beides treffe auf Musik so nicht zu, weshalb ihre Effekte einigen Menschen »unbegreiflich und wunderbar« zu sein schienen. Doch auch Musik kennt Helmholtz zufolge durchaus eine Art Material, nämlich das der »Töne oder Tonempfindungen«. Während sie nämlich als »die stoffloseste, flüchtigste und zarteste Urheberin unberechenbarer und unbeschreiblicher Stimmungen« erscheine, sei sie in Wirklichkeit Gegenstand einer mathematischen Analyse, und obwohl Welten zwischen der Mathematik und der Musik zu liegen schienen, seien sie in Wahrheit miteinander verwandt: Die Mathematik könne ein Verständnis der Musik ermöglichen. Genauer gesagt versuchte Helmholtz, seinem Publikum und seinen Lesern zu erklären, wie die physikalische und die physiologische Akustik dem Verständnis von Musik dienten, wobei er den Fokus speziell auf die Ursachen für musikalische Konsonanz richtete. Er versuchte also, die moderne Wissenschaft und Mathematik zur Klärung der uralten Frage heranzuziehen, die Pythagoras und viele andere nach ihm nie zufriedenstellend hatten beantworten können: Was haben die Frequenzverhältnisse kleiner, ganzer Zahlen mit Konsonanz zu tun?55
Die Entstehung eines Tons in der Musik erklärte er aus der Wiederholung schneller, regelmäßiger Impulse in gleichen Zeitintervallen. Die Höhe des Tons sei eine Funktion der Anzahl solcher Impulse; mehr Impulse pro Zeitabschnitt resultierten in einem höheren Ton. Er hielt es dabei für völlig bedeutungslos, wie oder von welcher Art Instrument, einschließlich der menschlichen Stimme, der Ton erzeugt werde. Um die Abhängigkeit der Töne von den Frequenzverhältnissen zu demonstrieren, benutzte er eine Sirene.56
Was eine Schallschwingung zu einer Tonempfindung mache, habe, so Helmholtz weiter, mit ihrer Rezeption durch das Ohr (und nicht zum Beispiel über die Haut) und mit der Natur der Hörnerven zu tun. In erster Linie sei dies eine Sache der Physik von Wellenbewegungen, die sich durch die Luft verbreiteten. Er erklärte grundlegende Eigenschaften von Schallwellen – ihre Bewegungen und Wechselwirkungen, insbesondere das Verhältnis zwischen Wellenlänge und Tonhöhe, -stärke und -intensität: Variationen in der Form der Schallwellen verursachten Variationen in der Klangfarbe (oder dem Timbre). Er gestand ein, oft Stunden an der ostpreußischen Küste damit verbracht zu haben, das faszinierende Wellenspiel des Meeres zu beobachten. Dies, so fand er, »fesselt und erhebt den Geist, da das Auge leicht Ordnung und Gesetz darin erkennt«. Mit Blick auf das Tongeschehen und dessen Wahrnehmung sei ein Konzert- oder Tanzsaal dem Verhalten der Wellen auf dem Meer und ihrer Wahrnehmung durch den Betrachter durchaus vergleichbar. Tatsächlich sah Helmholtz Ähnlichkeiten oder sogar Analogien zwischen akustischer und optischer Wahrnehmung.57
Im Anschluss erläuterte er die relevanten anatomischen und physiologischen (einschließlich der nervlichen) Eigenschaften des Ohres und seine Funktionsweise bei der Wahrnehmung von Schallwellen. Dank eines in jüngster Zeit verbesserten Verständnisses der Anatomie und Physiologie dieses Organs war mittlerweile klar, wie das Ohr Schallwellen in ihre einzelnen Teiltöne zerlegt, ein Phänomen, das der Fourier-Analyse in der mathematischen Physik sehr ähnlich ist. Diese Zergliederung des Tons durch das Ohr lässt uns zum Beispiel auch die Unterschiede zwischen einzelnen Stimmen und Musikinstrumenten erkennen. Für Helmholtz war das Ohr damit ein mathematisches Instrument zur Analyse von Schallwellen, so wie es das Auge für optische Informationen war.58
Allerdings betonte er auch, dass die Tonempfindung nicht nur auf »das leibliche Ohr des Körpers«, sondern auch auf »das geistige Ohr des Vorstellungsvermögens« zurückzuführen sei. Das erstere funktioniere automatisch; seine Tätigkeit sei vergleichbar damit, wie ein Mathematiker eine Fourier-Analyse von Wellensystemen vornehme, und ermögliche eine Unterscheidung der einzelnen Obertöne von den Grundtönen. Dabei müsse allerdings sogar ein geschulter Hörer viel Aufmerksamkeit aufbringen, um solche Töne wahrzunehmen. Mit Blick auf das zweite, das geistige Ohr »gehört noch eine eigenthümliche Thätigkeit der Seele dazu, um von der Empfindung des Nerven aus zu der Vorstellung desjenigen äusseren Objectes zu gelangen, welches die Empfindung erregt hat«. Hiermit rekurrierte Helmholtz auf seine epistemologische Zeichentheorie, nach der uns die sinnlichen Wahrnehmungen nur Zeichen dafür geben, dass äußere Objekte vorhanden sind. Die Erfahrung ist es dann, die uns allmählich die Schlussfolgerung lehrt, dass solche innerlichen, geistigen Zeichen Indikatoren für das Vorhandensein bestimmter äußerer, materieller Objekte sind. Unsere Wahrnehmungen hingen damit, wie Helmholtz behauptet, von der praktischen Erfahrung ab. Wir nehmen Obertöne nur selten bewusst wahr, und unsere Seele sei ebenso gefordert wie die Hörnerven, damit wir uns ihrer bewusst werden.59
Die oberen Teiltöne erzeugen nach Helmholtz die Klangfarbe, die von der Wellenform abhängt. Die von Uhren erzeugten Obertöne seien noch am einfachsten zu hören. Helmholtz hob hervor, dass die oberen Teiltöne, obgleich nicht leicht hörbar, eine »wichtige Rolle […] bei der künstlerischen Wirkung der Musik« spielten. Seine Erfindung des Helmholtz-Resonators (unter welchem Namen dieses Instrument seither bekannt ist), einer Glas- oder Metallkugel mit zwei einander entgegengesetzten Öffnungen, von denen eine zur Schallquelle und die andere zum Ohreingang hin gerichtet wird, schuf eine Möglichkeit, die oberen Teiltöne hörend zu erfassen.60
Anschließend erläuterte Helmholtz das Phänomen musikalischer Schwebungen als Überlagerung zweier Sinuswellen. Schwebungen, die schnell genug auftreten, sind (für das Ohr) nicht mehr voneinander unterscheidbar und erzeugen das, was er »eine continuirliche Tonempfindung« nannte. Solche Schwebungen stehen Helmholtz zufolge in einem Kontrast zu Empfindungen, die diskontinuierlich sind und somit ein Gefühl der Dissonanz erzeugen. Darüber hinaus könne die Überlagerung zweier lauter Töne das Hören weiterer Töne, sogenannter Kombinationstöne, hervorrufen.61
Im Lichte dieser Erklärungen suchte Helmholtz die Unterscheidung zwischen Harmonie und Disharmonie darin, »dass in der ersteren die Töne neben einander so gleichmässig abfliessen, wie jeder einzelne Ton für sich, während in der Disharmonie Unverträglichkeit stattfindet, und die Töne sich gegenseitig in einzelne Stösse zertheilen«. Musikalische Schwebungen hängen für ihn von der Interferenz von Wellenbewegungen ab, was bedeutet, dass Klang eine Wellenbewegung ist. Das Ohr ist dank seiner Fähigkeit zur Fourier-Analyse in der Lage, die Obertöne zu unterscheiden und zusammengesetzte Wellensysteme zu zerlegen; tatsächlich hilft der Fourier’sche Satz dabei, die relativen Amplituden der Teiltöne zu bestimmen. In all dem erkennen wir, wie er schlussfolgerte, eine starke Ähnlichkeit zwischen Ohr und Auge. Auch Licht ist ein Wellenphänomen und weist daher Interferenzeigenschaften auf, wobei seine verschiedenen Frequenzen die verschiedenen vom Auge wahrgenommenen Farben erzeugen. Jedoch kann das Auge keine zusammengesetzten Farben unterscheiden, was bedeutet, dass es »keine Harmonie in dem Sinne [hat] wie das Ohr; es hat keine Musik«.62
All diesen anatomischen, physiologischen, physikalischen und mathematischen Analysen zum Trotz behauptete Helmholtz am Schluss: »Die Aesthetik sucht das Wesen des künstlerisch Schönen in seiner unbewussten Vernunftmässigkeit.« Die Obertöne seien zwar für das musikalische Erlebnis wesentlich und hingen von der Verarbeitung der Wellen durch das Ohr ab, doch diese Verarbeitung geschehe auf einer unbewussten Ebene. Helmholtz zufolge ist musikalische Schönheit, also Harmonie und Disharmonie, eine graduelle Angelegenheit – etwas, das eine kontinuierliche Skala der Schönheit von der niedrigsten sinnlichen bis hin zur höchsten intellektuellen Befriedigung durchlaufe. Wie im Meer gebe es Strömungen auch in der Seele des Künstlers, die, obgleich der Künstler selbst sie nicht erklären könne, ihn geistig mit ähnlichen Strömungen »in der Seele des Hörers [verbinden], um ihn endlich in den Frieden ewiger Schönheit emporzutragen, zu dessen Verkündern unter den Menschen die Gottheit nur wenige ihrer erwählten Lieblinge geweiht hat«. An diesem Punkt stoße, so schloss Helmholtz, die Naturwissenschaft allerdings an ihre Grenzen.63 Und an dieser Stelle zeigten sich zugleich Helmholtz’ eigene romantische Anflüge.
Helmholtz gründete seine Theorie der musikalischen Harmonie auf die Anatomie des Ohres und die Physik der Schallwellen, so wie er seine Theorie der visuellen Wahrnehmung auf die Anatomie und Physiologie des Auges und die damit zusammenhängende Physik der Lichtwellen stützte. Dennoch »reduzierte« er seine Theorien des Hörens und Sehens nicht auf solche körperlichen und physikalischen Phänomene, denn er hielt stets an der Überzeugung fest, dass es in der auditiven und visuellen Wahrnehmung eine psychologische Komponente gebe, die er vage als Teil der »Seele« oder des schöpferischen Geistes im Menschen bezeichnete. Natürlich war dieses Element selbst auch eine Funktion des menschlichen Verhaltens und Erlebens über lange Zeiträume hinweg. Doch Helmholtz glaubte nie, dass die »harten« Wissenschaften der Anatomie, Physiologie und Physik die visuelle und auditive Wahrnehmung des Menschen vollständig erklären könnten.
Wasser in Bewegung
Im November 1857 baten die Herausgeber der Illustrirten Deutschen Monats-Hefte Helmholtz um einen populärwissenschaftlichen Aufsatz zur Veröffentlichung in ihrer Zeitschrift. Er hatte jedoch keinen, den er hätte schicken können. »Meine Zeit ist so besetzt, daß ich nicht besondere Arbeiten für populäre Zwecke übernehmen kann, sollte ich gelegentlich einmal dazu kommen einen populären Aufsatz zu schreiben, welcher mir für die Deutschen Monatshefte passend erscheint, was wohl leicht einmal vorkommen kann, so werde ich ihn Ihnen zuschicken.« Zur gleichen Zeit schrieb ihm auch Rudolf Haym, der Gründungsherausgeber (1858 – 1864) der Preußischen Jahrbücher, darüber, welche Art von Artikeln er für seine neue Zeitschrift von ihm gerne erhalten würde. Dazu gehörten Beiträge über Wissenschaftsgeschichte, die praktische Anwendung von Wissenschaft und über Entwicklungen auf den neuesten wissenschaftlichen Gebieten, speziell dann, wenn sie mit übergeordneten Fragen wie dem »Bildungsleben der Nation u.s.w.u.s.w.« zu tun hätten. Haym ging davon aus, dass Helmholtz verstand, wovon er sprach, da er solcherart Beiträge bereits verfasst habe, von denen Haym einige gelesen hatte, und fuhr fort:
Ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn ich die Jahrbücher bald einmal mit einem Aufsatz wie der über Göthe’s Stellung zu den Naturwissenschaften geziert sehen könnte. Ich kann kaum anders glauben, als dass auch Ihnen ein solches Miteingreifen der Naturwissenschaft in den sittlichen Bildungsprozess der Nation – denn darum handelt es sich bei unserer Zeitschrift – am Herzen liegen müsste. Weisen Sie die Hand, die Ihnen hier von einer Seite geboten wird, welche sonst eher geneigt ist, die Naturwissenschaften ganz zu ignorieren, nicht zurück. Helfen Sie mit, dass der Dualismus nicht noch weiter um sich greife, der in einer Zeit, wo die Philosophie machtlos geworden ist, so natürlich sich einstellt, der Dualismus der historischen u. der physischen Wissenschaften.
Haym bat Helmholtz außerdem darum, ihm Namen von Kollegen aus der Naturwissenschaft zu nennen, die für die Jahrbücher schreiben könnten. Insbesondere fragte er an, ob Helmholtz ihm jemanden empfehlen könne, der für eine Biographie und Würdigung Humboldts infrage käme. Helmholtz willigte zu jenem Zeitpunkt nicht darin ein, selbst einen Artikel zu schreiben (wie er es später tun sollte), schickte Haym allerdings mehrere Namen zu. Dieser sah sich nun in einer »Allianz« mit Helmholtz, »deren Abschluss diejenige Generation erleben wird, welche sich eines freieren Staats- u. eines gesünderen Nationallebens erfreuen wird als die unsrige«.64
Statt über populärwissenschaftliche Aufsätze nachzudenken, beschäftigte sich Helmholtz, zumindest 1857, intensiv mit der wissenschaftlichen Analyse der Wasserströmung. Was er im folgenden Jahr veröffentlichte, sollte zu einem der grundlegenden Beiträge und Theoreme zur Erforschung dieses Gegenstands (und anderer physikalischer und mathematischer Phänomene) werden. Schon seit der Renaissance, aber besonders seit dem Werk von Daniel Bernoulli aus der Mitte des 18. Jahrhunderts sowie den Arbeiten einer Reihe von britischen und französischen Naturphilosophen und Ingenieuren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, umfasste das Thema Flüssigkeitsbewegung sowohl die Hydrodynamik als auch die Hydraulik; es bezeichnete also das Ideelle wie auch das Praktische, die mathematische Analyse wie auch die Gewinnung empirischer Daten und Formeln, mit oder ohne Theoriebildung. Helmholtz fügte sich nun in diese Tradition ein und stärkte sie von Neuem.65
Seine Arbeiten zur Hydrodynamik und der Ort ihrer Veröffentlichung sind zugleich überraschend und nicht überraschend. Um dies zu verstehen, muss man weit über den hochgradig mathematischen und physikalischen Gehalt seines epochalen Aufsatzes von 1858 hinausblicken und sich seiner kulturellen und persönlichen Bedeutung zuwenden. Was den nicht überraschenden Aspekt angeht, so wollte Helmholtz, wie erinnerlich, schon immer Physik betreiben. Und Mitte der 1850er-Jahre hatte er in der eigentlichen Physiologie professionell so viel erreicht, dass er sich nun mehr Zeit für rein physikalische Themen nehmen konnte. Dennoch ging sein Papier zur Hydrodynamik von 1858 – so hoch mathematisch und technisch, wie es war – aus seinen jüngsten Arbeiten zur physiologischen Akustik hervor. Allgemein begann sich seine wissenschaftliche Ausrichtung ohnehin bereits zu verschieben, und diese Publikation zeichnete ihn noch mehr als Physiker und zum ersten Mal auch als Mathematiker aus.
Ebenso wichtig ist möglicherweise, dass Helmholtz sich schon immer gerne am Wasser aufhielt und von Wellenbildungen fasziniert war. Wie bereits erwähnt, liebte er es, die Flüsse, die Seen und das Meer in und um Potsdam, Berlin, Königsberg und Bonn zu betrachten; dasselbe galt später in Heidelberg für den Neckar. Auch die Flüsse Schottlands hatten ihm sehr gut gefallen. Wasser gab ihm, wie die Berge auch, das Gefühl, Teil der Natur zu sein, und hatte eine heilsame psychologische Wirkung auf ihn:
Namentlich bietet das bewegte Wasser, sei es in Wasserfällen, sei es im Wogen des Meeres, das Beispiel eines Eindrucks, der einem musikalischen einigermassen ähnlich ist. Wie lange und wie oft kann man am Ufer sitzen und den anlaufenden Wogen zusehen! Ihre rhythmische Bewegung, welche doch im Einzelnen fortdauernden Wechsel zeigt, bringt ein eigenthümliches Gefühl von behaglicher Ruhe ohne Langeweile hervor, und den Eindruck eines mächtigen, aber geordneten und schon gegliederten Lebens. Wenn die See ruhig und glatt ist, kann man sich eine Weile an ihren Farben freuen, aber sie gewährt keine so dauernde Unterhaltung, als wenn sie wogt. Kleine Wellen dagegen auf kleineren Wasserflächen folgen sich zu hastig und beunruhigen mehr, als dass sie unterhalten.
Und wiederum im Zusammenhang mit Wasseroberflächen und ihren mannigfaltigen Wellenformationen notierte er: »Ich muss gestehen, dass mir dieses Schauspiel, so oft ich es aufmerksam verfolgt habe, eine eigenthümliche Art intellectuellen Vergnügens gemacht hat, weil hier vor dem körperlichen Auge erschlossen ist, was für die Wellen des unsichtbaren Luftmeers nur das geistige Auge des Verstandes durch eine lange Reihe complicirter Schlüsse sich deutlich machen kann.«66 Ebenfalls erwähnenswert ist, dass sein Artikel von 1858 mit seinem anhaltenden, intensiven Interesse an der Musik, das heißt mit der Physik der Schallwellen, in Zusammenhang stand.