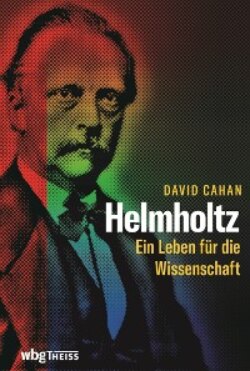Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Unentdeckt Unterarzt an der Charité
ОглавлениеMit 21 Jahren war Helmholtz bereits Arzt, genauer Physiologe, und zudem ein Mann von Bildung, der sich an den schönen Künsten erfreute. Anfang Oktober 1842 zog er aus seinem alten Zimmer in ein Quartier der Charité.1 Die nächsten sieben Jahre sollte er in Berlin oder Potsdam wohnen bleiben, dort die Grundlagen für sein wissenschaftliches Werk legen und sich verlieben.
Obwohl die Charité die älteste medizinische Ausbildungsstätte Preußens war (gegründet 1710), waren ihre Räumlichkeiten gerade erst wiedererrichtet worden, was sie zu einem modernen Lehrkrankenhaus machte (vgl. Abb. 4.1). Sie bot für Arme eine kostenfreie Versorgung an, wodurch es ihre behandelnden Ärzte mit ganz verschiedenartigen Patienten und einer großen Bandbreite an medizinischen Fällen zu tun hatten. Die Charité verfügte über Kliniken für Innere Medizin, Allgemeinmedizin, Klinische Chirurgie, Augenheilkunde, Geburtshilfe, Pädiatrie, Syphilis und Psychiatrie. Die frisch gebackenen Unterärzte erhielten Unterricht am Krankenbett, während sie im Laufe eines Jahres von einer Klinik zur anderen wechselten.2
Nach einer Woche in seiner ersten Klinik behandelte Helmholtz bereits Patienten, verschrieb Medikamente, führte Obduktionen durch, übernahm Dokumentationsaufgaben und Ähnliches. Er stellte fest, dass die meisten Patienten unheilbare (und damit langweilige) Krankheiten hatten, gegen die er nur Opium verschreiben konnte, und klagte darüber, dass die wenige freie Zeit, die ihm blieb – er arbeitete von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends –, so knapp und unregelmäßig war, dass er damit nicht wirklich etwas anfangen konnte. Trotzdem fand er Zeit für das gesellschaftliche und kulturelle Leben: Er besuchte die Bernuths, seinen Freund, den Maler Theodor Rabe, und eine Kunstausstellung, wo er den »fürchterlichste[n] Schund in Massen und sehr wenig Gutes« sah, obgleich er sich vom Werk des Historien- und Landschaftsmalers Carl Friedrich Lessing beeindruckt zeigte. Lessings Johann Hus zu Konstanz, ein antikatholisches Gemälde, hielt er für das beste Exponat, das er je in Berlin gesehen hatte, und er drängte seine Eltern mit Nachdruck dazu, es sich anzusehen. Außerdem besuchte er einen Ball und eine Aufführung von Christoph Willibald Glucks Iphigenie auf Tauris.3
Abb. 4.1:Die Charité, Berlin. Bildarchiv, Institut für Geschichte der Medizin, Freie Universität Berlin.
Als seine Mutter ihn an Weihnachten jenes Jahres sah, war sie schockiert von seinem Erscheinungsbild – beide Eltern vermuteten dahinter eine unheilvolle Liebesaffäre – und ermahnte ihn behutsam dazu, mehr auf seine Kleidung zu achten. Er versprach, dies zu tun und sich geselliger zu geben. Zu seiner Verteidigung führte er an, dass seine Pflichten seine Zeit und Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch genommen hätten, dass er in Berlin praktisch niemanden getroffen und deshalb vergessen habe, seine schmutzige Kleidung nach Hause zu schicken, damit seine Mutter sie waschen konnte. Der Februar brachte schließlich Erleichterung, weil er in die Kinderklinik wechselte, wo er nur wenig zu tun hatte. Er pflegte nun mehr Kontakte – er wohnte einem Ball bei den Rabes, einer Sinfonie und einem Quartett bei und besuchte Freunde – und hoffte, dass dieses Treiben die Sorgen seiner Eltern lindern würde.4
Als seine Mutter schwer erkrankte und seine Pflichten im Krankenhaus ihm keinen Besuch erlaubten, bat er seinen Vater um Nachrichten über ihren Zustand, gab medizinische Ratschläge und machte sich Sorgen um sie. Als er sie schließlich doch besuchte, war er »äußerst erschreckt« und deprimiert. »Da ist freilich Menschenhülfe zu Ende«, wie er seinem Vater schrieb. Zwar war er sich über den Ausgang ihrer Erkrankung völlig im Ungewissen, fürchtete aber das Schlimmste. Ihr Zustand brachte ihn sogar dazu, von einer übernatürlichen, höheren Macht zu sprechen, was selten genug geschah: »Wir müssen die Entscheidung einem höheren Wesen anheim stellen, und uns mit Dank oder Ergebung in seinen Beschluß zu finden wissen.« Helmholtz sehnte sich danach, seine Mutter zu sehen, und dankte seinen Geschwistern für die Liebe, die sie ihr entgegenbrachten. Die Mutter erholte sich ein wenig, und an ihrem Geburtstag schrieb er ihr: » [S]o sollte ganz Potsdam Dir zu einem Elysium werden.«5 Helmholtz liebte sie zutiefst.
Im Frühjahr 1843 begannen Helmholtz und seine Familie, sich um eine Anstellung zu bemühen, die ihn in der Funktion eines Allgemeinarztes beim Königlichen Garde-Husaren-Regiment zurück nach Potsdam bringen sollte. Er sprach mit Johann Karl Jakob Lohmeyer, dem Generalarzt der Armee, der ihn »sehr freundlich« empfing. Dieser ahnte bereits, dass sich demnächst die Chance auf eine Position beim Regiment eröffnen würde, und sagte, dass Helmholtz die Stelle im Prinzip haben könne, da er nur »die besten Zeugnisse« über seine Arbeit vernommen habe. Lohmeyer erwartete zudem, dass auch Wilhelm Puhlmann, der langjährige Arzt des Regiments und ein alter Freund der Familie, ihn haben wollte. Puhlmann hatte Einfluss, und Helmholtz bat seine Mutter, mit ihm zu sprechen. Im Juli beschied ihm Lohmeyer, in dessen Macht es stand, den »Wunsch« der Familie zu erfüllen, er müsse nur sagen, was er wolle, und werde es bekommen. Die Beziehungen der Familie erwiesen sich auch noch auf eine andere Weise als nützlich: Helmholtz stand kurz davor, die Ergebnisse seiner Gärungsexperimente niederzuschreiben, und wollte davor unbedingt Mitscherlichs neuesten Artikel zu diesem Thema sehen. Also bat er seinen Vater, er möge bei seinem früheren Gymnasiallehrer Meyer nach einer Kopie anfragen; sollte das nicht klappen, wollte er selbst kommen und Meyer aufsuchen, um mit ihm über Mitscherlichs Befunde zu diskutieren.6
Ende September schloss er seine letzte Klinik ab. Späteren Bemerkungen nach zu urteilen war er zwar mit der Qualität der Ausbildung, die er erhalten hatte, mehr als zufrieden, doch störte ihn der Widerstand mancher Mediziner gegen die Verwendung mechanischer Instrumente für klinische Zwecke. Die meisten Ärzte begnügten sich damit, den Puls mittels einer Uhr mit Sekundenzeiger zu messen, mit einem Stethoskop abzuhören und Körperteile abzuklopfen. Niemand zog es auch nur in Betracht, die Temperatur eines Patienten zu nehmen. Diese und ähnliche unwissenschaftliche Einstellungen fand er erbärmlich. Am 1. Oktober 1843 wurde er zum Assistenzarzt befördert und trat als Armeearzt und Chirurg in den aktiven Militärdienst ein, wo er Puhlmann bei den Garde-Husaren zugeteilt wurde.7
Als »Postdoc« bei den Husaren
Das Husarenregiment hatte seine ziemlich neue Kaserne in der Neuen Königstraße (später Berliner Straße), und Helmholtz zog dort ein (vgl. Abb. 4.2). Jeden Tag um fünf Uhr morgens ertönte das Signalhorn und rief ihn aus dem Bett. Doch hatten die Husaren, ebenso wie die gesamte preußische Armee, in den friedlichen Jahren von 1815 bis 1864 (abgesehen von den Jahren 1848/49) wenig zu tun. Es gab daher keine Verwundeten und nur wenige kranke Soldaten, die es zu behandeln galt, und so konnte Helmholtz nur wenig an praktischer medizinischer Erfahrung sammeln. Und obgleich ihn die höheren Offiziere »sehr geringschätzig« behandelten, ließ ihm seine Stellung doch viel freie Zeit für wissenschaftliche Forschung, und seine Kaserne bot genügend Platz, um dort ein kleines Labor einzurichten. Tatsächlich war ihm für seine wissenschaftliche Arbeit eine staatliche Unterstützung bewilligt worden – praktisch eine Art Postdoc-Stelle –, auch wenn er (wie schon als Unterarzt) nur 210 Taler pro Jahr verdiente.8
Abb. 4.2:Die Kaserne der Königlichen Garde-Husaren in Potsdam. Hans Kania, Potsdam. Staats- und Bürgerbauten (Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1939), S. 115.
Helmholtz holte in seinen Potsdamer Jahren im Militärdienst (1843 – 1848) das Beste aus diesen günstigen Umständen heraus, indem er Forschung betrieb und eine Reihe von Artikeln zu physiologischen und physikalischen Themen veröffentlichte. In den ersten zwei Jahren arbeitete er in seinem Armeequartier allein und hatte, abgesehen von du Bois-Reymond, der ihn dort besuchte, und Müller wenig bis gar keinen Kontakt zu Berliner Wissenschaftlern. In seiner ersten Veröffentlichung berichtete er über seine Befunde zu Fäulnis und Gärung, eine Forschungsarbeit, mit der er schon als Unterarzt in Berlin begonnen hatte. Dieser Gegenstand reihte sich in eine damals gerade aktuelle, breit geführte Auseinandersetzung unter Chemikern, Physiologen und anderen ein, die auf unterschiedliche Weise mit dem Gegensatz von Vitalismus und Reduktionismus, den Beziehungen zwischen organischen und anorganischen Phänomenen und den Ursprüngen des Lebens befasst waren. Seine eigene Position verdankte sich in weiten Teilen den jüngsten Arbeiten von Schwann, Mitscherlich und Justus von Liebig. Physiologen und Chemiker stritten sich, wie er feststellte, über die Ursachen für die Zersetzung organischer Körper (d. h. Gärung und Fäulnis), und viele der »grössten Chemiker« tadelte er dafür, dass sie die Tatsachen ignorierten und sie als »physiologische Phantasien« betrachteten. (Liebig dachte, dass die Zersetzung in ihrem Ursprung aus den Bewegungen der Atome entstand, also chemischer Natur war, während Schwann Mikroorganismen für sie verantwortlich machte.) Helmholtz machte deutlich, was das Mikroskop und das Experiment in diesem Zusammenhang zu enthüllen vermochten, und sein Thema wie sein Ansatz weisen auf den Einfluss von Mitscherlich und Müller hin (er publizierte in Müllers Archiv). Doch seine Schlussfolgerungen über die Zersetzung waren uneindeutig: Es handele sich dabei nicht nur um ein chemisches Phänomen, wie er befand, sondern um eines, das unabhängig von Lebensphänomenen auftreten und trotzdem die Grundlage des Lebens bilden könne. Auch wenn er also vielleicht zur Klärung der Diskussion um die Zersetzung beigetragen hat, so hat er sie oder das Problem der Spontanzeugung doch gewiss nicht gelöst. (Liebigs chemische Erklärung hatte Bestand, bis Louis Pasteur sie Mitte der 1860er-Jahre mit seiner mikroorganischen Erklärung klar widerlegte.) Immerhin baute Helmholtz durch diese Untersuchungen seine experimentellen Fähigkeiten aus und stand mit seiner Haltung in einem festen Gegensatz zu Liebig, dem führenden Chemiker Deutschlands. Beide begegneten einander höflich und respektvoll, entwickelten aber nie eine enge Beziehung.9
In den Jahren 1843 bis 1845 wandte sich Helmholtz direkt der Frage nach der Rolle einer »Lebenskraft« in der Physiologie zu: Entsprang das organische Leben aus einer ihm selbst innewohnenden Kraft, oder ging es aus anorganischen Phänomenen hervor? Die Frage, wie Helmholtz sie im Anschluss an Liebig formulierte, war zum Teil die, »ob die mechanische Kraft und die in den Organismen erzeugte Wärme aus dem Stoffwechsel vollständig herzuleiten seien, oder nicht«. Er versuchte herauszufinden, ob bei der Erzeugung mechanischer Effekte chemische Reaktionen auftreten, und benutzte Frösche – »die alten Märtyrer der Wissenschaft« – als Versuchstiere, indem er sie elektrisch stimulierte, um zu zeigen, dass bei der Muskelkontraktion eine chemische Umwandlung stattfand. Seine Ergebnisse hielt er allerdings für vorläufig und meinte, er habe gewiss nicht gezeigt, dass der Stoffwechsel Muskelkraft und Muskelwärme verursacht, geschweige denn die große Frage nach der Lebenskraft in der Physiologie beantwortet. Dennoch wurde seine Untersuchung über chemische Veränderungen in den Muskeln bahnbrechend, setzte sie doch gleichsam den Startpunkt für eine Studie über den Redoxprozess in den Muskeln, die andere über vierzig Jahre hinweg durchführten. Seine Untersuchung des muskulären Stoffwechsels (und die damit verknüpften Analysen der physiologischen Wärme) bereitete zudem den Boden für seine eigenen theoretischen Arbeiten über die Krafterhaltung. Am Ende zeigte sich – auf recht paradoxe Weise –, dass er im selben Moment, in dem er den Gebrauch der Instrumente, die quantitativen Methoden und präzisen Messungen in der Physiologie meisterte, auch die Begrenzungen der beiden Letzteren zu erkennen begann.10
Das medizinische Staatsexamen
Ende September 1845 schloss Helmholtz einen langen Literaturbericht über physiologische Wärme für ein enzyklopädisches medizinisches Nachschlagewerk ab, das von der medizinischen Fakultät der Berliner Universität veröffentlicht wurde (auch hier deutet der Ort auf eine Beteiligung Müllers hin). Er unterzog Dutzende von Studien einer kritischen Durchsicht, die sich mit Temperaturmessungen bei Tieren befassten, darunter auch solche über den Ursprung der tierischen Wärme, und schätzte das methodische Vorgehen der meisten davon als dürftig ein. Dabei legte er ein besonderes Interesse an der physikalischen Natur der Wärme selbst an den Tag und drückte seinen Unglauben an eine »Lebenskraft« aus (da dieser Begriff »allen logischen Gesetzen der mechanischen Naturwissenschaften widerspricht«), obgleich er einräumte, dass er den Physiologen keine Alternative anbieten konnte.11
Im Oktober 1845 dann gewährte ihm sein Regiment die Erlaubnis, sich auf sein medizinisches Staatsexamen vorzubereiten und es abzulegen. Offiziell wurde er jetzt ein »attachirter Chirurg«12 des Friedrich-Wilhelm-Instituts in Berlin, lebte mit einem Freund in einer »ganz freundliche[n] kleine[n] Stube« und aß im Café Belvedere neben der Oper »ganz gut und reichlich«.13 Inoffiziell wurde er ein Forscher im Privatlabor des Physikers und Chemikers Gustav Magnus.
Der Examensablauf umfasste sowohl klinische als auch theoretische Prüfungen und dauerte vier bis sechs Monate. Er stellte hohe Anforderungen an die zeitlichen und finanziellen Ressourcen des Prüflings und verursachte bei Helmholtz die üblichen Ängste vor dem Durchfallen. Die Prüfung oblag einer Berliner Kommission, deren Mitglieder mehrheitlich der medizinischen Fakultät der Universität angehörten. Helmholtz kannte einige von ihnen recht gut. Das eigentliche Examen bestand aus fünf Teilen: Anatomie, Operationstechnik, klinischer Chirurgie (eine einwöchige Prüfung, die pathologische, therapeutische und operative Fragen umfasste, wobei gute Leistungen auf letzterem Gebiet dem Examenskandidaten den Titel »Operateur« einbrachten), klinischer Medizin (eine 14- bis 21-tägige Untersuchung zweier Patienten an der Charité, absolviert in lateinischer Sprache) und einer mündlichen Abschlussprüfung über alle Gebiete der Medizin.14
Das Verfahren begann mit einer Vorprüfung, die der Kandidat bestehen musste, um zu den eigentlichen Examensprüfungen zugelassen zu werden. Der Prüfling wurde in den Hauptfachrichtungen der Medizin geprüft und musste den Nachweis erbringen, dass er einen klinisch-praktischen Kurs besucht hatte. Im Rahmen dieser Vorprüfung besuchte Helmholtz auch Vorlesungen. Ende Oktober berichtete er an seine besorgten Eltern, dass er eine über zwei Tage laufende anspruchsvolle Anatomieprüfung erfolgreich absolviert habe. Um sich zu erholen, sah er eine »großartige Aufführung« von Friedrich Schneiders Weltgericht, nahm an einer Gesellschaft bei einem ehemaligen Zimmergenossen teil und verbrachte einen Abend bei den Hamanns. Die Vorprüfungen sollten noch weitere zehn Tage dauern. Anschließend wollte er einen Ball in Potsdam besuchen.15
Auch die klinischen Prüfungen verliefen gut. Für eine davon wurden jedem Kandidaten vier Patienten der Charité zugeteilt, für die sie vor den Prüfern eine Diagnose stellen mussten. Die Prüflinge erhielten in der Regel eindeutige Fälle, doch einer von Helmholtz’ Fällen erwies sich als »ziemlich kniffeliger Natur«, sodass selbst die Prüfer unsicher waren. Er wartete auf ihr Urteil und freute sich darauf, seine Familie an Weihnachten zu sehen. Ende Januar 1846 erfuhr er inoffiziell, dass er die klinischen Prüfungen bestanden hatte. Er hatte sich freilich eine »Fluth« von Informationen zur Verabreichung von Medikamenten angeeignet, wie er an Ferdinand berichtete, »wobei mir unsere Mnemotechnik gute Dienste geleistet hat«. Dennoch war er sich keineswegs sicher, dass er bestanden hatte; es war überhaupt nicht außergewöhnlich, dass ein Kandidat das medizinische Staatsexamen nicht bestand. Tatsächlich bestand er die Prüfungen zum Arzt und Chirurgen mit der Note »sehr gut«, erhielt aber nicht den Titel »Operateur«, was darauf hindeutet, dass es ihm möglicherweise an ausreichendem handwerklichen Geschick mangelte. Dennoch war er nun ein zugelassener Arzt.16
Ein Netzwerk von Unterstützern
Heinrich Gustav Magnus stand um die Jahrhundertmitte im Zentrum der Berliner Wissenschaft. Er war nicht nur Chemiker und Physiker, sondern interessierte sich auch sehr für angewandte Wissenschaften und die Förderung der Wirtschaft. Zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Karriere hatte er an der Universität die Titel »Professor für Chemie«, »Professor für Experimentalphysik« und »Professor für Technik« inne. Seine Vorlieben und sein Können basierten auf seiner Präzision und seiner experimentellen Arbeit. 1843 rief er an der Universität das Physikalische Kolloquium ins Leben und nutzte sein eigenes Geld und seine organisatorischen Fähigkeiten, um in seinem Haus (neben der Universität) ein privates Physiklabor einzurichten und zu unterhalten. Vielversprechende jüngere Wissenschaftler lud er dazu ein, dort seine exzellente Instrumentensammlung für ihre Forschung zu nutzen.17
Es ist kaum verwunderlich, dass sich Helmholtz und Magnus kennenlernten. Magnus war Müllers Nachbar, Freund und Kollege, und Magnus’ Bruder Eduard war ein bekannter Maler und mit Puhlmann befreundet. Außerdem kannte Magnus wahrscheinlich Helmholtz’ Schrift über die Gärung, ein Thema, das ihn sehr interessierte. Etwa drei Monate lang arbeitete Helmholtz auf Einladung von Magnus »fast täglich« in dessen Labor. Seine dort durchgeführten Gärungsexperimente verliefen erfolgreich, sodass er einige neue Untersuchungen zu diesem Thema anfing. Statt also sofort zu seinem Regiment zurückzukehren, blieb er für zwei Wochen in Berlin, um seine experimentelle Arbeit in Magnus’ Laboratorium auszubauen und »für meine ferneren Untersuchungen noch einiges zu studieren, wozu mir in Potsdam die Bücher nicht zur Hand sind«.18
Helmholtz lernte auch mehrere andere junge Wissenschaftler um Magnus kennen, darunter du Bois-Reymond, Brücke, Wilhelm von Beetz, Gustav Karsten, Carl Hermann Knoblauch und Wilhelm Heintz. Im Januar 1845 gründeten diese die Physikalische Gesellschaft zu Berlin, die (wenn auch nur indirekt) aus Magnus’ Kolloquium hervorging. Magnus selbst trat ihr allerdings nicht bei. Diese frühe Gesellschaft umwehte ein nichtakademischer, geistig progressiver und reformerischer Hauch. Ihr Name war zudem ein wenig irreführend, da zu ihren Gründern und ersten Mitgliedern nicht nur Physiker, sondern auch Chemiker, Physiologen, Mediziner, Astronomen, Instrumentenbauer, Ingenieure und diverse Armeeoffiziere gehörten. Sie diskutierten und präsentierten neue physikalische Forschungsergebnisse, betonten aber auch die physikalischen Grundlagen anderer Disziplinen (z. B. der Physiologie) und setzten die Physik zu anderen Wissenschaften ins Verhältnis; die Gesellschaft war mithin von ihrem Charakter, wenn nicht gar von ihrer Sichtweise her »interdisziplinär« geprägt. Zuerst gehörten ihr nur jüngere Berliner Wissenschaftler an; viele von ihnen wünschten sich akademische, wirtschaftliche und politische Reformen in Preußen und nahmen an, dass Wissenschaft und Technik in der künftigen politischen Ökonomie Deutschlands eine wichtige Rolle spielen würden. Die Gesellschaft traf sich vierzehntägig freitagabends im Kadettenhaus, und mit du Bois-Reymond als ihrem Vorsitzenden zog sie oft dreißig oder mehr Mitglieder pro Sitzung an. Mit der Zeit stießen Physiker wie Rudolph Clausius, Gustav Robert Kirchhoff und Gustav Wiedemann sowie der Physiktechniker und angehende Industrielle Werner Siemens hinzu. Helmholtz wurde Ende 1845 Mitglied, hielt bis 1850 zu drei Anlässen Vorträge vor der Gesellschaft und steuerte drei Übersichtsartikel (über die physiologische Theorie der Wärme) zu ihrer Zeitschrift, den Fortschritten der Physik, bei. Die Zeitschrift wurde von Karsten herausgegeben und widmete sich der Besprechung von Schriften aus der physikalischen (und verwandten) Literatur; diese Publikation und die Ausrichtung von Versammlungen waren die wichtigsten Ziele der Gesellschaft. Die Fortschritte wurden bald für alle Physiker unentbehrlich, blieben allerdings ebenso bald erst ein, dann mehrere Jahre hinter ihrem geplanten Erscheinungstermin zurück. Dennoch stellten die Gesellschaft, ihre Mitglieder und ihre Zeitschrift Helmholtz’ ersten nachhaltigen Kontakt mit Physikern dar. So studierte er zum Beispiel gemeinsam mit Wiedemann mathematische Physik, wobei er sich besonders auf Carl Friedrich Gauß’ Untersuchungen zum Magnetismus und die Elastizitätslehre von Siméon Denis Poisson konzentrierte.19
Helmholtz nahm an den Treffen der Gesellschaft teil, und du Bois-Reymond stellte ihn bei diesen Gelegenheiten allseits vor. Mit ihm und Brücke verband ihn bald eine enge Freundschaft. Brücke kannte er bereits seit 1841; mittlerweile diente er (von 1843 bis 1846) als Assistent Müllers am Anatomischen Museum, bis er Dozent für Anatomie an der Akademie der Künste wurde. Du Bois-Reymond und Helmholtz lernten sich im Dezember 1845 kennen: Als du Bois-Reymond vor physikalischen Problemen stand, ging er auf Pilgerfahrt zu Helmholtz in dessen Kaserne, »um bei ihm Rath zu holen«. Helmholtz selbst war in Mathematik und Physik (jenseits von Grundkenntnissen) ein Autodidakt. Sein Bruder Otto berichtete einmal, dass Helmholtz während seiner Dienstzeit in Potsdam manchmal bei seinen Eltern zu Hause zu Mittag aß. Danach habe er auf dem Sofa gelegen und einen mathematischen Text gelesen, zum Beispiel über Jacobis Theorie der elliptischen Funktionen. Diese Beobachtung legt nahe, dass Helmholtz bereits als junger Mann seine eigenen Studien zu anspruchsvollen mathematischen Themen trieb, besonders zu solchen, die – wie es für Jacobi gilt – für die Mechanik und andere Bereiche der Physik von großer Bedeutung waren. Du Bois-Reymond schrieb über seine frühen Eindrücke von Helmholtz an einen Freund: »Helmholtz’ Bekanntschaft ist mir inzwischen zuteil geworden und hat mir in der Tat viel Freude gemacht. Dies ist (sauf la modestie) zu Brücke und meiner Wenigkeit der dritte organische Physiker im Bunde. Ein Kerl, der Chemie, Physik, Mathematik mit Löffeln gefressen hat, ganz auf unserem Standpunkt der Weltanschauung steht, und reich an Gedanken und neuen Vorstellungsweisen.«20
Der »Bund« meinte das Gelöbnis, das du Bois-Reymond und Brücke 1842 geleistet hatten: alle organischen Phänomene durch physikalische und chemische Kräfte zu erklären, und zwar unter Verwendung physikalischer, chemischer und mathematischer Methoden und Instrumente und ohne sich dabei zur Erklärung des vagen Begriffs der Lebenskraft zu bedienen. Sie versuchten, Lebensphänomene als stoffliche Materie in mechanischer Bewegung zu verstehen. In den kommenden Jahren standen sie (sowohl als Individuen als auch institutionell) zudem für eine mehr oder weniger scharfe Unterscheidung zwischen Morphologie und Physiologie und trugen dazu bei, der Physiologie eine neue, weit weniger anatomische und viel stärker physikalische Bedeutung zu geben. Helmholtz und Carl Ludwig schlossen sich mit ihnen zu einer Gruppe von sogenannten organischen Physikern zusammen. Sie alle wollten die Physiologie von der romantischen, nichtmateriellen Vorstellung einer »vitalen« Kraft (d. h. der Lebenskraft) befreien, die angeblich allen organischen Phänomenen ihr Leben einhauchte. Für sie basierten diese Phänomene vielmehr auf anorganischen Phänomenen. Sie stützten sich dabei auf die gerade neu entstehende physiologische Chemie, neue experimentelle Methoden in der Physik und die damit verbundenen Entwicklungen in der Präzisionsmesstechnik. Damit bildeten sie eine jüngere, eher materialistisch und mechanistisch ausgerichtete Gruppe von Wissenschaftlern, die die ältere, romantische Generation herausforderte, die in unterschiedlichem Maße in den Bann der mittlerweile längst diskreditierten Naturphilosophie geraten war – jener spekulativen, idealistischen Naturphilosophie also, die von Lorenz Oken, Friedrich Schelling, Goethe und anderen befördert wurde, welche an die fundamentale Einheit der Kräfte in der Natur glaubten. Die organischen Physiker, die ihrerseits selbst gelegentlich philosophische Tendenzen mit ganz eigenen romantischen Zügen an den Tag legten, stärkten oder lancierten überhaupt erst die Sinnesphysiologie, Elektrophysiologie und die experimentelle Psychologie, während sie zugleich starke, damit zusammenhängende Interessen an Kunst und Ästhetik hegten.21 Kirchhoff, Siemens, du Bois-Reymond, Brücke und Ludwig sollten zentrale Figuren in Helmholtz’ Leben und Karriere bleiben. Er hatte ein Netzwerk von Unterstützern gefunden – und diese ihn.
Werben um Dot
Anfang Februar 1846 kehrte Helmholtz zu den Husaren zurück und verbrachte die nächsten 18 Monate hauptsächlich damit, eine junge Frau zu umwerben und eine Schrift über die Krafterhaltung zu verfassen. Jeden Morgen arbeitete er bis elf Uhr in dem kleinen Labor, das er in seiner Kaserne eingerichtet hatte; seine medizinischen Pflichten waren minimal. Gelegentlich besuchte er Berlin, um sich dort mit einem Instrumentenbauer, Johann Georg Halske, zu beraten oder die Bibliothek zu nutzen. Er korrespondierte mit du Bois-Reymond, mit dem er sich auch wechselseitige Besuche abstattete. »Im nächsten Quartal«, so schrieb er ihm gegen Ende des Jahres 1846, »habe ich Lazarettwache, da werde ich hauptsächlich Konstanz der Kräfte treiben«. Das hieß, dass er davon ausging, nicht viel Zeit für seine experimentellen Arbeiten zu haben, weshalb er plante, stattdessen in seiner Freizeit an seiner Theorie der Krafterhaltung zu arbeiten. Nicht einmal zwei Monate später schickte er du Bois-Reymond den Entwurf seiner Einleitung zu Über die Erhaltung der Kraft und bat um Kommentare und Kritik. Er wollte wissen, ob er die Art der Ausführungen für Physiker akzeptabel fand, und erklärte: »Ich habe mich bei der letzten Ausarbeitung zusammengenommen und alles über Bord geworfen, was nach Philosophie roch, soweit es nicht dringend nötig war, darum mögen einige Gedankenlücken geblieben sein.«22