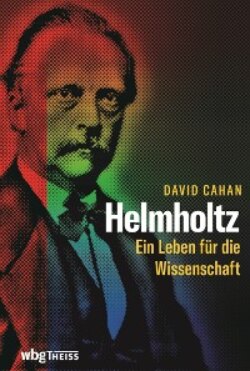Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 Privat und im Blick der Öffentlichkeit Mit leeren Händen
ОглавлениеNachdem Helmholtz im Herbst 1851 der Öffentlichkeit seinen Augenspiegel vorgestellt hatte, beeilte Preußen sich, dies zu honorieren. Die medizinische Fakultät Königsbergs erklärte, sie werde alles ihr Mögliche tun, um ihn zu halten, und ersuchte das Ministerium, seinen Leistungen Anerkennung zu zollen, indem man ihn zum ordentlichen Professor der Physiologie beförderte. Das Gesuch hob stärker den Bedarf in der Lehre hervor – nur ein richtiger Professor durfte Prüfungsleistungen abnehmen –, als Helmholtz’ Forschungsergebnisse zu rühmen. Vielleicht lag das daran, dass die Letzteren allzu offensichtlich waren, schließlich hatte Helmholtz bereits 17 Publikationen vorzuweisen. Du Bois-Reymond war jedenfalls beeindruckt von der »ungeheuren Arbeitskraft« des Freundes, dessen umfangeichen Kenntnissen und der Fähigkeit, »zugleich neue Collegia [zu] lesen und solche Arbeiten zustande [zu] bringen«. Dass Helmholtz so leistungsfähig war, führte er allein auf dessen Geisteskraft zurück: Helmholtz könne in einer Viertelstunde mehr verstehen als er selbst in einer ganzen Woche. Brücke zufolge arbeitete du Bois-Reymond sehr viel, Helmholtz aber noch mehr. Der für das Universitätswesen zuständige Ministerialbeamte, Johannes Schulze, hob neben Helmholtz’ Stärken als Lehrer und Forscher noch seine »sittliche und politische Haltung«1 hervor. Im Januar 1852 war Helmholtz ordentlicher Professor. Sein rascher Aufstieg zeigt, dass das Ministerium Forschung honorierte und den potenziellen allgemeinen Nutzen daraus erkannte.
Helmholtz’ Eltern waren überaus stolz und erfreut über seinen Erfolg. Ferdinand war geschmeichelt, als die Potsdamer Mediziner und andere respektierte Bürger ihm zu den Leistungen seines Sohns gratulierten. Es erfüllte ihn mit Stolz, dass sein Sohn nun Universitätsprofessor war, auch wenn er sich eingestehen musste, dass Hermann weitaus mehr berufliche Anerkennung erhielt, als es ihm jemals vergönnt gewesen war. Gewisse Spannungen im Vater-Sohn-Verhältnis blieben. Ferdinand wollte unbedingt teilhaben an den Projekten seines Sohns, griff jedoch oft auf hochspekulative Philosophie zurück, und sein Urteil (mitunter negativ) über Hermanns Arbeit auf Basis dessen, was aus seiner Sicht philosophisch folgerichtig war und was nicht, machte den Umgang mit dem Vater zunehmend schwierig. Helmholtz gewöhnte sich daher an, seine Arbeit einfach nicht mehr mit ihm zu diskutieren. Helmholtz’ Bruder Otto zufolge war Ferdinand deswegen oft verstimmt. Nachdem Hermann nun aber ordentlicher Professor war und ein großer Mann in der Wissenschaft, verflüchtigte sich dieses Gefühl langsam, und die Spannungen verschwanden größtenteils. Wie Ferdinand selbst äußerte, verliehen Hermanns wissenschaftliche Erfolge seinem eigenen Leben Bedeutung.2
Zugleich mit Helmholtz’ Beförderung verdoppelte das Ministerium sein Forschungsbudget (auf 200 Taler), ohne jedoch sein Salär zu erhöhen, was in ihm ein Gefühl der Unzufriedenheit hinterließ. Müller versuchte, ihn zu besänftigen, und erklärte, das Ministerium werde sicher nicht zögern, seinen Wünschen nachzukommen. Ludwig brachte einen beruflichen Ortswechsel ins Spiel, schließlich gebe es weit und breit keinen besseren Physiologen als Helmholtz. Bald schon, so Ludwig, werde es Helmholtz ins Herzen Deutschlands ziehen, wie es seiner künftigen herausragenden wissenschaftlichen Rolle entspreche. Wenn er seine eigenen bisherigen Leistungen mit denen von Helmholtz verglich, war Ludwig, ähnlich wie du Bois-Reymond, deprimiert und vergaß dabei ganz, dass er selbst bedeutende Arbeit geleistet hatte: zu der Theorie des Blutdrucks und dessen Messung, zur Harnabsonderung und zur Neurosekretion, ganz zu schweigen von der Erfindung des Kymographen. Ludwig tröstete sich damit, Helmholtz’ Freund sein zu dürfen, und hoffte auf ein baldiges Wiedersehen. Als du Bois-Reymond ihn einmal direkt nach seiner Meinung über Helmholtz’ enorme Arbeitsleistung fragte, antwortete er, derjenige sei ein Glückspilz, der ohne Anstrengung oder Zögern Großartiges erreiche – gerade so, wie ein Baum wachse. Sein einziger Trost sei der Gedanke, dass jemand, der so ruhig und ohne tiefes Leiden wie Helmholtz sei, auch dessen Gegenteil nicht kennen könne: eine glühende Freude. Ludwig hielt du Bois-Reymond (noch) für Helmholtz wissenschaftlich überlegen, da sich Helmholtz im Gegensatz zu du Bois-Reymond nicht auf ein Fachgebiet kapriziere.3
Für Helmholtz stand noch immer die Möglichkeit im Raum, wie Henle es im vorigen Sommer angedeutet hatte, nach Heidelberg zu gehen. Doch auch sechs Wochen nach seiner Beförderung hatte er noch nichts dazu gehört. Henle empfahl sowohl ihn als auch du Bois-Reymond für die Physiologieprofessur und glaubte, dass bald eine Entscheidung getroffen würde. Er selbst dachte darüber nach, Heidelberg zu verlassen, und machte aus der Besetzung der so lange vakanten Professur eine Bedingung für sein Bleiben. Helmholtz’ Aussichten auf den Posten schmälerten sich jedoch bald, worüber er sehr enttäuscht war. Eine Vielzahl an Streitereien auf verschiedensten Ebenen (ideologisch, hochschulpolitisch, finanziell, politisch, innerhalb Heidelbergs, aber auch zwischen der Stadt und der Badener Regierung) ließ seine Kandidatur im Sande verlaufen. Im Juli ging Henle fort (nach Göttingen), er wurde von dem Anatomen und Physiologen Friedrich Arnold ersetzt. Henle war daran verzweifelt, dass Heidelberg es nicht geschafft hatte, sich einen (richtigen) Physiologen zu sichern: erst nicht Ludwig, dann nicht Carl Theodor Ernst von Siebold und jetzt nicht Helmholtz oder du Bois-Reymond.4
Helmholtz fand zu Hause Trost. Ungefähr neun Monate nach seiner Beförderung, die ihn gleichwohl mit leeren Händen zurückgelassen hatte, gebar Olga ein zweites Kind, Richard Wilhelm Ferdinand Helmholtz, einen »sehr wohlgelungene[n] Knaben«. Im Januar 1853 ließen sie ihn taufen. Olga kam das Kind jedoch teuer zu stehen. Während ihrer Schwangerschaft war sie die ganze Zeit krank gewesen, nach Richards Geburt erkrankte sie sogar schwer, ein »gastrisch nervöses, sehr langwieriges Fieber« mit einem Bronchialkatarrh (Entzündung der Schleimhäute in Nase und Atemwegen). Auch ihr chronischer Husten verschlimmerte sich. Käthe war ebenfalls krank, und Helmholtz trug sich den ganzen Winter über »mit mancher Angst und Sorge«. Ihm fehlte die nötige Ruhe, um weitere Zeitmessungen zu Nervenreizen vorzunehmen, er forschte jedoch weiter an der Akkommodation des Auges. Mit Richards Geburt trat das Familienleben noch stärker in den Vordergrund. Über die Wunder der Ehe sprach er in den höchsten Tönen, »ich weiß es aus eigener Erfahrung und erfahre es noch täglich«, ließ er du Bois-Reymond wissen, der endlich ebenfalls seine bessere Hälfte gefunden hatte. Heiraten, so Helmholtz, sei »der wichtigste und schönste Schritt des Lebens«. Die Ehe solle seinem Freund »reiche Blüten und Früchte eintragen wie mir«. Zu diesen »Früchten« gehörte auch Erfolg in der Forschung: »Wenn dein Fleiß und Kraft zur Arbeit in dem befriedigten Behagen des Ehestandes in demselben Verhältnisse steigen, wie es bei mir der Fall ist, so hat die Welt Wunder zu erwarten.« Nur kosteten Ehe und Familie auch etwas. Helmholtz benötigte mehr Geld und endlich, 1853, erhielt er eine Gehaltserhöhung auf 1000 Taler, nachdem er einen Ruf der Kieler Universität abgelehnt hatte.5
Revolution in der Augenheilkunde
Vom Helmholtz’schen Augenspiegel hörten Physiologen und Augenkundler zuerst via Mundpropaganda, während und im Gefolge seiner Werbetour im Sommer 1851, und dann mit seinem Aufsatz im Herbst. Albrecht von Graefe beispielsweise, der 1850 in Berlin eine kleine Augenklinik eröffnet hatte und Helmholtz noch nicht kannte, entwickelte ein großes Interesse an dessen Augenspiegel. Nach Lektüre des Aufsatzes schrieb er ihm einen begeisterten Brief und bat darum, ihm einen solchen Spiegel anfertigen zu lassen. Er berichtete davon auch seinen Kollegen, Lilliam Bowman in London und Louis-Auguste Desmarres in Paris. Bei Helmholtz’ Instrumentenhersteller gingen so viele Bestellungen ein, dass er die Interessenten bald weiterverweisen musste. Kurz nachdem Helmholtz’ Text erschienen war, hielt er auch seinen ersten öffentlichen Vortrag (November 1851) über den Augenspiegel im Rahmen der ersten Sitzung des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde. Bei dieser Gelegenheit konnte er seinen Arztkollegen den Spiegel auch präsentieren. Ruete hielt in Göttingen ebenfalls einen Vortrag dazu. 1852 stellte er eine verbesserte Version vor, die ein innovatives, praktisches Linsensystem beinhaltete, welches ein umgekehrtes Bild von der Netzhaut erzeugte (die sogenannte indirekte Ophthalmoskopie). Ein Assistent Graefes namens Richard Liebreich konstruierte wiederum ein verbessertes indirektes Ophthalmoskop. Er vertiefte seine Kenntnisse über das Instrument, indem er sich mit führenden Persönlichkeiten in Berlin, Utrecht, Paris und London in Verbindung setzte.6
In den 1850er-Jahren nahm das Interesse am Augenspiegel und seiner Weiterentwicklung rapide zu. Er stand in einer Reihe mit anderen technologischen Innovationen des 19. Jahrhunderts auf dem Felde der Medizin – wie Stethoskop, Endoskop, Fieberthermometer, Laryngoskop und Blutdruckmesser –, die zur Beurteilung des inneren Zustands und der Funktionsweise des lebenden menschlichen Körpers dienten. Mit all diesen Instrumenten erfuhr nach und nach auch die Arzt-Patienten-Beziehung einen Wandel. Anfang 1852 bestellte Graefe mehrere Augenspiegel bei ortsansässigen Berliner Optikern. Ein Exemplar davon versprach er dem niederländischen Augenheilkundler Franciscus Cornelis Donders in Utrecht zu schicken, merkte aber an, es seien noch Modifizierungen nötig, damit man es in der ärztlichen Praxis nutzen könne. Donders, ein großer Verfechter wissenschaftsbasierter Medizin, der Kontakt zu mehreren Studenten Müllers hatte, fand aber, dass das Instrument für die Diagnose eines beginnenden Katerakts bereits von großem Nutzen sei. Er habe es schon für zahlreiche Diagnosen am Patienten genutzt. Auch Brücke ließ sich von Helmholtz’ Instrumentenhersteller mehrere Augenspiegel fertigen. Ludwig flehte du Bois-Reymond dringend an, ihm in Berlin einen Augenspiegel herstellen zu lassen. Du Bois-Reymond selbst fand die praktische Handhabung von Helmholtz’ ursprünglichem Modell schwierig; das Gerät sei komplizierter, als es scheine. Außerdem verfügten seiner Ansicht nach nur wenige Mechaniker über die nötige technische Ausstattung, um einen Augenspiegel zu bauen und zu testen. Helmholtz war von Ruetes indirektem Verfahren dazu angeregt worden, ein neueres, einfacheres Modell zu entwickeln, in dem sich eine konvexe Linse befand. Sein Instrumentenmacher hatte zudem für eine bessere Bedienbarkeit zwei drehbare Scheiben angebracht (mit je vier konkaven Linsen). So musste sich im Grunde jeder, der einen Augenspiegel haben wollte, an einen professionellen Instrumentenmacher wenden, zumal das Gerät mit den ständigen Weiterentwicklungen technisch zunehmend komplexer wurde. Es gelang nur sehr wenigen kreativen Tüftlern, wie dem schottischen Physiker James Clerk Maxwell, ihr eigenes Instrument anhand von Helmholtz’ Beschreibungen zu bauen. Einige wenige Augenärzte lehnten den Augenspiegel auch schlicht ab. Ein Kollege von Helmholtz, seines Zeichens Chirurg, fand das Instrument zu gefährlich, ein anderer betrachtete es als unnötig.7
Nachdem seine Erfindung ein Jahr in der Welt war, konzentrierte Helmholtz sich auf die Formulierung einer Theorie zur Akkommodation des Auges, also zu der Frage, wie es der Linse gelingt, sich auf Objekte in verschiedenen Entfernungen zu fokussieren. Diese schon lange bestehende Frage, die bereits im Mittelalter erörtert wurde, war für die Forschung nach wie vor von großem Interesse. Bei der Akkommodation ging es im Grunde um die Brechung des Lichts im Auge. Helmholtz konzentrierte sich in diesem Zusammenhang auf die Rolle, die Veränderungen in Geometrie und Mechanik der Linse spielten, weniger auf ihre Anatomie oder Biochemie. Wie es für ihn typisch war, erdachte er ein neues Instrument, das Ophthalmometer, um die sich ändernde Oberflächenkrümmung der Hornhaut und anderer Flächen im Auge zu messen. Ebenso typisch: Bei seinen Messungen ging es eher um Veranschaulichung als Präzision. Seine Analyse war zwar mathematischer und mechanischer Natur, er wies jedoch auch auf den Nutzen hin, den seine Theorie und sein Gerät für das praktische Verständnis des gesunden und kranken Auges haben konnten.8 Das Ophthalmometer, das Ophtalmoskop und die Theorie der Akkommodation revolutionierten auch tatsächlich das Verständnis und die Diagnosemöglichkeiten des Auges und beeinflussten die Augenchirurgie nachhaltig. Für die Augenheilkunde waren sie ebenso bedeutsam wie das Teleskop und die graduierte Skala für die Astronomie.
Helmholtz’ Arbeit stärkte seine Kontakte nach Berlin. Im Winter 1852/53 hatte er mit seinen Versuchen zur Akkommodation begonnen, aber wegen diverser Erkrankungen in seiner Familie fiel ihm das Arbeiten schwer. Wie früher schon bat er du Bois-Reymond um Hilfe bei der Veröffentlichung eines vorläufigen Manuskripts zur Akkommodation. Du Bois-Reymond war vor Kurzem zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften gewählt worden und ließ Helmholtz wissen, er sei nun in einer besseren Position, um ihn bei einer Veröffentlichung dort zu unterstützen. Mitte Januar 1853 fuhr Helmholtz nach Berlin, um am Jahrestreffen der Physikalischen Gesellschaft teilzunehmen. Dort traf er auf seine guten Freunde du Bois-Reymond, Karsten, Brücke, Knoblauch und Kirchhoff. Ebenfalls im Januar sandte er du Bois-Reymond einen kurzen Text für den Monatsbericht der Akademie und fügte hinzu, dass er für die Fertigstellung des kompletten Beitrags noch eine Weile brauchen werde. Ende Februar kehrte er nach Berlin zurück und hielt vor der Gesellschaft einen Vortrag über Akkommodation.9 Es sollte noch knappe zwei Jahre dauern, bis er den Text zu diesem Thema fertigstellte.
In der Zwischenzeit wurde von mancher Seite Priorität gegenüber Helmholtz’ vorläufigen Ergebnissen beansprucht. Donders berichtete ihm (und kurz darauf auch Brücke), dass der niederländische Arzt Antoine Cramer gerade ein ähnliches Projekt abgeschlossen habe. Er bat ihn, Cramer zu erwähnen, da dessen Name ansonsten unter dem Gewicht von Helmholtz’ Namen komplett untergehen würde. Andere (darunter auch Brücke und Max Langenbeck) arbeiteten ebenfalls zum Thema Akkommodation. Die Frage, wer etwas zuerst entdeckt hatte, schwang immer mit. Enge Freunde konnten ebenso um den Vorrang streiten wie Fremde. Großzügig ließ Helmholtz etwa du Bois-Reymond den Vortritt darin, der Urheber des Vergleichs des menschlichen Nervensystems mit dem neuen elektrischen Telegraphensystem zu sein. Dieses Bild erfreute sich um die Jahrhundertmitte (zusammen mit der metaphorischen Vorstellung von Netzen und Netzwerken) sowohl in der Literatur als auch in Wissenschaft und Technik großer Beliebtheit.10
Helmholtz’ Leistungen in der Physiologie und der Augenheilkunde traten im Verbund mit der innovativen Arbeit anderer Wissenschaftler in den 1850er- und 1860er-Jahren eine Revolution auf dem Gebiet der Ophthalmologie los, die sowohl die Ophthalmologie als Wissenschaft betraf als auch die klinische Praxis. Unterschiedlichste naturwissenschaftliche, technologische und institutionelle Entwicklungen beeinflussten sich dabei gegenseitig. Donders etwa betrieb Grundlagenforschung zur Lichtbrechung und Akkommodation des Auges, befasste sich aber auch mit der entsprechenden klinischen Arbeit zur Verschreibung von Sehhilfen. Graefes Klinik machte sich mit ihren chirurgischen und organisatorischen Neuerungen einen Ruf; sie war auch beim Einsatz des Augenspiegels ganz vorne mit dabei, testete ihn, nutzte ihn und unterrichtete in seinem Gebrauch. Es war Graefes Verdienst, dass Berlin zum Zentrum für Augenheilkunde aufstieg; er stand an der Spitze einer neuen Generation klinischer Ophthalmologen. 1854 gründete er mit dem Archiv für Ophthalmologie die erste und wichtigste Zeitschrift auf diesem Gebiet. Die Rolle von Helmholtz’ Augenspiegel für Diagnostik und Therapie wurde darin entsprechend gewürdigt. Mitte der 1850er-Jahre hielt das Instrument Einzug in die Praxen führender Augenärzte. Was die Ärzte nun am Auge beobachten konnten, ersetzte nach und nach die Beschreibungen der Patienten darüber. Auch löste sich die Augenheilkunde langsam von der Chirurgie und wurde zur eigenständigen Disziplin. 1852 war Ruete in Leipzig der erste ordentliche Professor für Ophthalmologie, 1873 gab es an jeder preußischen Universität einen solchen Lehrstuhl. Die Augenheilkunde als eigenes akademisches Gebiet hing stark von physiologischen Erkenntnissen ab, zu denen Helmholtz mit seinen späteren Studien zur Farb- und Raumwahrnehmung sowie zur Augenbewegung und -koordination einiges beisteuerte und damit die generelle Entwicklung des Fachs, seine klinische Forschung und Praxis nachhaltig beeinflusste. Graefe pries Helmholtz mit den Worten: »[E]in Luther ist uns auferstanden.« Wie Donders Helmholtz berichtete, hatte die Erfindung des Augenspiegels mit dazu beigetragen, dass in den Niederlanden eine Augenklinik errichtet worden war. Als der niederländische König Wilhelm III. von dem nützlichen Instrument erfuhr, erhob er Helmholtz zum Ritter und Träger des Ordens vom Niederländischen Löwen.11
Die Deutschen, welche diese Revolution der Augenheilkunde losgetreten hatten, blieben mit ihren Ansichten nicht allein. Der Augenspiegel verbreitete sich in Holland und Frankreich – wie in vielen anderen Gebieten der Wissenschaft und Medizin übertraf Deutschland mittlerweile in der Augenheilkunde Frankreich an Innovationskraft –, und damit wuchs auch Helmholtz’ Renommee. Donders schrieb ihm, kein Wissenschaftler wolle es mit ihm aufnehmen. Die Nachricht von dem neuen Instrument gelangte bis nach Amerika, und junge Augenärzte pilgerten an deutschsprachige Universitäten, vor allem nach Berlin und Wien, um mehr darüber zu lernen. Auch in Großbritannien hörte man von der Erfindung. Henry Bence Jones war ein bekannter Londoner Arzt und medizinischer Chemiker, der mit Liebig studiert hatte und genau verfolgte, was sich in der deutschen Wissenschaftsszene tat. Er bat du Bois-Reymond, ihm, wenn er nach London komme, einen von Helmholtz’ Augenspiegeln mitzubringen, den er an einen dortigen Augenarzt weitergeben wollte. Durch du Bois-Reymond wurde auch David Brewster auf das neue Instrument aufmerksam, und die beiden wollten dafür sorgen, dass Helmholtz’ Aufsatz ins Englische übersetzt würde. Helmholtz verweigerte jedoch die Zusammenarbeit, da er drauf und dran war, eine niederschmetternde Kritik zu Brewsters Farbenlehre zu veröffentlichen. Der renommierte englische Arzt Bowman, dessen Augenchirurgie bald schon für Aufsehen sorgte, erkannte gleichfalls früh den Stellenwert von Helmholtz’ Augenspiegel und nutzte ihn in seiner Praxis. 1857 war er in England der Erste, der Graefes Iridektomie bei Glaukomen durchführte. Im gleichen Jahr organisierte Graefe den ersten Augenärztekongress in Heidelberg, und von da an wurden jährlich informelle Treffen abgehalten. 1863 begründeten die Kongressteilnehmer offiziell die Ophthalmologische Gesellschaft, die sich von da an in Heidelberg traf.12
Die Fortentwicklung und weit verbreitete Übernahme seiner Erfindungen und Forschungsergebnisse zum Auge brachten Helmholtz schnellen und anhaltenden Ruhm ein. Du Bois-Reymond äußerte 1853 gegenüber seiner Verlobten, dass Helmholtz in den Naturwissenschaften der größte lebende Forscher sei und generell zu den besten gehöre, die je gelebt hätten. Dafür, vergaß er nicht hinzuzufügen, sei er sozial etwas träge. In Würzburg war Helmholtz laut Ernst Haeckel, damals ein junger Student, als der genaueste unter den zeitgenössischen Physiologen bekannt, der alles mit größter mathematischer Genauigkeit anging. Helmholtz äußerste sich später folgendermaßen dazu: »Für meine äussere Stellung vor der Welt war die Construction des Augenspiegels sehr entscheidend. Ich fand nun bei Behörden und Fachgenossen bereitwilligste Anerkennung und Geneigtheit für meine Wünsche, so dass ich fortan viel freier den inneren Antrieben meiner Wissbegier folgen durfte.«13 In der Tat: Seine erste breite und nachhaltige Anerkennung verdankte er nicht etwa seinem Krafterhaltungssatz, sondern dem Augenspiegel.
Neben der Augenheilkunde gab es weitere Felder wissenschaftlicher Betätigung. Zwischen 1847 und 1854 entwickelte Helmholtz zwei verschiedene Methoden, die Geschwindigkeit von Nervenimpulsen zu messen und darzustellen. Neben derjenigen Methode, die auf Pouillets ballistischem Galvanometer basierte, ersann er eine zweite, graphische Methode. Sie basierte auf seinem neuen Myographen, einem Instrument, das er aus Ludwigs Kymographen (zur Aufzeichnung von Puls und Blutdruck mithilfe einer rotierenden Walze) entwickelt hatte. Die Ergebnisse des Myographen waren weniger präzise als diejenigen, die man mit Pouillets Methode erhielt. Aber mit Helmholtz wesentlich einfacher zu handhabenden Gerät ließen sich die Kurven der Muskelkontraktion graphisch aufzeichnen (und somit leicht erkennen), weshalb der Myograph als Darstellungsinstrument für Muskelkontraktion und Nervenimpuls überzeugte. 14
Diese bahnbrechenden Erkenntnisse der Elektrophysiologie stammten teils aus einer Studienreihe zu induzierten elektrischen Strömen, Strömen im menschlichen Körper und tierischer Elektrizität. Helmholtz’ Untersuchungen zu induzierten Strömen stützten sich auf die Forschung Georg Ohms, Kirchhoffs und weiterer, die das Konzept der Ersatzschaltung etabliert hatten. Die Arbeit war weitgehend physikalisch (nicht physiologisch), aber Helmholtz betonte, wie wichtig die beiden Ansätze füreinander waren. Zwei Aufsätze dazu erschienen in Poggendorffs Annalen, und es gab kein böses Blut, weil Poggendorff zuvor Helmholtz’ Text zur Erhaltung der Kraft abgelehnt hatte. Helmholtz veröffentlichte zudem eine »populäre« Erläuterung zur tierischen Elektrizität, die sich vor allem kritisch mit du Bois-Reymonds neuesten Ergebnissen zur »negativen Schwankung« auseinandersetzte. Sie erschien in der Allgemeinen Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur. Diese neue Zeitschrift, herausgegeben von Karsten in Kiel, wollte Wissenschaft und Literatur einem breiteren Publikum zugänglich machen und die Präsenz deutscher Kultur im Nordwesten »Deutschlands«, wo Preußen und Dänen um die Vorherrschaft in Schleswig-Holstein kämpften, in den Vordergrund rücken. Alles zusammengenommen – Helmholtz’ Aufsätze zur Nervenleitgeschwindigkeit und seine früheren Arbeiten zur Gärung und Fäulnis sowie zu den chemischen Veränderungen der Muskeln bei Kontraktion – bildeten sich durch sein wissenschaftliches Tun neue Teilgebiete der experimentellen Physiologie heraus, welche die Physiologen für den Rest des Jahrhunderts beschäftigten. Helmholtz mit seinen körperbezogenen Zeitmessungen (z. B. zur Reaktions- und Assoziationszeit) war wegweisend für das neue interdisziplinäre Feld der Psychophysik, das Männer wie Gustav Theodor Fechner und Ernst Heinrich Weber begründen sollten.15
Kritik an Goethe und die Farbmischungsdebatte
Zu Helmholtz’ Aufstieg an die Spitze der deutschen Wissenschaftsszene gehörte auch sein Debüt als Essayist und öffentlicher Wortführer der deutschen Wissenschaft. Zu Anfang des Winters 1852/53 war er damit beschäftigt, einen Vortrag über Goethe als Wissenschaftler vorzubereiten. Den Entwurf diktierte er Olga und las ihn ihr danach laut vor, wobei er ihr Verständnis für das eines allgemein gebildeten Zuhörers nahm. Seine Vorträge gelangen ihm am besten, so fand er, wenn Olga ihm damit half. Am 18. Januar 1853 hielt er seine Rede über »Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten« vor der Deutschen Gesellschaft zu Königsberg. Goethes Ruf als Literat hatte damals wohl seinen Tiefpunkt erreicht. Auch dass Helmholtz die wissenschaftliche Arbeit des Dichters thematisierte – zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland die Popularisierung der Wissenschaft noch in den Kinderschuhen steckte –, schadete Goethes allgemeinem Ansehen als Gelehrtem eher, als dass es ihm nützte.16
Helmholtz’ Rede umfasste weit mehr, als ihr Titel vermuten lässt. Er analysierte darin Goethes wissenschaftliche Arbeit in den Bereichen Botanik und vergleichende Anatomie (Osteologie) auf der einen und Optik und Farbenlehre auf der anderen Seite. (Unerwähnt ließ er etwa Goethes Studien zur Geologie, Mineralogie und Meteorologie.) Er ordnete Goethes Arbeiten in den aktuellen Kontext der Naturwissenschaften ein und wollte ihre »gemeinsamen leitenden Gedanken« aufzeigen. Indem er das tat, berührte er auch das Thema der Natur von Wissenschaft im Allgemeinen, im Vergleich und in Abgrenzung zur Kunst. Es wurde sein erster Versuch, einer breiteren Öffentlichkeit seine eigene Vorstellung von Wissenschaft und Erkenntnistheorie nahezubringen, und zwar in dem größeren Kontext seines langjährigen Kunstinteresses. Er versuchte weniger, die Dinge so zu erklären, dass wirklich alle sie verstehen konnten, als vielmehr die Fantasie seiner Zuhörerschaft anzuregen, auch wenn dies bei einigen ungeklärte Fragen zurücklassen würde.17
Der »geistigere Theil« der deskriptiven Wissenschaften, so erklärte er, beginne eben erst und werde interessant, sobald der Wissenschaftler unzusammenhängende Funde zu gesetzmäßigen Aussagen verbinde. Diese Arbeitsweise und der historische Moment kämen dem »ordnende[n] und ahnende[n] Geist unseres Dichters« sehr entgegen. Goethe habe zwei bedeutsame Ideen zur deskriptiven Wissenschaft gehabt: Erstens, dass die unterschiedliche Anatomie aller Tiere Variationen eines Archetypen seien. Die verschiedenen Verhaltensgewohnheiten, geographischen Bedingungen und Nahrungsvorräte seien der Grund, warum sich mit der Zeit die Anatomie unterschiedlich entwickelt habe. Mensch und Tier wiesen trotzdem Gemeinsamkeiten auf. Goethe entdeckte in menschlichen und tierischen Schädeln Strukturen, die ihn zu der Annahme veranlassten, beide seien ursprünglich aus dem Zwischenkieferknochen entstanden, der sich selbst später zurückbildete. Helmholtz sah diese Vorstellung von den Varianten eines Archetyps als Goethes »leitende Idee« in der vergleichenden Anatomie, und nie habe diese Idee jemand »besser und klarer ausgesprochen« als der Dichter.18 Das war eine wohlwollende Auslegung, denn Goethe war wohl nicht der Erste und Einzige, der glaubte, der menschliche Schädel habe sich aus einem oder mehreren veränderten Wirbeln entwickelt. Und das weiter gefasste Konzept von der Transformation allen Lebens im Verlauf der Zeit war unter Naturhistorikern seit der späten Aufklärung wohlbekannt (wenn auch selten akzeptiert).
Goethes »zweite leitende Idee« betraf laut Helmholtz »eine ähnliche Analogie zwischen den verschiedenen Theilen« eines organischen Wesens. In seiner Theorie von der Metamorphose der Pflanze erkläre er die scheinbar unterschiedlichen Pflanzenformen als Transformationen aus einer unterliegenden Grundstruktur, die für Goethe in der Blattnatur aller Pflanzenorgane bestand. Dieses Wissen hielt Helmholtz 1850 für seitens der Botaniker schon vollkommen akzeptiert. Im Gegensatz dazu habe Goethe mit seiner Theorie von einem gemeinsamen Typus im Tierreich bisher wenig bis keine Zustimmung erfahren, solange andere Forscher nicht eigenständig zu denselben Schlüssen kämen. Dennoch sah Helmholtz in Goethe den geistigen Urheber ebenjener »leitenden Ideen«, die Botaniker und Anatomen nun weiter ergründeten.19
Einen ganz anderen Ton schlug Helmholtz an, als sein Vortrag sich Goethes Vorstellungen zur Optik und seiner Farbenlehre zuwandte. Hierüber konnte er aus erster Hand und mit Autorität sprechen. In den beiden vergangenen Jahren hatte Helmholtz viel auf diesen Gebieten gearbeitet. Er hatte sich wahrscheinlich zum Teil deshalb für Goethes wissenschaftliche Arbeit als Vortragsthema entschieden, weil er gerade eine kritische Durchsicht der diesbezüglichen Arbeiten Dritter abgeschlossen hatte und begann, eigene Ideen zu entwickeln. Jeweils im Wintersemester lehrte er an der Königsberger Universität im Rahmen seiner Vorlesung über sensorische Physiologie über Farbe. Anders als der Großteil seiner physiologischen Arbeit bestand seine Farbforschung hauptsächlich aus der Verdichtung von bereits Bekanntem. Hier gab es keine neuen Instrumente zu bauen oder Entdeckungen zu machen, sondern er setzte sich mit der Arbeit anderer auseinander – darunter der unbestrittene Meister der experimentellen Optik und Farbtheorie, David Brewster. Dieser entwickelte in den 1820er- und 1830er-Jahren eine Theorie des Sonnenspektrums, wonach drei Grundfarben Weiß ergaben. Wenn er Newtons Ansätze damit nicht sogar ganz ablehnte, so stellte er dessen Farbtheorie doch, wie Goethe, gehörig infrage. Newton hatte gezeigt, dass sich (mithilfe eines Prismas) weißes Licht in sieben Spektralfarben zerlegen ließ. Brewster hingegen sprach nur von drei Farben, bestimmte Arten weißen Lichts ließen sich seiner Ansicht nach nicht weiter aufgliedern. Helmholtz war durchaus nicht der Erste, der Brewsters Theorie eines dreigeteilten Spektrums infrage stellte, tat dies jedoch am effektivsten. Seine Ausgangslage dafür war einfach besonders vorteilhaft: Da war sein unübertroffenes Verständnis der Physik und Physiologie des Auges, da waren seine Königsberger Kollegen, die er um Hilfe ersuchen konnte (Moser zu Fragen der Farbintensität, beispielsweise dem Purkinje-Effekt, Neumann für Optik im Allgemeinen und um sich ein Prisma zu leihen), dann seine eigenen laufenden Untersuchungen zur Zusammensetzung von Licht und schließlich seine große Vertrautheit mit Brückes Studie zu subjektiven Farben. Jedenfalls kam Helmholtz’ Beitrag von 1852 einem Umsturz gleich: Er widerlegte Brewsters Solarspektrumstheorie und verteidigte vehement Newtons Farblehre.20
Seinen Anti-Brewster-Vortrag über die Theorie der zusammengesetzten Farben publizierte Helmholtz sowohl in Poggendorffs Annalen als auch in Müllers Archiv. Das entsprach nicht nur dem zugleich physikalischen und physiologischen Charakter des Themas, sondern spiegelte auch sein wachsendes Ansehen als Physiker und Physiologe wider. Vor der Veröffentlichung hatte er sich an du Bois-Reymond gewandt, um das Erscheinen in Müllers Zeitschrift sicherzustellen und – typisch Helmholtz – die Kosten für die 200 Exemplare, die er zur Habilitation benötigte, zu minimieren. Ganz kleinlich beklagte er sich zudem, dass sein neuester Aufsatz im Archiv nur Lückenbüßer ganz am Ende eines Heftes geworden sei. Dieses falsche Gefühl, schlecht behandelt worden zu sein, spiegelt seinen Ehrgeiz und Elan wider. Verärgert fragte er, ob das Archiv überhaupt noch am Thema experimentelle Physiologie interessiert sei; allein sein Respekt vor Müller halte Ludwig und ihn davon ab, eine neue Fachzeitschrift zur experimentellen Physiologie zu gründen. Du Bois-Reymond ließ ihn wissen, dass er die Dinge vollkommen falsch sah: Das Archiv hatte ihn keinesfalls schlecht behandelt, vielmehr war der Herausgeber so darauf erpicht gewesen, alles von Helmholtz zu veröffentlichen, dass er dessen Artikel lieber noch ans Ende der aktuellen Ausgabe gepackt hatte, als ihn zurückzuhalten, bis die nächste erscheinen würde.21
In seiner Habilitationsschrift, mit der Helmholtz zum ordentlichen Professor wurde, ging er die älteren Farbtheorien kritisch durch, diskutierte (und verwarf) Thomas Youngs Dreifarbentheorie der Farbwahrnehmung und kam dann unter anderem zu dem Schluss, dass farbiges Licht oder Pigmente durch »Addieren« oder »Subtrahieren« vermischt werden können (z. B. indem man Lichtstrahlen auf den gleichen Punkt der Netzhaut richtete oder verschiedene Pigmente kombinierte). Seit Newton war man sich über das Thema der Farbmischung uneinig. Einige, die daran arbeiteten (nicht alle davon Wissenschaftler), nutzten Pigmente zur Farbmischung, andere Licht, einige näherten sich dem Thema aus dem Kontext der Malerei heraus, andere kamen aus der Physik, wo man Farben normalerweise mithilfe sich drehender Scheiben oder Räder mit farbigen Feldern darauf mischte. Manche griffen auf Prismen und Linsen zurück, wieder andere mischten Farben auf physiologischer Basis. Helmholtz’ Theorie und Veranschaulichung der Farbmischung in den Begriffen von Addition und Subtraktion der Farben brachte konzeptionelle Ordnung in die Sache. Dennoch konnte er nicht genau erklären, wie die Mischung zustande kam, und viele (nicht zuletzt Joseph Grailich und Hermann Günther Grassmann) hielten daher seine Arbeit für nicht sonderlich wichtig oder gehaltvoll. Er hatte jedoch auch seine Fans. Es waren nicht nur Freunde wie Ludwig oder Donders, die ihm versicherten, dass keiner mehr an Brewsters Farblehre glaubte. Mit seinem Text auf Englisch im Philosophical Magazine hatte er auch Menschen überzeugt, die ihn bisher nicht kannten, darunter William Barton Rogers, ein junger amerikanischer Chemiker und Geologe.22 Das Thema sollte Helmholtz im Jahre 1855 weiter beschäftigen.
Ende Juni 1852 hielt er, obwohl er mit einem »heftigen Katarrh, de[m] steten Begleiter der Sommerhitze«, zu kämpfen hatte, seine Antrittsvorlesung über die menschliche Sinneswahrnehmung. Dabei dozierte er über die Beschaffenheit von Licht und Farbe sowie ihre Wahrnehmung. Erst zum Ende hin wandte er sich epistemologischen Fragen zu und erklärte knapp, dass Licht- und Farbempfindungen nur Symbole für die Relationen der Wirklichkeit seien. Sie hätten genauso wenig gemeinsam mit der Realität und so viel Ähnlichkeit oder Bezug zu ihr wie der Name einer Person oder der Schriftzug dieses Namens mit dem Menschen selbst. Derlei Symbole, so Helmholtz, verrieten nichts über die Natur an sich.23 Sein Standpunkt, in dem sich seine spätere epistemologische Position erst andeutete, betonte die Bedeutung beider Dimensionen für die wissenschaftliche Analyse: der materiellen (physikalischen und physiologischen) und der immateriellen (zeichenhaften).
Als Helmholtz bei seiner Goethe-Vorlesung im Januar 1853 über dessen Theorie von Licht und Farbe sprach, tat er dies auf Basis seiner eigenen experimentellen und theoretischen Beschäftigung mit dem Thema und als Teil seiner umfassenderen Kritik an Brewster und anderen, die seit Newton auf diesen Gebieten gearbeitet hatten. Während er aber für Goethes Überlegungen zur vergleichenden Anatomie Lob übrig hatte, fiel die Kritik an dessen Ausführungen zu Optik und Farbe – und ganz allgemein an dessen methodologischem Vorgehen in den Naturwissenschaften – vernichtend aus. Auf dem Feld der Physik war Goethe für Helmholtz ein absoluter Amateur, dessen ursprüngliches Interesse ja auch in der Ästhetik gelegen habe, nicht in der Physik. Helmholtz spottete, dass Goethe sich ein Prisma hatte ausleihen müssen – und vergaß dabei anscheinend ganz, dass er sich selbst eins von Neumann geborgt hatte –, welches der Dichter dann aber lange nicht zu nutzen gewusst habe. Zudem habe Goethe (zumindest anfänglich) Newtons Theorie des Lichts nicht wirklich verstanden (sich aber hämisch darüber ausgelassen und gegen Newton polemisiert). Goethe widersprach der Theorie Newtons, nach der weißes Licht aus einem Spektrum einzelner monochromatischer Strahlen zusammengesetzt ist. Man könne Licht nicht weiter zerlegen, Farben verstand er vielmehr in den Kategorien von »Plus« oder »Minus«. Durch ein Prisma betrachtet entstanden aus Licht nach seiner Beobachtung genau an der Grenze zwischen Hell und Dunkel Farben. Goethe glaubte, Newton habe dieses Phänomen übersehen und daher nicht in seiner Theorie berücksichtigt. Newton war für Goethe, wie für manchen Romantiker jener Zeit, der Buhmann schlechthin. Die Physiker entgegneten Goethe jedoch, dass sie über die von ihm beobachteten Phänomene sehr wohl Bescheid wussten und sie allesamt mithilfe von Newtons Theorie erklären konnten. Goethes Äußerungen Zur Farbenlehre (1810) konnten letztendlich niemanden überzeugen.24
Helmholtz war nicht der erste Physiker, der Goethes Ausführungen zur Optik ablehnte. Schon seit ihrem Erscheinen 1791 waren sie ausgesprochen kritisch rezipiert worden. Goethe, dem das gar nicht ähnlich sah, machte diese Kritik schwer zu schaffen. Er ließ sich sogar zu jenem bekannten Ausspruch verleiten, als Einziger auf dem Gebiet der Farbenlehre das Rechte zu wissen – worauf er sich sogar mehr zugutehielt als auf seine Leistungen als Poet. Goethe sah sich eben genauso als Wissenschaftler wie als Dichter. 1850 zumindest hatte aber kein Wissenschaftler mehr ernsthaftes Interesse an Goethe als Naturforscher. Helmholtz sagte später, das »große Aufsehen«, welches Goethes Farblehre in Deutschland verursachte, »beruhte zum Theil darauf, dass das grosse Publikum, ungeübt in der Strenge wissenschaftlicher Untersuchungen« sei und daher eine künstlerische Darstellung der mathematisch-physikalischen vorzog. Außerdem stehe Goethes Theorie so wunderbar mit Hegels Naturphilosophie im Einklang.25
Helmholtz räumte ein, dass Goethe es verstand, seine Beobachtungen klar, lebhaft und gut strukturiert darzustellen. Er beschreibe »streng naturgetreu« und erscheine »wie überall im Gebiete des Thatsächlichen, als der grosse Meister der Darstellung«. Aber er habe Newtons Ergebnisse zur Optik offensichtlich nicht voll und ganz erfasst. Selbst als er bessere Unterweisung in dessen Lehre erhalten habe und tatsächlich zu einem Verständnis derselben gelangt sei, behauptete er weiter, die Faktenlage spräche gegen Newton. Goethes Schriften zur Optik befand Helmholtz weiter für »polemisch« und vage, bei seiner Farbenlehre überkam Helmholtz »ein unheimliches ängstliches Gefühl«. Goethes Forschung auf dem Gebiet der Optik habe kein solides Fundament, seine Theorie sei nicht zu Ende gedacht. Alle Physiker – er schien konsequent den Anti-Newtonianer Brewster zu vergessen – stimmten darin überein, dass sich die zur Debatte stehenden optischen Phänomene mit Newtons Theorie erklären ließen. Nur Goethe sei da anderer Meinung, »dessen seltene geistige Grösse, dessen besonderes Talent für die Auffassung der thatsächlichen Wirklichkeit wir nicht nur in der Dichtkunst, sondern auch in den beschreibenden Theilen der Naturwissenschaften anzuerkennen Ursache haben«.26
Im zweiten Teil seines Vortrags nahm Helmholtz kein Blatt vor den Mund. Er analysierte die Gründe für Goethes Stärken und Schwächen in der Wissenschaft (und der Kunst) und präsentierte einige seiner eigenen Ansichten über Ästhetik, Wissenschaftsphilosophie und die Beziehungen zwischen Naturwissenschaft und Kunst. Wesentlich für die Kunst sei es, »das künstlerische Material zum unmittelbaren Ausdruck der Idee zu machen«. Kunst operiere nicht mit Konzepten, sondern mittels der »unmittelbaren geistigen Anschauung«. Die Idee selbst liege im Kunstwerk. Helmholtz befand, Goethes größter Fehler in der Befassung mit naturwissenschaftlichen Fragen liege – wie bei Schelling, Hegel und anderen Naturphilosophen – in der mangelnden konzeptionellen und experimentellen Herangehensweise. Goethe glaubte, ein wissenschaftlich interessierter Beobachter könne alle Geheimnisse der Natur lüften, und belächelte Newtons Versuchsvorrichtungen und Spektren. Statt anzuerkennen, wie wichtig das kontrollierte Experimentieren für die Wissenschaft war, favorisierte er das direkte Beobachten – was, wie Helmholtz zugestand, für seine morphologischen Arbeiten hinreichend sein mochte. Goethe habe durchaus »Grosses« in der Wissenschaft geleistet, indem er sich auf seine Intuition verlassen habe, die ihn ahnen ließ, dass etwas in der Art eines Gesetzes in greifbarer Nähe lag. Goethe konkretisierte dieses Gesetz jedoch nie, denn das wiederum lag nicht »in der Richtung seiner Thätigkeit«. Er ging mit der Natur um wie mit der Kunst.27
Laut Helmholtz glaubte Goethe, wissenschaftliche Beobachtungen ließen sich ganz einfach so durchführen, »dass eine Thatsache immer die andere erkläre«, der Kontext sorge schon für Erkenntnisse, die Sinneswahrnehmung allein reiche vollkommen aus. Mit einer solchen Auffassung stimmte Helmholtz nicht überein: Um Naturerscheinungen vollständig erklären zu können, müsse man sie vielmehr auf die natürlichen Kräfte, die ihnen zugrunde lagen, zurückführen. Wahrgenommen werden könnten aber stets nur die Effekte der Naturkräfte, nicht die Kräfte selbst. Naturerscheinungen zu erklären, heiße daher im Grunde, das »Gebiet der Sinnlichkeit« zu verlassen und das Reich der Begriffe zu betreten. Wolle man die Ursache bestimmter Phänomene verstehen, müsse man die Kräfte dahinter ermitteln und ergründen, wie Phänomene und Kräfte zusammenhingen.28 Goethe hatte ein organisches Verständnis von Natur, das der mechanistischen Tradition widersprach, die sich auf Descartes, Newton und andere Denker des 17. Jahrhunderts zurückführen ließ und in der auch Helmholtz stand.
Helmholtz unterstellte Goethe, »diesen Schritt in das Reich der Begriffe, welcher notwendig gemacht werden muss, wenn wir zu den Ursachen der Naturerscheinungen aufsteigen wollen«, zu fürchten. Sein Erfolg als Dichter sei ebenso wie sein Misserfolg als Wissenschaftler darauf zurückzuführen, dass er nicht mit Begriffen arbeite. Anders als Goethe, so erklärte Helmholtz weiter, wolle der Physiker einführen »in eine Welt unsichtbarer Atome, Bewegungen, anziehender und abstoßender, die, in zwar gesetzesmässigem, aber kaum zu übersehendem Gewirre, durcheinander arbeiten. Ihm ist der sinnliche Eindruck keine unumstössliche Autorität […] Das Resultat dieser Prüfung, wie es jetzt vorliegt, ist, dass die Sinnesorgane uns zwar von äusseren Einwirkungen benachrichtigen, dieselben aber in ganz veränderter Gestalt zum Bewusstsein bringen, so dass die Art und Weise der sinnlichen Wahrnehmung weniger von den Eigenthümlichkeiten des wahrgenommenen Gegenstandes abhängt, als von den Sinnesorganen, durch welche wir die Nachricht bekommen.« Das war genau das Thema von Müllers Theorie der spezifischen Sinnesenergie. Aber Helmholtz erweiterte seine Kritik noch über das bisher zu Goethes falschem Verständnis von Licht und Farbe Gesagte hinaus ins Allgemeine: Goethe habe das Wesen der Physik nicht verstanden und erkenntnistheoretische Fehler begangen. »Die Sinnesempfindungen sind uns nur Symbole für die Gegenstände der Aussenwelt und entsprechen diesen etwa, wie der Schriftzug oder Wortlaut dem dadurch bezeichneten Ding entspricht«, so Helmholtz. »Sie geben uns zwar Nachrichten von der Eigenthümlichkeit der Aussenwelt, aber nicht bessere, als wir einem Blinden durch Wortbeschreibungen von der Farbe geben.« Im Grunde seien Goethes Beiträge zur Optik überhaupt keine Wissenschaft, sondern eher ein Versuch, »die unmittelbaren Wahrheiten des sinnlichen Eindrucks gegen die Angriffe der Wissenschaft zu retten«. Allein die Vorstellung, dass Goethe unmittelbaren Sinneseindrücken in der Optik – wie in der Poesie – so viel Bedeutung beimaß, bringe einen in »Verlegenheit«.29
Die wahre Physik trachte danach, »die Hebel, Stricke und Rollen zu entdecken, welche, hinter den Coulissen arbeitend, diese regieren, und der Anblick des Mechanismus zerstört freilich den schönen Schein«. Goethe hingegen versuche fälschlicherweise, der »Wirklichkeit selbst vollständig poetisch« seinen Stempel aufzudrücken. Das mochte die Schönheit der Goethe’schen Dichtung erklären, aber auch, warum er sich gegen die Heranziehung von allerlei mechanischen Wirkkräften wehrte, die ihn in seinem »poetischen Behagen« stören könnten. Helmholtz warnte die Physiker, nicht ebenso zu verfahren wie Goethe: »Wir können aber den Mechanismus der Materie nicht dadurch besiegen, dass wir ihn wegleugnen, sondern nur dadurch, dass wir ihn den Zwecken des sittlichen Geistes unterwerfen. Wir müssen seine Hebel und Stricke kennen lernen – […] um sie nach unserem eigenen Willen regieren zu können; darin liegt die grosse Bedeutung der physikalischen Forschung für die Cultur des Menschengeschlechts und ihre volle Berechtigung gegründet.« Seine Herangehensweise an die Naturwissenschaft habe Goethe in deskriptiven Fächern wie Botanik oder Osteologie großen Erfolg gebracht – was ebenso für seinen dichterischen Ansatz gelte –, ihn aber in der Physik scheitern lassen.30 In Helmholtz’ Sicht waren Wissenschaft und Kunst im Grunde zwei verschiedene Sphären.
Helmholtz’ Kritik unterschied sich schon darin von der seiner Vorgänger, dass er sie vor einem breiten Publikum in einer für Laien verständlichen Sprache äußerte. Sein Vortrag erschien später im selben Jahr als Aufsatz in einer Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur und war ausgesprochen erfolgreich. Das lag an mehreren Faktoren: Helmholtz’ steigendes Ansehen in der deutschen Wissenschaftsszene verlieh ihm Autorität, er hatte Goethes Beiträge zur Optik in einen größeren intellektuellen Kontext eingeordnet, und schlussendlich hatten sich auch schlicht die Zeiten geändert. Indem er Goethe öffentlich kritisierte und mit anderen (inzwischen meist verstorbenen) romantischen Philosophen (»Wissenschaftlern«) in Verbindung brachte, wurde Helmholtz zum öffentlichen Wortführer jener nüchternen, realistischen und mechanistischen Sicht auf die Natur, die sich nach 1848 dem Romantizismus der Naturphilosophie gegenüberstellte, die im ersten Drittel des Jahrhunderts noch vorgeherrscht hatte. Dass Helmholtz Goethe nicht vollkommen aus der Naturwissenschaft ausklammerte, lag hauptsächlich daran, dass der nie wirklich ein Teil davon gewesen war; in jedem Fall zog er eine philosophische Grenzlinie zwischen Wissenschaft und Kunst. Dass sein Aufsatz am Ende auch noch gut lesbar und vielerorts verfügbar war, ließ Goethes Ruf als Wissenschaftler (besonders als Physiker) weiter leiden. Helmholtz beeinflusste damit maßgeblich die weitere Rezeption von Goethes Schriften zur Optik bis mindestens in die 1920er-Jahre, als der Organizismus in der deutschen Wissenschaft und Kultur wieder positiver aufgenommen wurde.31
Noch einmal Networking in Deutschland
Als sich der Frühling 1853 dem Ende zuneigte, bereitete Helmholtz sich auf eine Britannienreise vor. Daneben musste er sich auch noch um Olgas Gesundheit kümmern. Den gesamten Winter über hatte eine Halsentzündung sie geplagt, und obwohl es ihr schon besser ging, behandelte ihr Mann sie noch immer mit Lebertrankapseln. Das Königsberger Klima war denkbar ungünstig für eine Person mit ihren gesundheitlichen Problemen, und Olga übernahm sich bei der Kinderpflege und im Haushalt. Seit Ostern litt sie außerdem wieder an einem Katarrh, Helmholtz sorgte sich sehr um sie. Er selbst ruhte sich die vier Wochen vor seiner Reise aus und trank Marienbader Quellwasser gegen seine »häufigen und heftigen Kolikanfälle«.32
Seine Reise kann sinnbildlich genommen werden für zwei große Veränderungen in der Wissenschaft. Sie steht einerseits für die zunehmende Internationalisierung der Wissenschaft, eine Entwicklung, die hauptsächlich dem verbesserten Schienennetz zu verdanken war. Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern oder auch entlegenen Orten innerhalb eines Landes konnten sich nun viel einfacher auf Konferenzen oder zu anderen Gelegenheiten treffen. Zweitens spiegelt der Umstand, dass Helmholtz nach Großbritannien fuhr und nicht nach Frankreich, die um die Jahrhundertmitte abnehmende Bedeutung Frankreichs für die Wissenschaft wider. Für frühere Generationen junger deutscher Wissenschaftler wie zum Beispiel Humboldt oder Magnus war eine Frankreichreise (d. h. nach Paris) zur Beförderung ihrer künftigen Karriere ein Muss gewesen. Ein Besuch in Paris brachte einen auf den Stand der neuesten, wenn nicht gar besten wissenschaftlichen Arbeiten, verschaffte persönliche Kontakte zu führenden oder vielversprechenden Wissenschaftlern und eröffnete den Zugang zu wissenschaftlichen Institutionen. Um die Mitte des Jahrhunderts war all dies passé, und die französische Wissenschaftsszene war vergleichsweise unwichtig geworden.
Helmholtz zog es nicht nach Frankreich beziehungsweise stand der französischen Wissenschaft und ihren Vertretern sogar regelrecht feindselig und verächtlich gegenüber. Er äußerte gegenüber du Bois-Reymond: »Ich habe mich geärgert, daß so ein dürftiger Bursche, wie Bernard, wieder den großen physiologischen Preis bekommen hat und fast in die Akademie hinein gewählt wäre. Er scheint aber die Herren [François] Magendie und Mr. [Pierre] Flourens auch mit Schmeicheleien zu überzuckern.« Du Bois-Reymond stachelte ihn an: »Es amüsiert mich sehr, daß das dumme Geschmeiß in Paris Herrn Bernard und Herrn [Julius] Budge und [Augustus] Waller mit Preisen überschüttet, aber für Dich nichts – Du hast ihnen doch nichts getan; was mich betrifft, so haben sie ihre guten Gründe.« Helmholtz kommentierte dies folgendermaßen: »Die französische Akademie blamiert sich in der Physiologie jetzt so, daß man sich sehr bedenken muß, ihr physiologische Sachen zuzuschicken[…]«33 Helmholtz hatte diese Franzosenfeindlichkeit teils von seinem Vater übernommen, teils ließ sie sich aber auch darauf zurückführen, dass seine französischen Kollegen – von denen er keinen persönlich kannte – der physikalisch ausgerichteten Physiologie von Helmholtz und seinen deutschen Mitstreitern aus der organischen Physik ihrerseits skeptisch gegenüberstanden. Er überquerte daher lieber einmal die Nordsee als den Rhein.