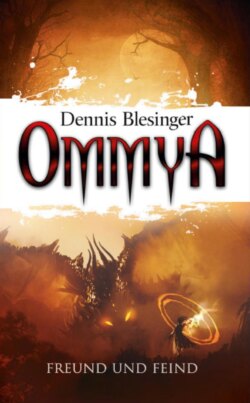Читать книгу OMMYA - Freund und Feind - Dennis Blesinger - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление»Es tut mir leid, aber – «
»Wenn du dich nochmal entschuldigst, streiche ich dir deinen Urlaub.« René wusste, dass Christopher es nicht böse meinte, aber das Letzte, was er gerade brauchte, war eine weitere Entschuldigung. Nicht die Tatsache, dass Renés Handy um halb zwei Uhr nachts geklingelt hatte, war für seine schlechte Laune verantwortlich. Es war vielmehr der Umstand, dass er sich wirklich eingeredet hatte, so etwas wie ein paar normale Tage verbringen zu können.
»Was genau ist passiert?« Christopher hatte versucht, die Sache am Telefon zu erklären, allerdings hatte René nur halb zugehört, weil sich Christopher nach jedem zweiten Satz entschuldigt hatte. Darüber hinaus war es René lieber, sich die Sache vor Ort anzusehen.
»Ich habe keine Ahnung.« Christopher war das schlechte Gewissen deutlich anzusehen. Die Kompresse auf seinem Kopf hielt René davon ab, eine pampige Bemerkung abzufeuern. Keiner hatte sich dies hier ausgesucht. Er kniete sich hin und betrachtete die Tür des Bürogebäudes. Die Scheibe war zertrümmert und Glasscherben lagen über den kompletten Gehweg verteilt.
»Was ich nicht verstehe«, meinte er, »warum hat wer auch immer die Tür eingeschlagen? Ich meine, sie haben es ja irgendwie geschafft, aus der Zentrale rauszukommen und den Fahrstuhl zu holen.« Für beides brauchte man sowohl eine Karte, als auch einen Code. Beides war nicht eben leicht zu beschaffen.
»Vielleicht hatten Sie keinen Schlüssel für die Tür?«, erklang eine Stimme von hinten. René blickte sich um und sah Jochen, der vom Parkplatz aus mit müdem Gesicht auf sie zu schritt. Auch wenn René nicht erfreut über die nächtliche Störung war, so wusste er, dass Jochen mindestens eine Stunde brauchen würde, um richtig wach zu werden. Jochen war alles, nur kein Nachtmensch.
»Hi.« René nickte ihm zu und betrachtete erneut die Tür. Sie war eindeutig von innen heraus zerschlagen worden. Fast alle Splitter befanden sich außerhalb des Gebäudes. Er bezweifelte, dass irgend jemand etwas gehört hatte. Das Gebäude, unter dem sich die Zentrale von OMMYA befand, lag in einem kleinen Industriegebiet, in dem nach Feierabend so gut wie nichts los war. Er blickte sich um. Es gab Überwachungskameras in der Gegend, aber die nächste war mehr als einhundert Meter entfernt und hatte die Straßen vor dem Gebäude und den Parkplatz im Blick, nicht die Eingangstür. Darüber hinaus war es stockdunkel. Er bezweifelte, dass sie irgendetwas würden erkennen können.
Schweigend fuhren sie zu dritt hinunter, während Christopher erneut versuchte, die Vorfälle zu beschreiben.
»Ich habe gedacht, da versucht jemand, witzig zu sein. Bevor ich irgendetwas richtig erkennen konnte, hat mir jemand einen über den Schädel gezogen.«
»Fehlt irgend etwas?«
Christopher gab ein müdes Lächeln von sich. »Nein, nicht dass ich wüsste. Aber du weißt ja vielleicht, wie’s unten aussieht. Die Jungs gucken gerade nach. Wie es aussieht, ist aber alles noch da, wo es sein soll.«
»Was ist mit den Alarmen? Wieso sind die Türen nicht zugegangen?«, fragte Jochen. Christopher schüttelte den Kopf, eine Bewegung, die er sofort bereute. Auch wenn die Wunde nicht tief war, so verursachte sie dennoch scheußliche Kopfschmerzen.
»Sind sie«, meinte er schließlich. »Allerdings erst, als alles wieder in Ordnung war. Ich wollte gerade jemanden rausschicken, um nachzusehen, als das System angesprungen ist. Sahra ist schon dabei, sich die Sache anzusehen.«
Wie René einmal Rebecca gegenüber angemerkt hatte, bestanden die meisten Schutzvorrichtungen bei OMMYA nicht darin, jemanden davon abzuhalten, in die Zentrale zu gelangen. Zugegeben, das an sich war schon kompliziert genug. Das wirklich Schwierige war es jedoch, hinauszugelangen. Im Falle eines Sicherheitslecks wurden sämtliche Türen verriegelt, und es war nur mittels mehrerer Codes, Schlüssel und Karten möglich, diese Verriegelung wieder aufzuheben. In diesem Fall hatte diese Abschottung allerdings dazu geführt, dass die fünf Minuten, die Christopher aufgrund seines lädierten Zustandes für die Eingabe der Codes gebraucht hatte, den Flüchtlingen mehr als genug Zeit gegeben hatte, zu verschwinden. Keiner machte sich etwas vor. Wer auch immer entwischt war, war längst über alle Berge.
René betrat sein Büro und warf einen Blick auf die Uhr. Das Lachen, das er von sich gab, hatte etwas Weinerliches an sich.
»Wieso fahre ich eigentlich noch nach Hause?«, fragte er an niemanden Bestimmtes gerichtet. »Ich bleibe dabei. Das mit der Dienstwohnung in der Anlage ist etwas, das wir wirklich in Erwägung ziehen sollten.«
»Nur über meine Leiche.« Jochen blickte René scharf an. Er wusste, auch wenn das Thema eher scherzhaft behandelt wurde, dass René, sollte der Plan jemals in die Tat umgesetzt werden, die Zentrale nicht mehr verlassen würde. Es grenzte an ein Wunder, dass er es jetzt tat. Es hatte Zeiten gegeben, in denen René im Lager geschlafen oder auf dem Boden seines Büros übernachtet hatte. Jochen war wie alle hier mit Herz und Seele Teil der Aufgabe, die sie hier verrichteten, aber es gab Grenzen. René erwiderte den Blick mit einem verschmitzten Lächeln. Kaum, dass er hinter seinem Schreibtisch Platz genommen hatte, betrat Sahra das Büro. René blickte die blonde Frau erwartungsvoll an.
»Die gute Nachricht ist: Es wurde nichts gestohlen. Alles ist noch da, wo es war. Es sei denn, jemand hat die Kisten aufgebrochen und danach wieder verschlossen und genau da hingestellt, wo sie vorher standen.« Sie warf einen Blick auf ihren Tablet-PC. »Es sind auch alle Angestellten anwesend. Das heißt, alle die hier sein sollen, sind hier.«
René versuchte gar nicht erst, sich etwas vorzumachen. Er blickte Sahra an und wartete geduldig auf die Hiobsbotschaft, die seiner Meinung nach gleich kommen würde.
»Und ich habe den Grund für den Alarm herausgefunden. Eine der Türen war nicht verschlossen. André guckt sich gerade die Überwachungsbilder an. Wir müssen gucken, ob das mit der Tür Zufall ist oder nicht.«
»Wer ist André?«
»André. André Hansen.«
»Oh. Okay.« René hatte sich angewöhnt, den schmächtigen Mann beim Nachnamen zu rufen. Er überlegte. »Welche Tür?«, fragte er schließlich. Sahra blickte kurz auf den Bildschirm.
»Nummer 17. Ist das schlecht?« Die Frage war darauf zurückzuführen, dass René, kaum dass sie die Zahl ausgesprochen hatte, aus seinem Sessel gesprungen war. Ohne eine Antwort schob er sich an ihr vorbei.
»Offensichtlich.« Sahra blickte Jochen an. »Wo führt Nummer 17 hin?«
»Ins Feenland.« Die Müdigkeit war schlagartig aus Jochens Gesicht verschwunden. Langsam setzte er sich in Bewegung und folgte René. Bei Sahra angekommen, hielt er kurz inne.
»Sag Hansen, er soll sich beeilen mit den Aufnahmen. Wenn er Hilfe braucht, soll er es sagen.«
»Okay.«
Beide setzten sich in Bewegung, Sahra in Richtung Sicherheitsbüro, Jochen in Richtung Lager. Dort angekommen, ging Jochen langsam auf René zu.
»Keinen Schritt weiter.«
Jochen blieb gehorsam stehen und beobachtete René, wie er in einiger Entfernung von dem Tor auf dem Boden hockte und mit gerunzelter Stirn den Blick hin und her schweifen ließ. Das Tor war geschlossen worden, nachdem der Alarm ertönt war.
»Was glaubst du?«, fragte Jochen.
»Keine Ahnung. Aber ich will nicht, dass wir irgendwelche Spuren verwischen, indem hier eine Horde Neugieriger herumtrampelt.«
Jochen nickte. Der Übergang, vor dem sie hockten, beziehungsweise standen, führte zu der Welt, aus der die Pixies stammten. Jedoch waren die kleinen Feen nicht das Problem. Die Welt wurde von so ziemlich allen sagenhaften Rassen bewohnt, die man sich nur vorstellen konnte. Die gefährlichsten waren die Elfen. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als ob die Allianz von Orks, Feen und Trollen die Elfen dazu bewegen könnte, sich zurückzuziehen, jedoch zog sich der Krieg nun schon mehrere Jahre hin. Elfen waren, entgegen der landläufigen romantischen Meinung, eine marodierende Rasse, die es offensichtlich nicht einsah, selbst zu arbeiten und die stattdessen andere Welten überfiel und ausplünderte. Da sie deutlich magischer waren als andere Völker, standen ihnen Mittel zur Verfügung, die eine Gegenwehr sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich machte.
Das Gefährlichste an ihnen war die Fähigkeit, andere Lebewesen zu bezirzen, so dass man alles tun wollte, diesen Wesen zu helfen, alles tat, um ihnen zu gefallen. Es ging stellenweise so weit, dass man sich bereitwillig opferte und gegen seine eigenen Verbündeten wandte, nur um diesem Drang nachzugeben. Darüber hinaus waren die Elfen, auch wenn sie von außen her nicht den Eindruck machten, extrem zäh. Nach dem, was die Pixies berichtet hatten, war nicht einmal sicher, ob man einen Elfen wirklich dauerhaft töten konnte. René hatte mehrere schlaflose Nächte damit verbracht, sich vorzustellen, was passieren würde, wenn Elfen in diese Welt gelangten und die richtigen Leute unter ihren Einfluss brachten.
»Glaubst du, dass … es welche von ihnen waren?«, fragte Jochen schließlich. Der Grund für die Nichtnennung des Namens lag darin begraben, dass Elfen die Fähigkeit hatten, zu spüren, wenn man von ihnen redete. Je häufiger das Wort Elfe in einer Welt fiel, desto mehr fühlten sie eine Verbindung zu dieser Welt, oder, wie René es ausdrückte, zu ihrem nächsten Raubzug. Aus diesem Grund hatten sie sich angewöhnt, von 'den anderen', 'du weißt schon wer' oder auch 'die blöden Mistviecher' zu reden. René blickte auf und überlegte kurz. Dann schüttelte er mit dem Kopf.
»Nein. Das passt nicht.«
»Was genau?«
»Alles. Warum sollten sie verschwinden, wenn sie schon hier sind? Außerdem passt die Gewalt nicht. Das ist nicht ihr Stil.« Jochen nickte. Körperliche Gewalt stand, so merkwürdig es klang, sehr weit unten auf der Liste der Vorgehensweisen der Elfen. Keine Frage, sie waren dazu imstande und setzten sie auch regelmäßig ein, wenn es darum ging, die Bevölkerung der jeweiligen Welt zu versklaven, aber um Fuß in einer neuen Welt zu fassen, standen ihnen andere, weitaus effektivere Möglichkeiten zur Verfügung. Als allererstes hätten sie versucht, die Belegschaft von OMMYA unter ihre Kontrolle zu bringen. René blickte sich aufmerksam in der näheren Umgebung des Tores um, schüttelte dann erneut den Kopf. Dann strich er mit dem Finger über den Boden und betrachtete seine Fingerspitze.
»Was ist das?«
»Feenstaub. Das Zeug wirkt zwar nicht besonders lange, aber man kann es noch ein paar Stunden lang sehen.«
Jochen schnaubte. »Ich glaube, es gibt keine zwei Quadratmeter hier, in denen das Zeug nicht liegt.
»Ich weiß«, meinte René. »Aber das meinte ich nicht. Es ist kein frischer Staub.« Er blickte Jochen an. »Keine Pixies. Bleiben noch Trolle, Oger, Goblins und Orks.«
»Sicher?«
»Nein. Nicht wirklich.«
»Christopher meinte, die … Individuen hatten menschliche Größe.«
»Na super«, kommentierte René. »Dann bleiben Orks, Goblins und kleine Oger. Und die Anderen können wir auch nicht hundertprozentig ausschließen.« René stand auf und wischte sich den Staub von der Hose. Dann ging er vorsichtig zurück, um so wenig Spuren wie möglich zu verwischen. Sein Telefon klingelte.
»Was ist?«, fragte er ungehalten.
»Wir haben ein Problem«, erklang Sahras Stimme aus dem Lautsprecher.
»Ach nee.«
»Kommt mal hoch. Beide.«
René steckte das Telefon ein und bedeutete Jochen, ihm zu folgen. Den fragenden Blick seines Kollegen beantwortete er mit einem stummen Schulterzucken. Als sie schließlich die Zentrale betraten, hatten sich alle ranghöheren Mitarbeiter bereits eingefunden und standen in einem lockeren Halbkreis um den großen Bildschirm herum, der die Zentrale dominierte. Sophia war ebenfalls anwesend, und auch, wie René registrierte, Honk. Er fühlte sich noch nicht bereit dafür, wusste aber, dass ein intensives Gespräch mit dem Wachmann bevorstand. Wäre er auf seinem Posten gewesen, wäre es der Gruppe höchstwahrscheinlich nicht gelungen, die Zentrale zu verlassen. Honk konnte nicht nur Schläge austeilen, die einen normalen Menschen zu Kleinholz verarbeiten würden, es war praktisch unmöglich, ihn außer Gefecht zu setzen. Allerdings war auf dem Gesicht des Wachmannes allzu deutlich das schlechte Gewissen zu erkennen, als René ihm einen kurzen Blick zuwarf.
René richtete seine Aufmerksamkeit auf den Bildschirm. Normalerweise waren darauf die Meldungen zu sehen, die regelmäßig hereinkamen, jetzt jedoch war darauf das Bild der Überwachungskamera im Lager zu sehen, die den Abschnitt filmte, in dem sich die Tür befand, vor der er und Jochen eben noch gestanden hatten. Noch bevor René oder Jochen eine Frage stellen konnten, zeigte Sahra auf den Bildschirm. Das eingefrorene Bild erwachte zum Leben, wenn auch der einzige Unterschied der Zeitstempel war, der jetzt weiterlief. Sahra hielt das Bild kurz an und zoomte den Ausschnitt heran. Man musste schon genau hinschauen, um es zu sehen, aber in der Vergrößerung war deutlich zu erkennen, dass die Tür nicht geschlossen war. Sie stand nur ein winziges Stück offen, aber genug, um es mit dem bloßen Auge zu erkennen, wenn man wusste, wonach man Ausschau halten musste.
»Das ist fünf Minuten, bevor die Gruppe hier eingedrungen ist«, erklärte Sahra. Kaum hatte sie den Satz beendet, erlosch das Licht auf dem Bildschirm. Nur die Zeitanzeige deutete darauf hin, dass sie nach wie vor einen Film sahen und nicht auf einen toten Bildschirm starrten. Dann jedoch erklangen Geräusche. Ein Scharren war zu hören, sowie das leise Knarren, als sich die Tür langsam aber sicher öffnete. René glaubte, ein Flüstern zu hören, war sich aber nicht sicher. Dann entfernten sich die Geräusche und schließlich hörten sie das charakteristische Zischen und anschließendes Poltern der Tür, die vom Lager in die Zentrale führte. Sahra hielt das Bild an.
»André geht die Bilder durch, um zu sehen, seit wann genau sie offen stand«, erklärte sie. René blickte angespannt auf den Bildschirm.
»Und bevor du jetzt was sagst«, meinte Jochen von der Seite, an René gewandt, »es ist nicht deine Schuld.« Der Blick, mit dem René antwortete, zeigte deutlich, was er von dieser Aussage hielt.
»Wahrscheinlich sind fünfundzwanzig Leute an der Tür vorbeigelaufen, ohne zu bemerken, dass sie offen stand. Wenn ich nicht gewusst hätte, wonach ich suche, hätte ich das nicht einmal auf dem Film erkannt.« Sahra wusste, ebenso wie Jochen und alle anderen hier, wie sehr Renés Pflichtbewusstsein manchmal übertriebene Formen annahm. Sicher, er war streng genommen verantwortlich für die Geschehnisse bei OMMYA, aber keiner außer ihm selbst erwartete, dass er alles voraussehen konnte.
»Der Alarm hätte ausgelöst werden müssen, sobald die Tür geöffnet wurde.« René blickte fragend in die Runde. »Dafür ist er da, oder?« Ein humorloses Lachen erklang von Christopher.
»Ja«, meinte er. »Hat großartig funktioniert.«
»Fehlfunktion?«
Sahra schüttelte mit dem Kopf. »Glaube ich nicht«, entgegnete sie. »Aber ich werde die Protokolle durchgehen.«
»Ich hab eine Idee.« René ging zu dem nächsten Mitarbeiter, der sich nach einer kurzen Unterhaltung in Richtung Lager entfernte. Fragende Blicke wurden durch den Raum geworfen. René schaltete den Bildschirm auf Echtzeit. Schweigend warteten sie, bis der Mitarbeiter auf dem Monitor erschien. Keine Sekunde, nachdem er die Tür geöffnet hatte, erklang der Alarm, der darauf hindeutete, dass einer der Übergänge manipuliert worden war. René tippte etwas auf der Konsole vor sich ein, und der Alarm verstummte.
»Funktioniert einwandfrei. Jetzt.« Er ließ seinen Blick über die versammelten Personen wandern. Dann wandte er sich erneut der Konsole zu und tippte eine Zeitlang darauf herum. Kaum, dass der Mitarbeiter wieder aus dem Lager erschienen war, erklang das Rumpeln der Schotts, die sich langsam schlossen. Als das letzte Donnern abgeebbt war, erklang eine weibliche Stimme.
SYSTEM GESICHERT
»Was soll das denn jetzt?«, fragte Sophia, ehrlich verwirrt.
»Die Anlage befindet sich im gesicherten Modus«, antwortete René, ohne die Ärztin dabei anzugucken. »Und solange nicht klar ist, was hier genau passiert ist, wird sie das auch bleiben.« Dann wandte er sich um und ging langsam in Richtung seines Büros.
»Was soll das heißen?« Sophia wandte sich verwirrt an die übrigen Personen.
»Das heißt«, meinte Jochen, während er René hinterher blickte, »dass hier keiner rein oder raus kommt, bis die Sache geklärt ist.« Er lächelte kurz. »Ich hoffe, Sie haben Ihre Zahnbürste dabei.«
»Hey!«, schallte Renés Stimme durch den Raum. »Heute noch!«
Langsam aber sicher setzten sich Jochen, Sahra und Christopher in Bewegung.
»Ich glaube, die Einladung galt auch für Sie«, erklärte Jochen, nachdem die Ärztin keine Anstalten gemacht hatte, sich vom Fleck zu bewegen. Sie blickte sich um, jedoch schien niemand die Vorkommnisse merkwürdig zu finden oder Anstoß daran zu nehmen, dass gerade die komplette Belegschaft festgesetzt worden war. Sie atmete tief durch und folgte langsam der kleinen Gruppe.