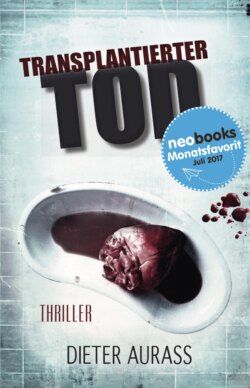Читать книгу Transplantierter Tod - Dieter Aurass - Страница 12
Kapitel 6
ОглавлениеZehn Minuten später saß Eduard mit Gwendolyn in einer ruhigen Ecke der Bar des Atlantic Kempinski. Es war sein Vorschlag gewesen, denn in seinem Zimmer hatte er sich alleine mit dieser Frau sehr unsicher gefühlt. Es war sonst nicht seine Art, sich von Frauen verunsichern zu lassen, weder von besonders starken, noch von besonders hübschen Frauen. Mit Gwendolyn Ahlsbeek war das etwas anderes. Schon nach wenigen Worten war er sich sicher, dass sie nicht nur die attraktivste Frau war, die er je gesehen hatte, sondern auch eine der intelligentesten, mit der er sich je unterhalten hatte.
Ihre Stimme hatte ihn zusätzlich verunsichert. Sie hatte eine höchst angenehme dunkle Alt-Stimme, die rauchig und ... er musste es sich eingestehen ... in höchstem Maße sexy klang. Er hatte sich gezwungen gesehen, aus der Suite zu flüchten, unter Leuten zu sein, auch wenn sie in der Bar eine ruhige Ecke angesteuert hatten. Es war dennoch Öffentlichkeit, die ihn sicher sein ließ, dass er keinen Blödsinn veranstalten würde.
Sie hatte ihn gebeten, sie Gwen zu nennen, was er natürlich nicht ablehnen konnte. Im Gegenzug hatte er sie gebeten, ihn Eddy zu nennen, was sie mit diesem unglaublichen Lachen quittiert hatte, das so gar nicht lächerlich klang.
»Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Eddy? Ich glaube, Eduard sagt mir eher zu. Eddy klingt irgendwie nach einem Kleinkriminellen. Oder hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie Ed nenne?«
Es zeugte von seinem desolaten Zustand, dass er diesem Vorschlag ohne zu zögern zustimmte, obwohl er sich bisher immer vehement geweigert hatte, diese Abkürzung seines Namens zu akzeptieren. Als Fan von amerikanischen Comedy-Serien aus den Sechzigern erinnerte ihn dieser Name zu sehr an die von ihm so geliebte Serie »Mister Ed, das sprechende Pferd«.
Aber so, wie er an ihren Lippen hing, hätte sie ihm vermutlich vorschlagen können, ihn »Pony« zu nennen ... und er hätte genauso bedenkenlos zugestimmt.
Nur zu gerne hätte Eduard in dieser Situation etwas Stärkeres als stilles Mineralwasser getrunken, zumal er zusehen musste, wie Gwen sich einen sechzehn Jahre alten irischen Single-Malt-Whisky bestellte und ihn mit Genuss in sehr kleinen Schlucken trank. Er überlegte, wer von ihnen das Gespräch beginnen sollte und mit welchem Thema. Ihm schwirrten so viele Fragen durch den Kopf, andererseits hatte er seine Vermutungen, was die seltsamen Gedanken und Geschmacksveränderung anging ... aber wo anfangen?
Es war Gwen, die die Initiative ergriff und ihren Gedankenaustausch einleitete.
»So ... Sie tragen also das Herz meines großen Bruders in Ihrer Brust. Darf ich fragen, warum Sie uns aufgesucht haben und wie sie uns ausfindig machen konnten?«
Das waren zwar gleich zwei ganz unterschiedliche Fragen, aber er wollte die Sache langsam angehen und nicht sofort alle Karten auf den Tisch legen.
»Ich denke, es ist nachvollziehbar, dass der Empfänger eines Spenderorgans mehr über den Spender erfahren möchte. Der Umstand, dass Ihr Bruder die gleiche sehr seltene Blutgruppe und Gewebemerkmale hatte wie ich und dann auch noch in so unmittelbarer zeitlicher Nähe zu meinem Herzinfarkt verstorben ist, kann einem schon zu denken geben. Meine Aussichten ein Spenderherz zu bekommen, waren so gering, dass ich bereits mit dem Leben abgeschlossen hatte. Um so mehr interessiert mich das Leben, aber auch der Tod Ihres Bruders. Ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass Sie überhaupt mit mir sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr belastend für Sie ist.«
Sie blickte ihn lange und schweigend an, bevor sie etwas erwiderte. Kurzzeitig hatten sich Tränen in diesen wunderschönen grünen Augen gebildet, die sie allerdings hastig wegwischte.
»Wo soll ich da anfangen?« Sie schüttelte verzweifelt den Kopf, wartete aber keine Antwort ab. »Zuallererst mal wundert es mich, dass mein Bruder überhaupt als Spender in Frage kam.« Sie sah Eduard zum wiederholten Male prüfend von oben bis unten an.
»Sie ähneln sich so unsagbar wenig, dass ich das nie für möglich gehalten hätte.«
Bevor er eine entsprechende Frage überhaupt stellen konnte, zog sie ein Smartphone aus ihrer Handtasche, entsperrte den Bildschirm und reichte es ihm.
»Sehen Sie sich die Bilder an, dann wissen Sie, was ich meine.«
Eduard blätterte durch die Bildergalerie, die ausschließlich Fotos von Liam Ahlsbeek enthielt. Bilder aus allen Lebenssituationen: alleine, zusammen mit seiner Schwester, beim Sport, am Schreibtisch, mit der Familie vor einem Weihnachtsbaum, in einer Kneipe mit anderen Leuten seines Alters. Sie zeigten einen jungen Mann, der tatsächlich rein gar nichts mit Eduard gemein hatte. Er war, wenn er seine Größe von den Bildern mit seiner Schwester schätzte, etwa 1,75 groß, sehr muskulös, hatte ein offenes Lachen, konnte aber auch sehr ernst und traurig in die Welt blicken. Der krasseste Unterschied zu Eduard waren seine pechschwarzen Haare, die er glatt und halblang getragen hatte und die gleichen grünen Augen, die seine Schwester und Mutter auszeichneten. Dabei war er wie seine Schwester von einer fast krank wirkenden Blässe.
Nachdenklich gab er Gwen das Smartphone zurück.
»Sie haben Recht, äußerlich hätten wir wirklich kaum unterschiedlicher sein können. Aber was war er für ein Mensch? Was hat er gemocht, was hat er gehasst, und was hat er mit seinem Leben angefangen?«
Gwendolyns Augen begannen sich wieder mit Tränen zu füllen und ihre Oberlippe zitterte merklich.
»Wenn es Ihnen zu viel ist, Gwen, dann lassen Sie uns das Gespräch verschieben. Ich muss das alles nicht unbedingt heute wissen, nachdem ich nun schon zwölf Wochen auf Antworten warte.«
Er legte sachte seine Hand auf ihren Arm und fragte sich, ob er sie in den Arm nehmen sollte. Besser nicht, entschied er sich, sie könnte es missverstehen.
Sie schloss die Augen und schüttelte fast unmerklich den Kopf. Dann schnaubte sie durch die Nase und schien sich wieder gefasst zu haben.
»Sie sagen es völlig zu Recht, es ist nun zwölf Wochen her und ich muss mich der Realität stellen. Wenn Sie darauf warten wollten, bis es nicht mehr wehtut, wenn ich an Liam denke, von ihm spreche oder sein Foto sehe, dann können Sie vermutlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Wenn ich etwas erreichen will, muss ich auch in der Lage sein, über ihn zu sprechen.«
»Was möchten Sie denn erreichen?«
Sie sah ihn erstaunt an. »Für einen Journalisten haben Sie eine ziemlich langsame Auffassungsgabe, Ed, da hätte ich mehr erwartet. Selbstverständlich will ich den Mord an meinem Bruder aufklären. Ich will wissen, wer das getan hat, und dann ...«
Sie ließ offen, was dann sein würde, aber aus ihrem Blick schloss er, dass sie nicht an eine Übergabe an die Polizei dachte. Allerdings hatte sie seine journalistische Neugier in eine bestimmte Richtung gelenkt, und die unterschied sich nicht wesentlich von dem Wissensdurst eines Kriminalisten.
»Woraus schließen Sie, dass Ihr Bruder ermordet wurde ... und was meint die Polizei dazu?«
»Zum Thema Polizei muss ich mich zurückhalten, sonst sage ich vermutlich etwas, dass gegen mich verwendet werden kann. Ich halte nicht wirklich große Stücke auf unsere verbeamteten Gesetzeshüter.« Ihr Blick verdüsterte sich wieder. »Warum mein Bruder sich nicht selbst getötet hat, kann ich Ihnen sehr deutlich sagen. Erstens hätte Liam das niemals getan, ohne mir und unserer Mutter einen Abschiedsbrief zu hinterlassen, und zweitens hatte er keinen Grund. Er hatte seit einem halben Jahr eine neue Freundin und es lief gut mit ihr. Er hat mir viel von ihr vorgeschwärmt. Außerdem hatte er gerade wieder Frieden mit unserem Vater geschlossen und sogar ein Praktikum in der Firma angefangen. Also hatte er insgesamt genau das Gegenteil eines Grundes für eine Selbsttötung. Das ist absolut abwegig.«
Sie hatte sich langsam aber stetig in Rage geredet, zwischendurch immer wieder verächtlich geschnaubt und energisch den Kopf geschüttelt. Wären die Umstände und der Sachverhalt nicht so traurig gewesen, hätte es ihn enorm angeturnt, wie sie sich echauffierte. So aber verstand er ihre Aufregung und hatte eher Mitleid aufgrund ihrer Situation.
»Warum genau bezweifeln Sie die Auffassung der Polizei?«
»Haben Sie mir nicht zugehört?« Sie wurde lauter, als es in der Bar angebracht war und Eduard signalisierte ihr, etwas leiser zu sein. »Egal was die Polizei sagt, aus den genannten Gründen kann es kein Selbstmord gewesen sein. Niemals! Punkt!«
Er war geneigt, ihr zu folgen, aber nicht, weil ihn ihre Argumente absolut überzeugt hätten. Für einen fehlenden Abschiedsbrief konnte es viele Gründe geben, und das angebliche Glück mit der neuen Freundin musste auch nicht die Realität dargestellt haben. Das brachte ihn zu dem, was er nicht wusste, aber gerne wissen wollte. Es war an der Zeit, ihr mehr zu erzählen.
»Sie hatten mich gefragt, wie ich herausgefunden habe, dass Ihr Bruder der Spender des neuen Herzens war. Dazu muss ich Ihnen etwas erzählen.« Er blickte auf seine Uhr und stellte fest, dass es inzwischen 19:00 Uhr war, also noch etwa eine Stunde Zeit blieb, bis Benjamin hier auftauchen würde. Angesichts ihrer Einstellung zur Polizei hatte er keine großen Bedenken, ihr die Wahrheit über Bens Aktivitäten zu berichten, ohne Angst haben zu müssen, dass sie mit diesen Informationen gleich zu den Behörden laufen würde.
Also erzählte er ihr von Ben, von seiner Mitgliedschaft im Chaos Computer Club und seinen Hackeraktivitäten, die er für ihn in Angriff genommen hatte. Ihre Augen wurden immer größer und Eduard hatte Schwierigkeiten, sich auf seine Schilderung zu konzentrieren. Als er ihr schließlich erzählte, dass Ben gegen 20:00 Uhr ins Hotel kommen würde, um ihn zu treffen, war ihre Reaktion eine andere, als er erwartet hatte.
»Wow, da bin ich wirklich gespannt, Ihren Freund kennenzulernen. Er muss wirklich gut sein, wahrscheinlich sogar besser, als Sie es sich vorstellen können. Ihnen fehlt nämlich der Vergleich.« Sie grinste. »Ich weiß, dass mein Vater die für ihn arbeitenden IT-Spezialisten beauftragt hatte, genau das herauszufinden, was ihr Freund Ihnen geliefert hat, ... und die haben Fehlanzeige gemeldet. Angeblich sei die Datenbank von EUROTRANSPLANT so gut geschützt, dass es unmöglich sei, sie zu hacken. Es wird mir eine Freude sein, Ihren Hackerfreund kennenzulernen.«
Sie legte den Kopf kurz überlegend zur Seite, bevor sie weitersprach. »Vielleicht kann er uns ja den Zugang zu den Unterlagen und Erkenntnissen der Polizei verschaffen.«
»Ihnen ist klar, dass das in höchstem Maße illegal wäre, oder?«
»Illegaler, als die Datenbank von EUROTRANSPLANT zu hacken? Machen Sie sich nicht lächerlich. Haben Sie Angst, erwischt zu werden? Wo ist Ihr sportlicher oder wenigstens Ihr journalistischer Ehrgeiz, Ed?«
Sie hatte natürlich Recht und punktgenau seine einzige Schwäche gefunden: Angst bei etwas Illegalem erwischt zu werden. Aber er wollte dieses Thema nicht weiter vertiefen, dafür war noch genug Zeit, wenn Benjamin an dem Gespräch teilnahm. Also wechselte er das Thema.
»Was ist aus der Freundin Ihres Bruders geworden? Was sagt sie zu Ihrer Theorie? Ist sie der gleichen Meinung?«
Gwendolyns Blick verdüsterte sich und eine Zornesfalte bildete sich auf ihrer Stirn.
»Das ist auch ein Grund, warum ich der Polizei weder traue, noch ihr viel zutraue. Thi Bian ist seit dem Tod meines Bruders wie vom Erdboden verschluckt.«
»Wer?«
»Thi Bian, oder genauer gesagt, Pham Thi Bian, die thailändische Freundin meines Bruders. Die Polizei misst dem keine große Bedeutung bei und führt es der Einfachheit halber darauf zurück, dass sie sich illegal in Deutschland aufgehalten haben muss, denn sie können keine Unterlagen bei der Ausländerbehörde über sie finden. Sie gehen einfach davon aus, dass sie nach dem angeblichen Selbstmord abgehauen oder untergetaucht ist.«
Das waren eine Menge neuer Informationen, die zusätzliche Rückschlüsse, aber auch Rechercheansätze boten. Eduard vertagte das weitere Nachdenken darüber auf den Moment, wenn Benjamin sich zu ihnen gesellen würde. Aber ihm geisterte noch etwas anderes in seinen Gedanken herum, das er erst nicht fassen konnte. Gwendolyn hatte etwas gesagt, zu dem er unbedingt hatte nachfragen wollen. Was war das noch gewesen? Er ließ den Verlauf der Unterhaltung noch einmal vor seinem geistigen Auge ablaufen. Natürlich, das war’s!
»Sie hatten vorhin erwähnt, dass ihr Bruder wieder Frieden mit Ihrem Vater geschlossen hat. Also muss es zuvor ein Zerwürfnis gegeben haben. Darf ich fragen, was da los gewesen war?«
»Hören Sie nur auf solche blöden Worthülsen zu benutzen.« Sie schien verärgert zu sein. »Darf ich fragen«, äffte sie ihn nach, »was für ein Blödsinn. Wenn ich nicht rückhaltlos mit Ihnen zusammenarbeite, habe ich wohl kaum eine Chance, den Grund für den Mord an meinem Bruder herauszufinden. Außerdem wäre ich dann nicht hier und unterhielte mich mit Ihnen. Also, Sie dürfen nicht nur fragen, Sie müssen sogar.«
In der folgenden Viertelstunde beschrieb sie ihm in allen Einzelheiten, warum ihr Vater und Liam sich überworfen hatten. Liam war nach ihrer Beschreibung schon immer ein aufrührerischer Freigeist gewesen, der sich vor allem den Familienzwängen widersetzt hatte. Seine Vorlieben waren die Musik und - ich war erneut mehr als erstaunt - sein Studium der Germanistik und des Journalismus gewesen. Als er sich geweigert hatte, als einziger männlicher Erbe in die Firma einzutreten, hatte sein Vater ihn hinausgeworfen und sie hatten zwei Jahre lang kein Wort miteinander geredet. Liam musste ein begnadeter Pianist gewesen sein, und sogar eine Zeitlang mit dem Gedanken gespielt haben, dies zu seinem Beruf zu machen.
Eduard überlegte an dieser Stelle ihrer Schilderung, auf seine seltsamen Geschmacksveränderungen zu sprechen zu kommen, verwarf den Gedanken aber. Schon bei der Erwähnung von Liams asiatischer Freundin waren ihm seine Träume von einer Asiatin in den Sinn gekommen, und er hatte es als zu früh angesehen, Gwendolyn davon zu erzählen.
»Aber er hatte seine Träume von der Journalistenkarriere noch nicht vollständig aufgegeben«, riss ihre rauchige Stimme ihn aus seinen Gedanken. »Erst vier Wochen vor seinem Tod hat er mir davon erzählt, dass er durch Zufall einer wirklich großen Geschichte auf der Spur sei, mit der er sich einen Namen in der Branche machen würde. Er war ziemlich aufgeregt, wollte mir aber nicht mehr erzählen.«
»Vielleicht hat das ja etwas mit seinem Tod zu tun?«, stellte Eduard eine wilde Vermutung auf.
»Also glauben Sie mir jetzt, dass Liam ermordet wurde?«
»Ich glaube vorläufig noch gar nichts, das hat sich in der Vergangenheit als bessere Ausgangsbasis für Nachforschungen gezeigt. Lassen Sie uns warten, bis mein Freund Benjamin zu uns stößt, dann können wir Pläne für die weitere Vorgehensweise machen.«