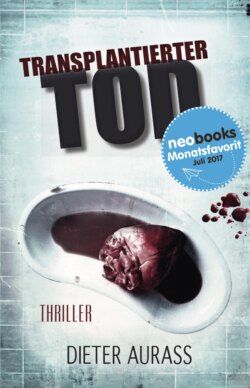Читать книгу Transplantierter Tod - Dieter Aurass - Страница 9
Kapitel 3
ОглавлениеNach der Eröffnung des behandelnden Arztes, dass ihm nicht mehr viel Zeit bliebe, er aber auf der Transplantationsliste von EUROTRANSPLANT stände, ergab sich die naheliegende Frage bereits am nächsten Tag. Da er noch keine Gelegenheit hatte, jemanden damit zu beauftragen, ihm seine Arbeitsutensilien - den Laptop und die erforderliche Hardware, um auch an diesem Ort im Internet zu surfen - vorbeizubringen, blieb ihm keine andere Möglichkeit, als jemandem die Frage zu stellen, die ihm am meisten auf der Seele brannte.
Wie lange war die durchschnittliche Wartezeit, bis man von EUROTRANSPLANT mit einem passenden Herzen bedient wurde?
Wie es wahrscheinlich jeder in einer vergleichbaren Situation wie seiner getan hätte, fragte er die erste Person, die ihm am Morgen zu Gesicht kam: die Krankenschwester.
Diesmal handelte es sich um eine jüngere Version der Schwester vom Vortag, an deren Namen er sich beim besten Willen nicht mehr erinnern konnte. Die recht unattraktive junge Dame hieß laut Namensschild Ming-Tra, war offensichtlich asiatischer Herkunft, sprach aber ein sehr gutes Deutsch.
»Schwester Ming-Tra, darf ich Sie etwas fragen?«
»Aber natürlich. Was möchten Sie wissen?«
»Wie lange muss man durchschnittlich warten, bis man ein Spenderorgan bekommt?«
»Das ist ganz unterschiedlich, aber so im Schnitt ...«, sie nahm sein Krankenblatt aus der Halterung am Fußende des Bettes und warf einen Blick darauf, »... oh ... äh ... also so genau kann ich Ihnen das doch nicht beantworten. Warten Sie lieber, bis der Doktor um 10:00 Uhr zur Visite kommt, und fragen Sie ihn am besten dann direkt.«
Sie hatte es plötzlich sehr eilig, sein Zimmer zu verlassen, was er als schlechtes Zeichen wertete.
Es fiel ihm erwartungsgemäß schwer, die Wartezeit bis zur Visite durchzustehen, aber schließlich war der Zeitpunkt gekommen und der Oberarzt betrat erneut das Krankenzimmer mit seiner gesamten Mannschaft im Gefolge.
»Auf ein Wort, Herr Doktor. Sie sind mir noch eine wichtige Auskunft schuldig.« Er wollte ihm bewusst keine Zeit lassen, ihn mit dem üblichen »na, wie geht’s uns denn heute?« Geschwätz von der drängendsten Frage abzulenken, die ihm auf der Seele brannte. Der Arzt sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen fragend an.
»Wie lange ist im Durchschnitt die Wartezeit auf ein passendes Spenderherz?«
Sein Blick und die zusammengepressten Lippen sprachen Bände, aber der Arzt rang sich schließlich durch und gab ihm Antwort.
»Im Durchschnitt etwa sechs bis zwölf Monate, das kommt darauf an.«
Gar keine schlechte Chance, bei einer prognostizierten Restlebensdauer von sechs bis neun Monaten. Erst nach einigen Sekunden drang die gesamte Antwort weit genug in sein benebeltes Gehirn ein, um alle Implikationen verstehen zu können.
»Auf was kommt es an? Bitte werden sie ein wenig spezifischer.«
Eduard hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Doktor bekam wieder diesen unsteten Blick und hätte sich am liebsten um die Antwort gedrückt.
»Äh ... nun ja ... vor allem auf die Kompatibilität, die zum Beispiel sehr stark von der Blutgruppe abhängig ist.«
»Welche Blutgruppe habe ich?«
Für solche Themen hatte er sich als relativ junger Mensch bisher noch nicht wirklich interessiert und es hatte bis zu diesem Tag niemals die Notwendigkeit bestanden, seine eigene Blutgruppe zu kennen. Eduard fiel auf, dass auch die Begleiter des Oberarztes alle in irgendwelche Richtungen blickten, nur nicht in seine.
»AB positiv«, presste der Weißkittel schließlich zwischen zusammengepressten Kiefern durch.
Als würde ihm diese medizinische Ausdrucksweise in irgendeiner Form weiterhelfen.
»Und was bedeutet das genau?«
»Die ist leider ziemlich selten.«
»Wie selten?« Er hatte es langsam leid, dem Mediziner alle Würmer aus der Nase ziehen zu müssen.
»Etwa vier Prozent der deutschen Bevölkerung haben diese Konstellation.«
Er musste Eduards entsetzten Blick bemerkt haben, als sich dessen Gedanken überschlugen, während er die Prozentzahl in eine Chance umzurechnen versuchte, weshalb er unnötigerweise nachsetzte.
»Aber Sie haben noch Glück im Unglück. Sie hätten auch die allerseltenste Kombination haben können, AB negativ, die haben nur ein Prozent der Bevölkerung.«
Was für eine Erleichterung. So ein Glück. Eduard legte den Kopf ein wenig schief und sah ihn an, wie man einen Komiker betrachten würde, der einen Witz gemacht hatte, über den beim besten Willen niemand lachen konnte. »Sie würden vermutlich einem zum Tode durch den elektrischen Stuhl Verurteilten noch einen Vortrag über den Segen der Elektrizität halten, was? Sagen Sie mir, wie bei den Patienten mit dieser Blutgruppe die durchschnittliche Wartezeit ist, oder muss ich den Klinikleiter anrufen?«
»24 bis 36 Monate«, kam es sehr leise und gepresst aus seinem Mund.
Das war nun endgültig sein Todesurteil, daran hatte er nicht den geringsten Zweifel.
Überraschenderweise blieb ihm kaum Zeit, mit seinem schlimmen Schicksal zu hadern, denn es überforderte ihn schon, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Wie geht man mit seiner Habe um, wenn man niemanden hat, dem man sie vererben kann? Was sollte eine soziale Einrichtung mit seinem Laptop, seinem Computer, seiner Stereoanlage oder der Sammlung von Science-Fiction-Heften anfangen? Möbel und Kleidung war sicherlich unter die Leute zu bringen, aber seine persönlichen Sachen? Seine Reiseandenken, die Fotos von Urlaubsorten, die Ordner mit seinen Artikeln und den Recherchen. Würde sein ganzes bisheriges Leben zuerst in einem Müllcontainer und schließlich auf einer riesigen Müllkippe landen?
Erstmals wurde ihm bewusst, wie alleine auf der Welt er tatsächlich war. Seine Eltern waren gestorben, als er erst siebzehn war. Er hatte keine Geschwister und seine Eltern hatten ebenfalls keine Geschwister gehabt, weshalb ihm auch Onkel, Tanten, Cousins oder Cousinen fehlten. Was blieb da noch? Arbeitskollegen und Kumpel vielleicht. Da er zeit seines Lebens immer ein Einzelgänger gewesen war, als freier Journalist nicht in einer Redaktion gearbeitet und den Kontakt zu seinen Studienkollegen nie gepflegt hatte, fehlten ihm nun jegliche sozialen Kontakte, wie ein normaler Mensch sie zu Dutzenden hatte. Diese Erkenntnis brachte ihn fast mehr zur Verzweiflung als der Umstand, dass sein Leben in einigen Monaten enden sollte.
Seit der niederschmetternden Diagnose waren gerade einmal drei Wochen vergangen und er befand sich gerade in einer Phase tiefster Depression, als ihn ein Anruf erreichte, der ihn sofort in das Münchner Transplantationszentrum berief.
»Umgehend und ohne jede Verzögerung«, war der genaue Wortlaut gewesen, was in ihm die Hoffnung weckte, dass der Grund keine neuerliche Untersuchung war, sondern vielleicht tatsächlich ein neues, für ihn gefundenes Herz sein könnte.
Nur sieben Stunden später schlug ein neues Herz in seiner Brust. Es als neu zu bezeichnen, entsprach zwar nicht ganz den Tatsachen, aber er betrachtete es als für sich neu, auch wenn das Herz an sich schon gebraucht war.
Ein gebrauchtes Herz ... alleine der Begriff warf ihn aus der Bahn und schürte jede Menge ungewollter Fragen. Wie gebraucht war es? Wer war der Spender? Was hatte ihm passieren müssen, damit er davon profitieren konnte?
An dieser Stelle seiner Überlegungen musste er sich beschämt eingestehen, dass er nicht nur selbst kein Organspender gewesen war, sondern sich im Vorfeld der Operation noch nicht einmal Gedanken über einen möglichen Spender gemacht hatte. Zu sehr war er von der Überzeugung beeinflusst gewesen, dass er eh sterben würde, bevor der unwahrscheinliche Fall eintreten könnte, dass ein passendes Organ für ihn verfügbar wäre.
Die ersten drei Tage nach der OP dämmerte er in der Intensivstation vor sich hin und im Nachhinein konnte er nicht mehr alle Gedanken rekapitulieren, die ihm in dieser Zeit durch den Kopf gegangen waren. Als er am fünften Tag wieder aufstehen konnte und erste Übungen machen musste, arbeitete sein Gehirn allerdings auf Hochtouren. All die Gedanken zur Herkunft des Spenderorgans nahmen immer mehr Gestalt an und er musste sich einfach Gewissheit verschaffen.
Also löcherte er unmittelbar, nachdem er dazu in der Lage war, den Professor, der ihn operiert hatte, mit genau diesen Fragen.
»Herr Professor, wer war der Spender meines neuen Herzens?«, hatte er blauäugig gefragt, ohne sich im Vorfeld über die Rechtslage zu informieren.
»Bedaure, Herr von Gehlen, das dürfen wir Ihnen nicht mitteilen. Das Transplantationsgesetz sieht vor, dass eine Organspende für beide Seiten anonym ist.«
»Was heißt ›für beide Seiten‹? Dem Spender können Sie ja nicht mehr mitteilen, wer sein Organ erhalten hat, oder haben Sie als Halbgott einen besonderen Draht nach oben?«
Er hatte den zynischen Tonfall nicht vermeiden können. Der Satz war raus, bevor er darüber nachdenken konnte, ob es klug war, so mit dem Professor zu reden. Aber der schien diesbezüglich glücklicherweise nicht sonderlich empfindlich zu sein.
»Nein, aber den Angehörigen eines Spenders. Selbst einer Ehefrau, Kindern oder Eltern, darf nicht offenbart werden, wer das Organ ihres Angehörigen erhalten hat. Lediglich, dass eine Verpflanzung stattgefunden und ob sie erfolgreich war. Das ist alles.«
»Kann ich erfahren, wie mein Spender ums Leben gekommen ist?«
»Auch das unterliegt der Schweigepflicht. Ich könnte es Ihnen nicht mal sagen, wenn ich wollte, denn die Todesumstände werden von EUROTRANSPLANT nicht mitgeteilt. Was ich weiß, sind die rein medizinischen Daten, die Sie sich eigentlich selbst denken könnten. Der Spender hatte die gleiche Blutgruppe wie Sie, war in etwa im gleichen Alter und das Organ war kerngesund.«
Er machte eine kurze Pause und bemerkte die unübersehbare Enttäuschung, die sich in Eduard breitmachte.
»Sie werden damit leben müssen, dass ein junger Mensch gestorben ist und Sie deshalb weiterleben können.«
Wenn er schon nicht mehr aus ihm herauslocken konnte, so regte sich zumindest seine journalistische Neugier.
»Ist das nicht ein sehr unwahrscheinlicher Zufall, dass so kurz nach meiner Diagnose just im richtigen Moment der passende Spender stirbt?«
Der Professor lachte laut auf und schien sich köstlich zu amüsieren. Erst als er Eduards erbost zusammengezogenen Augenbrauen sah, riss er sich zusammen und würdigte ihn einer Antwort.
»Ich wusste ja, dass Sie Journalist sind, und ich kann mir vorstellen, dass Sie eine blühende Phantasie benötigen, um in Ihrem Beruf weiterzukommen, aber was Sie da andeuten ... nein, nein. Sie brauchen keine Verschwörungstheorien über Organhandel oder ähnlichen Unsinn aufzubauen. Wenn Sie ein Milliardär wären, könnte ich solche Ideen vielleicht noch verstehen, aber in Ihrem Fall ist das nicht nur abwegig, sondern völlig unangebracht. Glauben Sie mir ... Sie haben einfach unheimliches Glück gehabt. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht mal so schlecht, wie auf einen Sechser im Lotto, und Sie wissen ja, jedes Wochenende gibt es einen neuen Lottomillionär. Also seien Sie einfach froh und steigern Sie sich nicht in etwas Unsinniges und nicht Zielführendes hinein.«
Er wandte sie zum Gehen, machte aber in der Tür noch einmal halt, wandte sich um und sah Eduard sehr ernst und nachdenklich an.
»Sollten Sie aber Probleme damit haben, diesen Glücksfall anzunehmen und bedingungslos zu akzeptieren, kann ich Ihnen gerne einen sehr guten Psychotherapeuten empfehlen. Es tut Ihrer Genesung auf keinen Fall gut, wenn Sie in Grübeleien verfallen. Denken Sie mal darüber nach.«
Eduard dachte darüber nach. Als Journalist mit einer schier unstillbaren Neugier, einem Hang zur Detailtreue und einer peniblen Recherche, war er beileibe nicht der Typ, der sich mit einem ›finden Sie sich damit ab‹ zufriedengeben konnte. Je unwahrscheinlicher es erschien, dass Nachforschungen zu einem Ergebnis führen würden, desto reizvoller war ihm stets die Aufgabe erschienen.
Also ging er strukturiert an die Recherche, wie es sich für einen ordentlichen Journalisten gehörte. Zuallererst erforschte er EUROTRANSPLANT, die, wie er herausfand, Stiftung für die ›optimale Verfügbarkeit von Spenderorganen‹. Entgegen der Meinung, die Stiftung agiere europaweit, hatten sich in ihr lediglich die Länder Deutschland, Österreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Slowenien, Kroatien und Ungarn zusammengefunden.
Alle Bedingungen für die Entnahme von Organen und den Umgang mit deren Spendern und Empfängern waren im Transplantationsgesetz (TPG) von 1997 geregelt. Darüber hinaus war er nicht wenig überrascht, dass es ergänzende Gesetze gab, wie zum Beispiel das Gewebegesetz und das Transfusionsgesetz.
Entscheidend für sein Wissensdefizit war der § 14 TPG, der vorschrieb, dass alle Daten über Spender und Empfänger dem Datenschutz unterlagen und somit an niemanden außerhalb des bei Transplantationen handelnden Personenkreises weitergegeben werden durften.
Wenn er seinem Professor Glauben schenken wollte, musste er davon ausgehen, dass selbst das Krankenhaus nicht über die vollständigen Informationen verfügte. Sie erhielten nur die Daten, die sie für eine erfolgreiche Durchführung der Transplantation brauchten. Dazu gehörten leider weder der Name des Spenders noch seine Todesumstände. Sie beinhalteten noch nicht einmal die Nationalität, weshalb es vorstellbar war, dass in seiner Brust nun ein niederländisches oder ungarisches Herz schlug.
Nicht, dass ihm das etwas ausgemacht hätte. Er empfand sich selbst als Europäer und hatte keinerlei pauschalisierende Vorbehalte gegen die Einwohner anderer Länder. Aber es erschwerte die Suche nach dem Spender zusätzlich. Die einzige Stelle, an der er die erforderlichen Informationen mit Sicherheit würde finden können ... war EUROTRANSPLANT. In ihm wuchs eine Idee heran, die sich hauptsächlich auf seine bisherige Arbeit gründete und von der er überzeugt war, dass sie funktionieren könnte. Allerdings benötigte er dazu fremde Hilfe, und er war sich nicht sicher, ob er sie erhalten würde.
Noch bevor er das Vorhaben in Angriff nehmen konnte, machte er jedoch einige sehr erstaunliche und vor allem verwirrende Erfahrungen.
Bereits kurz nach seinem Wechsel von der Intensivstation auf die normale Station hatte er merkwürdige Träume. Es waren keine Sexphantasien, wie sie vermutlich jeder Mann irgendwann mal hatte, sondern eher romantische Träume voller Liebe, Sehnsucht und Hingabe. Seltsamerweise handelten sie von einer Asiatin ... und er hatte noch nie ein spezielles Faible für Asiatinnen gehabt. Es wäre noch erklärbar gewesen, wenn es sich bei der Stationsschwester Ming-Tra um eine hübsche oder besonders attraktive Asiatin gehandelt hätte, was aber nicht der Fall war. Die einzige sonstige Asiatin, mit der er im Krankenhaus Kontakt hatte, war eine Physiotherapeutin, eine Chinesin, die allerdings bereits jenseits der 60 war und noch nicht einmal sonderlich gut aussah.
Diese Merkwürdigkeit alleine hätte ihm nicht so zu denken gegeben, wären da nicht auch noch die ... Geschmacksverwirrungen ... gewesen. Ihm fiel kein besserer Begriff ein, zumal es auf beide Vorkommnisse zutraf, die ihn überraschend ereilten. Das erste Ereignis traf ihn beim Essen der ihm aufgrund seines noch geschwächten Zustandes vorgesetzten Schonkost. Schon als Kind hatte er gedünsteten Rosenkohl gehasst wie die Pest, und daran hatte sich auch mit zunehmendem Alter nie etwas geändert. Als ihm an diesem Tag allerdings der Geruch des Gemüses in die Nase stieg, begann ihm das Wasser im Mund zusammenzulaufen. Überrascht begann er den Rosenkohl zu essen ... und er schmeckte so hervorragend, dass er nicht mehr verstehen konnte, warum er ihn nie gemocht hatte.
Das zweite Vorkommnis ereignete sich, als er zu einer der Physiotherapiesitzungen bei besagter Chinesin antrat. Aus versteckten Lautsprechern in dem Behandlungszimmer drang leise aber deutlich vernehmbare Musik. Unerwarteterweise handelte es sich aber nicht um asiatische Musik oder irgendwelche esoterische Entspannungsklänge, sondern um klassische Musik. Er liebte Rock, Pop und Countrymusik, aber Klassik war noch nie etwas gewesen, was er gerne gehört hatte. Eduard verstand nichts davon, konnte die einzelnen Komponisten nicht voneinander unterscheiden und der Unterschied zwischen einer Sonate und einer Sinfonie war ihm absolut unbekannt. Was dort allerdings in unaufdringlicher Lautstärke an seine Ohren gelangte, gab ihm sofort die Gewissheit, dass es sich um eine Klaviersonate von Wolfgang Amadeus Mozart handeln musste. Er blieb wie angewurzelt stehen und war von der Erkenntnis, dass er dieses Wissen nie bewusst gehabt haben konnte, total überrascht und sogar erschrocken,
Woher kam diese Erkenntnis? Oder war es etwa nur Einbildung und in Wirklichkeit handelte es sich um ein Werk von Beethoven oder Haydn? Hatte er es irgendwann schon mal gehört, vielleicht unbewusst und jemanden sagen hören, dass es sich um ein Stück von Mozart handelt?
»Oh, Sie mögen die Sonate Nr. 17 in B-Dur? Ich liebe die späten Werke von Mozart aus seiner Wiener Zeit. Sind Sie auch ein Kenner?«, riss ihn die Stimme der chinesischen Therapeutin aus seinen Gedanken ... um ihn sofort in noch tiefere Verwirrung zu stürzen.
Was ging hier vor? Woher kamen diese seltsamen Geschmacksverwirrungen? Nicht dass sie ihm unangenehm gewesen wären, im Gegenteil. Aber er erreichte langsam die Grenzen seiner Phantasie. Der absurde Gedanke, es könne etwas mit seinem neuen Herzen zu tun haben, setzte sich in ihm fest und ließ sich nicht mehr verdrängen oder wegleugnen.
Er versuchte vergeblich, sich einzureden, dass es eine andere Erklärung geben musste, als dass er Erinnerungen und Vorlieben des Spenders in sich aufgenommen hatte. Er war belesen genug, um zu wissen, dass die Philosophen des Altertums das Herz als den Sitz der Seele angesehen hatten. Andererseits war er zu sehr wissenschaftlich orientiert, als dass er es nachvollziehen konnte oder auch nur in Betracht ziehen würde.
Sein Wunsch, mehr über den Spender des Organs zu erfahren nahm innerhalb kürzester Zeit fast wahnhafte Züge an. Die Angst, nicht mehr er selbst, sondern eine Mischung aus zwei verschiedenen Menschen zu sein, begann immer stärker an ihm zu nagen. Er musste einfach etwas unternehmen, koste es, was es wolle.
»Ja, wer stört«, drang die näselnde, für einen Mann etwas zu hohe Stimme aus seinem Handy an sein Ohr.
»Ich bin’s, Eddy, hallo Ben. Wie geht’s?«
»Mensch, Eddy, das ist aber schön mal wieder was von dir zu hören. Tja ... mir geht’s gut, wie immer, weißt du doch ... schlechten Menschen geht’s immer gut, hä hä hä. Aber sag mal, wie bist du denn so drauf? Immer noch keine Schnecke gefunden, hä? Ich habe ja schon ... na was ... mindestens drei Monate nichts mehr von dir gehört. Was macht die Kunst? Wieder an einer heißen Story dran, was? Natürlich bist du das, deshalb meldest du dich ja bei mir. Soll ich mal wieder irgendwo für dich einbrechen? Kein Problem, mach ich doch gerne, aus alter Freundschaft, was?«
Es war schwierig, seinen Freund Benjamin Swenske zu unterbrechen, wenn er einmal Fahrt aufgenommen hatte. Benjamin, oder Ben, wie ihn seine Freunde nannten, war einer seiner wenigen Freunde, und Eduard hatte im Zusammenhang mit der Erstellung seines Testaments auch an ihn gedacht, als es darum ging, wem er was vererben würde. Er wäre die erste Wahl für seine gesamte technische Ausrüstung gewesen, den Computer, den Laptop, die Stereoanlage und eben alles, was mit Technik zu tun hatte. Vor allem deshalb, weil Benjamin einer der wenigen war, die wirklich etwas damit hätten anfangen können.
Benjamin war 29 Jahre alt, und wer ihn am Telefon hörte, hätte bei der Einschätzung seiner Person und seines Aussehens absolut falsch gelegen. Stellte man sich einen typischen Rocker oder Biker vor, wie er in amerikanischen TV-Serien dargestellt wurde, konnte man sich ein gutes Bild von ihm machen: mittelgroß, sehr kräftig, sowohl was seinen Bauchumfang als auch den Umfang seiner Muskeln anging, lange mittelbraune Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, ein zerzauster Vollbart bis auf die Brust und ... natürlich die unvermeidlichen Lederklamotten. Ein Rocker wie aus dem Bilderbuch. Aber so wenig, wie seine Stimme zu der äußeren Erscheinung passte, so wenig ließ sein ganzer Rocker-Habitus den richtigen Rückschluss auf seine geistigen Fähigkeiten zu.
Ben war ein begnadeter Hacker, seit seiner Jugend Mitglied im Chaos Computer Club in Hamburg und dort aufgrund seiner überlegenen Intelligenz und Logik ein sehr angesehener Mann. Er sah sich selbst als Kämpfer für Freiheit, Gerechtigkeit und Gegner jeglichen Missbrauchs der digitalen Weltgemeinschaft oder Benachteiligung des Bürgers durch Spionage in der Informationstechnik.
Eduard ließ Benjamin noch zwei, drei Fragen stellen, auf die dieser offenbar keine Antworten erwartete, bis er ihn unterbrach.
»Langsam, langsam, Ben, hol doch mal Luft, dann kann ich dir auch einige deiner Fragen beantworten ... wenn ich mich überhaupt noch an alle erinnern kann.«
»Oh, entschuldige, raus damit. Was ist los?«
Eduard begann damit, ihm zu erzählen, dass er einen Herzinfarkt gehabt hatte, tot gewesen und auf die Transplantationsliste gelangt war. Erstmals in den vier Jahren, die er Ben nun kannte, erlebte er ihn wortlos. Kein Kommentar, keine vermeintlich lustige Bemerkung, nicht einmal ein bedauerndes »oh, wie furchtbar« kam von seiner Seite.
»Bist du noch dran? Ben?«
»Entschuldige, ich war wohl etwas baff. Das ist aber ziemlich starker Tobak, Alter. Erzähl weiter.«
Es war ungewöhnlich, dass ein Satz von Ben nicht mit einer Frage endete, aber das war vermutlich der außergewöhnlichen Situation geschuldet. Also erzählte er weiter. Er berichtete Benjamin von dem überraschenden Fund eines Spenders trotz seiner seltenen Blutgruppe und von der erfolgreichen Transplantation. Auch machte er keinen Hehl aus den sonderbaren und verwirrenden Erinnerungen und den neuen Geschmäckern. Mit diesen Bemerkungen wechselte er auf ein Terrain, auf dem Ben sich als alter Verschwörungstheoretiker wieder zu Hause fühlte, was er ihn auch sofort merken ließ.
»Wow, Alter, was für eine abgefahrene Geschichte. Ich wette, jetzt willst du wissen, wer der Spender war, stimmt's? Aber wie kann ich dir da helfen?«
Eduard erzählte ihm von den gesetzlichen Vorgaben, die für die Anonymität von Spender und Empfänger sorgten und von Eurotransplant. Als er deren Datenbank erwähnte, war Ben nicht mehr zu halten.
»Na also, ich kapiere, du brauchst mich, damit ich mich in die Datenbank von denen hacke, nicht wahr? Ey, Alter, kein Problem, das mach ich gerne, keine Frage. Du hast es vermutlich eilig, oder? Mach dir mal keine Sorgen, das krieg ich hin. Warte auf meinen Anruf.«
Er legte unvermittelt und ohne eine Abschiedsformel einfach auf. Eduard nahm das Handy vom Ohr, hielt es vor sich und sah bestätigt, dass die Verbindung getrennt war. Kopfschüttelnd steckte er es wieder ein und überlegte, was er noch tun könnte.
Ben war seine beste Option. Entgegen der landläufigen Meinung, der Chaos Computer Club oder auch CCC, sei eine Ansammlung krimineller Hacker, handelte es sich um einen eingetragenen Verein, gegründet 1981 mit dem Ziel, die Informationsgesellschaft vor dem Missbrauch des Internets zu schützen und auf Missstände aufmerksam zu machen. In einigen spektakulären Aktionen, die sie Hacks nannten, hatten sie ihre Rechtschaffenheit bewiesen und in einigen Fällen sogar die Behörden eingeschaltet.
Vor seiner Reportage über den CCC, bei der er auch Ben kennengelernt hatte, war Eduard ähnlich falschen Vorstellungen aufgesessen. Die Clubmitglieder waren positiv überrascht, über das, was er über sie und den Club schrieb und es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. In den folgenden Jahren hatte Eduard sich einige Male der Hilfe von Benjamin bedient, vor allem bei Nachforschungen zu Industriespionage, die heutzutage hauptsächlich durch Hacking betrieben wurde. Die Zeiten, als japanische Besucher von Industrieanlagen Hüte in Bottiche mit chemischen Stoffen fallen ließen, um so an Materialproben zur Auswertung und letztendlich Nachahmung zu bekommen, waren lange vorbei.
Heute fädelte man sich auf den Datenhighway ein, fuhr sehr dicht hinter vorausfahrenden Mitbewerbern her, und sammelte so lange Informationen, bis man sie irgendwann überholen konnte. Ehrlicherweise musste Eduard sich eingestehen, dass er nie richtig verstanden hatte, was Benjamin genau machte, um sein Ziel zu erreichen. Er war in der Lage, seinen PC oder Laptop zu bedienen, aber die Feinheiten der Informatik oder des Internets waren ihm stets fremd geblieben.
Er hatte noch keine fünfzehn Minuten über seine Situation nachgedacht, als das Handy klingelte. Das Display zeigte ihm, dass es Ben war, der ihn anrief.
Wollte er noch weitere Informationen? Hatte er ihm vielleicht nicht alles gesagt, was er für seine Recherche brauchte? Oder war er gar auf ein System gestoßen, an dem selbst er scheiterte? Eduard begann schon fieberhaft zu überlegen, was er dann machen sollte, als er das Gespräch annahm.
»Ja, Ben, was gibt’s?«
»Ahlsbeek. Liam Ahlsbeek.«
»Bitte?«
»Du wolltest doch den Namen deines Spenders, Alter. Er hieß Liam Ahlsbeek, war genauso alt wie du und nun rate mal, wo er gelebt hat. Hast du eine Ahnung?«
Selbstverständlich hatte Eduard keine, was er auch recht ungeduldig zum Ausdruck brachte. Dadurch ließ sich Ben allerdings kaum aus der Fassung bringen.
»Halt dich fest, Alter, der hat in Hamburg gewohnt, also quasi um die Ecke von mir. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch mal ein Zufall, oder?«
»Woran ist er gestorben?«
»Hmm, das ist jetzt ein wenig heikel ... also ... genau kann ich es dir noch nicht sagen, da müsste ich mich erst in die Datenbank der Hamburger Polizei reinhacken, und ...«
»Lass das ja sein«, unterbrach Eduard ihn eilig. »Mach keine Dummheiten. Fürs Erste sind das schon ausreichend viele Informationen. Was steht denn bei EUROTRANSPLANT, woran er gestorben ist?«
»Suizid ... also Selbstmord!«
Er hätte Eduard nicht erklären müssen, was Suizid bedeutete, aber der begann sich gerade zu fragen, was die Selbsttötung im Zusammenhang mit dem riesigen Zufall der passenden Spende für ihn zu bedeuten hatte.
»Was kannst du mir noch über meinen Spender sagen?«
»Gedulde dich zehn Minuten und du bekommst ein ausführliches Dossier über den Knaben. Das reicht doch sicherlich, oder?«