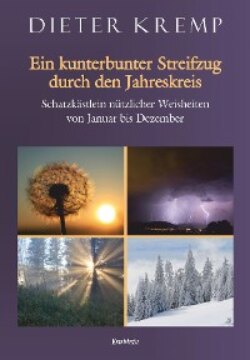Читать книгу Ein kunterbunter Streifzug durch den Jahreskreis - Dieter Kremp - Страница 14
DER HEILIGE ANTONIUS UND DAS SCHWEIN
ОглавлениеDer „wilde Eber“ der Germanen wurde zu unserem Glücksschwein. Dazu trug auch der heilige Antonius bei, der auf Darstellungen seinen schützenden Mantel um die Schweine legt. Am 17. Januar feiern wir seinen Namenstag.
Der heilige Antonius ist der Patron der Ritter, Haustiere und Schweine, der Metzger, Schweinehirten und ein mächtiger Helfer gegen Viehseuchen. Er wird besonders in den Alpenländern, in Frankreich und Italien verehrt. Die gefürchtete Schweinepest war bei unseren Vorfahren als „Antonius-Seuche“ bekannt und konnte nur geheilt werden, wenn der greise Mönchsvater sein „Antoniuskreuz“, das er als Krücke trug, über den Kopf des Schweines hielt.
Doch würde sich der Patron der Hausschweine im Grabe umdrehen, würde er erfahren, dass es heute keine „glücklichen Schweine“ mehr gibt. Von allen Haustieren erleidet das Mastvieh Schwein die größten Qualen in den fleischverarbeitenden Betrieben. Die gentechnische Manipulation am Hausschwein führte zu schnellwachsenden Monstern ohne Ringelschwanz, Borsten, Ohren, Schnauze und Augen. „Glücksschweine“ gibt es nicht mehr: wer soll da noch „Schwein haben“? Und wenn jetzt gar der „EU-Eber“ den Deutschen aufgetischt wird, riecht das Fleisch nicht mehr nach „Schwein“, sondern nach „Pissoir“.
Antonius begründete um 320 n. Chr. die bis dahin unbekannte Lebensform der Einsiedlergemeinde, aus der dann später die erste Mönchsgemeinde wurde. Antonius hat auch die „Angelica“, das Mönchsgewand, eingeführt. Der greise Mönchsvater starb im Alter von 105 Jahren und erhielt nach seinem Tode den Beinamen „der Große“.
Ein französischer Adeliger, dessen Sohn durch Reliquien des Antonius von einer Seuche geheilt wurde, gründete 1095 den Antoniterorden. Albert von Bayern stiftete 1382 den Antonius-Ritter-Orden, woraufhin der heilige Antonius zum Patron und Vorbild des Ritterstandes wurde. Viele Burgen und Kapellen wurden ihm geweiht.
Eine hübsche Geschichte gibt es auch zum sogenannten „Antonius-Schwein“ . Die Antoniter durften für die Krankenpflege ihre Schweine frei weiden lassen. Als Kennzeichen trugen sie ein Glöckchen, so dass kein Tier im Eichenwald verlorenging. Immer am 17. Januar wurde ein Schwein geschlachtet, sein Fleisch nach der Segnung an die Armen verschenkt.
Das Thema „Schweinezucht“ war früher im ländlichen Bereich in den Dorfschulen Unterrichtsstoff. Noch früher wurden die Schweine ausschließlich mit gekochten Kartoffeln gemästet. Das waren die „Saugrumbeere“, die bei der Kartoffelernte als kleine und zerhackte Kartoffeln in besondere Körbe kamen. „In die Mast treiben“ war eine andere Methode, die Schweine zu mästen. Dafür standen auf dem Dorf die Schweinehirten zur Verfügung. Diese trieben die Schweine in die Eichenwälder. Der Speck von in der Eichelmast fett gewordenen Schweinen soll sehr fest und schmackhaft gewesen sein. Der Beruf des Schweinehirten war geachtet.
Ein „Glücksschwein“, gerne als „Sparschweinchen“ aufgestellt, erinnert an den wilden Eber, das Opfertier der Germanen. Durch seine Opferung sollten die Götter milder gestimmt werden. Vielleicht bedeutete es aber auch ein besonderes Jagdglück, ein derart wildes Ungetüm zu erbeuten. Auch im Hochzeitsessen spielte das Schwein früher auf dem Lande eine besondere Rolle. Es war gewissermaßen das Opfer, das man bei der Hochzeit brachte. Deshalb eröffnete ein Schweinskopf, ursprünglich mit einem Rosmarinstängel im Maul, später mit einer Zitrone oder Rose, das Hochzeitsessen. Dieses erste Gericht wurde feierlich von einer Jungfrau aufgetragen. In anderen deutschen Gegenden tischte man als erstes Hochzeitsessen ein gebratenes Spanferkel auf, das eine Blume, einen Zweig Rosmarin oder auch Immergrün unter dem Ringelschwänzchen trug. Das Schwänzchen war für die Braut reserviert, war es doch ein Symbol der Fruchtbarkeit.