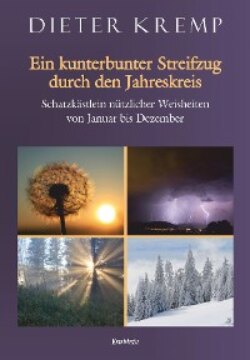Читать книгу Ein kunterbunter Streifzug durch den Jahreskreis - Dieter Kremp - Страница 20
DER JANUAR, DER HÄRTESTE MONAT DES JAHRES
ОглавлениеJanuar, der erste Monat des Jahres mit 31 Tagen, hat seinen Namen von dem altrömischen Gott Janus. Die Römer sahen ihn als Schützer des Hauses an. Er war der Gott der Tür und des Torbogens. Mit einem Doppelgesicht schaute Janus zugleich nach drinnen und draußen, hütete den Eingang und den Ausgang. Später entwickelte Janus sich allgemein zum Gott des Anfangs. Er wurde am Gebetsbeginn angerufen, und seine heiligen Zeiten waren die ersten Stunden des Tages, die ersten Monatstage und der erste Monat des Jahres.
Janus wird mit einem Schlüssel und einem Pförtnerstab als Beigaben sowie mit einem jungen und einem alten Gesicht dargestellt. Das alte Gesicht blickt in die Vergangenheit, das junge in die Zukunft. Gerade zum Jahreswechsel kann das als Symbol gelten, nachdenklich zurückzuschauen und zugleich voll Hoffnung vorwärts auf alle kommenden Tage zu blicken.
Eine andere Bezeichnung für den Monat ist Jänner oder Jenner. Sie wurde bis ins 18. Jahrhundert verwendet. Heute ist sie nur noch in oberdeutschen Mundarten gebräuchlich, besonders in Österreich und in der Schweiz. Alle älteren deutschen Namen wie Eis-, Schnee- oder Wintermonat zeigen ebenso wie das altdeutsche Wort Hartung, dass der Januar in unseren Gegenden eine harte, eiskalte und bittere Winterzeit bringt. Der Hartung ist der härteste Monat des Jahres. Auch die meisten Bauernregeln, alte Erfahrungen des Volkes mit dem Wetter, verlangen vom Januar viel Schnee und klirrende Kälte. Nur so, meinen sie, kann das Jahr gelingen und ein rechter Sommer Einzug halten.
So wie der doppelsichtige Janus mit seinem Gesicht in die Vergangenheit und mit dem anderen in die Zukunft schaut, so steht der Januar als Bindeglied zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Daher wurde er einst auch als „Tür des Jahres“ bezeichnet. Schneemond oder Eismond, aber auch Hartung, weil der Januar der „härteste“ Monat des Jahres ist, sind alte Bezeichnungen für den ersten Monat des Jahres. Folglich erscheinen auch Schneemänner, Schneeflocken und Eiskristalle als Symbole für den oftmals kältesten Monat des Jahres.
Zieht man den Hundertjährigen Kalender zu Rate, dann soll es im Januar zunächst „so kalt wie Ende Dezember“ bleiben. Nachdem sich dann für den 7. Januar Schneefall ankündigt, ist vom 8. Bis 15. Des Monats mit Kälte zu rechnen, die anschließend von einer „linden“ Phase mit Schnee und Regen abgelöst wird. Erst nach dem 23. Januar – so heißt es weiter – wird es wieder kälter. Allerdings ist für den 30. Januar erneut mit eher milder Witterung zu rechnen.
Altem Volksglauben zufolge gilt jedenfalls: „Je frostiger der Jänner, je freundlicher das ganze Jahr.“ Klirrende Kälte sah auch der Bauer vergangener Tage besonders gern. Für ihn galt die Faustregel: „Werden die Tage länger, wird der Winter strenger.“ Die Erklärung dafür lag auf der Hand: „Der Januar muss vor Kälte knacken, wenn die Ernte gut soll sacken“ oder „Der Januar muss krachen, soll der Frühling lachen.“ Darüber hinaus hieß es: „Januar hart und rau, nützet dem Getreidebau“ und „knarrt der Jänner Eis und Schnee, gibt’s zur Ernt’ viel Korn und Klee.“ Auch die Menge der weißen Pracht war einst von großer Bedeutung. „Schnee zu Hauf“, sagte dem Bauern, „hält den Sack weit auf“ und gewährleistete schon im Januar „Dung für das ganze weitere Jahr.“
Ein milder Januar rief immer Entsetzen hervor: „Januar warm – dass Gott erbarm!“ „Gibt es im Jänner gar viel Mückentanz, verdirbt die Futterernte ganz“, denn „wächst auch das Korn im Januar, wird es auf dem Markte rar“ und auch das Gras, das schon zu Jahresbeginn wächst, „ist im Sommer in Gefahr.“
Auch Regenwetter war genauso unbeliebt: „Viel Regen ohne Schnee, tut Bäumen, Bergen und Tälern weh.“ Mit einem lachenden und weinenden Auge hörte man in früheren Zeiten das Donnergrollen. Einerseits hieß es: „Wenn’s im Januar donnert über dem Feld, kommt später doch noch sehr große Kält“ und andererseits hoffte man darauf, dass des „Jänners Groll machet Kist und Fässer voll.“
Für die Weinbauern war einst das Wetter am Dreikönigstag (6. Januar) von Bedeutung: „Ist es an diesem Tag hell und klar, gibt’s viel Wein in diesem Jahr.“ Allerdings bedeutete ein Dreikönigstag „sonnig und still“, dass der „Winter vor Ostern nicht weichen will.“
Die Obstbauern warteten auf das letzte Drittel des Januars: „Wenn Agnes (21. Januar) und Vinzenz (22. Januar) kommen, wird neuer Saft im Baum vernommen.“