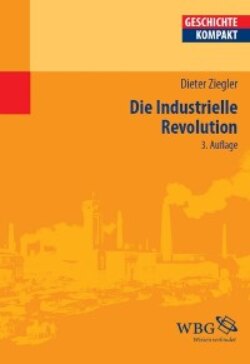Читать книгу Die Industrielle Revolution - Dieter Ziegler - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
E
ОглавлениеKapitalbildung Unter der Kapitalbildung versteht man die Erweiterung des Kapitalstocks einer Volkswirtschaft durch Neuinvestitionen. Investitionen werden durch ersparte Geldeinkommen finanziert. Sie setzen somit einen Konsumverzicht der Einkommensbezieher zugunsten einer erweiterten Produktionsgütererzeugung voraus. Bei den ersparten Geldeinkommen kann es sich um bereits verteilte Einkommen handeln, die als Kredite (direkt oder vermittelt über die Banken bzw. den Kapitalmarkt) oder als Beteiligungen (meist den Erwerb von Aktien) der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Investitionen können aber auch aus noch nicht verteilten Einkommen finanziert werden, indem etwa der Unternehmensgewinn nicht ausgeschüttet wird, sondern ganz oder teilweise zur Produktionserweiterung in der Unternehmung verbleibt.
Auch diese Definition konnte sich allerdings nicht durchsetzen, und wieder liefert der Pionier der industriellen Entwicklung das entscheidende Gegenargument. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die britische Industrialisierung zunächst keineswegs durch die kapitalintensive Schwerindustrie geprägt wurde, sondern durch die weiterhin sehr arbeitsintensive, aber vergleichsweise wenig kapitalintensive Textilindustrie. Weitaus größere Summen wurden etwa in Getreidemühlen investiert, die überall gebraucht wurden und deshalb lange vor dem Beginn der Industrialisierung über das ganze Land verstreut errichtet wurden. Technisch waren sie als Wind- oder Wassermühlen in ganz Europa noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auf einem vorindustriellen Stand. Angesichts des in dieser Weise vorindustriell investierten Kapitals fielen die modernen britischen Baumwollspinnereien quantitativ kaum ins Gewicht. Für eine statistisch merkliche, womöglich gar ruckartige Steigerung der Kapitalbildung waren die „modernen“ Fabriken viel zu wenige.
Bedeutungsverschiebung der Wirtschaftssektoren
Ein weiteres Kriterium für eine industrielle Wirtschaft und Gesellschaft bildet die Verteilung der Beschäftigten auf die Wirtschaftssektoren. In vorindustrieller Zeit war der bei weitem größte Teil der Bevölkerung im primären Sektor, in der Landwirtschaft beschäftigt. Auch ein hoher Anteil des tertiären Sektors, also bei den Dienstleistungen, war im Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft – anders als heute – noch keineswegs ein Zeichen von „Modernität“. Im Gegenteil, die berufliche Zusammensetzung der im tertiären Sektor Beschäftigten sah im 18. und 19. Jahrhundert gänzlich anders aus als heute. Das gilt besonders für weibliche Beschäftigte. Die typischen „Frauenberufe“ des 20. Jahrhunderts gab es entweder noch gar nicht oder sie spielten zumindest quantitativ noch keine Rolle. Pflegerische und „soziale“ Berufe gab es für Frauen so gut wie noch gar nicht. Insbesondere die Krankenpflege, die Geburtshilfe usw. galten zwar auch schon in vorindustrieller Zeit als „weiblich“, wurden vielfach aber noch „ehrenamtlich“, insbesondere durch kirchliche Einrichtungen, ausgeübt. Die Verkäuferin und die Sekretärin sind hingegen neue Entwicklungen des frühen 20. Jahrhunderts. Einen sehr großen Anteil der im tertiären Sektor beschäftigten Frauen bildeten deshalb die Hausangestellten, insbesondere die Dienstmädchen, die quantitativ heute fast gar keine Bedeutung mehr besitzen, sondern in relativ kurzer Zeit während der zwanziger bis fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit dem Einzug der industriellen Technik in die Haushalte „wegrationalisiert“ wurden.