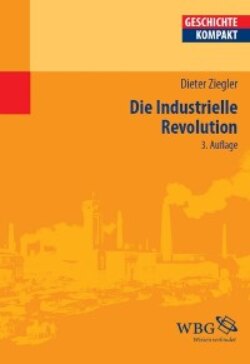Читать книгу Die Industrielle Revolution - Dieter Ziegler - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
E
ОглавлениеKonjunktur Das Wirtschaftswachstum erfolgt niemals als ein gleichförmiger Prozess mit einem Jahr für Jahr annähernd gleichen Tempo. Die jährlichen Schwankungen können vielmehr beträchtlich ausfallen. In der Frühen Neuzeit wurde die wirtschaftliche Entwicklung ganz wesentlich durch die Schwankungen der landwirtschaftlichen Erzeugung bestimmt. Diese Schwankungen waren unregelmäßig und zufällig, weil sie – abgesehen von den Kriegen im 17. und 18. Jahrhundert und deren Folgen – im wesentlichen durch klimatische Faktoren bestimmt wurden. Das industriewirtschaftliche Wachstum setzte in Deutschland im 19. Jahrhundert zunächst in wenigen Branchen und Regionen ein, von denen aus es sich langsam verbreitete. Damit löste sich der Rhythmus des Wachstums von den Zufälligkeiten des Klimas und wurde mit dem Bedeutungszuwachs der Industriewirtschaft in der Gesamtwirtschaft durch die Abfolge von Innovations- und Investitionsschüben und deren Nachlassen bestimmt. Dadurch entstand ein zyklischer Rhythmus, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert wegen der zunehmenden weltwirtschaftlichen Verflechtung immer mehr Volkswirtschaften erfasste, deren Wachstumszyklen nun weitgehend synchronisiert waren.
Bis 1873 war das Wirtschaftswachstum in Deutschland, von kurzfristigeren Schwankungen abgesehen, durch eine lange Aufschwungsphase gekennzeichnet. Der Historiker Friedrich Lenger hat erst kürzlich wieder die Kompatibilität dieser Beobachtung mit älteren Vorstellungen einer „Industriellen Revolution“ herausgestellt. Außerdem gibt es bisher kein überzeugenderes Konzept für die empirische Verifikation einer „Industriellen Revolution“ als das von Spree. Aber dennoch beruht Sprees Analyse auf einer ganzen Reihen von statistischen Gewichtungen, die nicht unumstritten geblieben sind. Außerdem ist es nicht erwiesen, ob mit dieser Methode auch ein langsameres Hinübergleiten von einer vorindustriellen in eine industriell geprägte Wirtschaft erfassbar ist.
Statistische Probleme
Ganz abgesehen davon ist die Datengrundlage für die Berechnung des Volkseinkommens in der Frühzeit der Industrialisierung in fast allen europäischen Ländern äußerst lückenhaft. Oft basieren die Datenreihen auf Schätzungen, denen ein bestimmtes Verständnis der industriellen Entwicklung im jeweiligen Land zugrunde liegt. Wenn dann fehlende Daten aufgrund dieses Verständnisses interpoliert werden, können sie auf der anderen Seite nicht hergenommen werden, um genau dieses Vorverständnis zu beweisen. Das wäre tautologisch.
Schließlich sollte berücksichtigt werden, dass alle verfügbaren Daten zur Berechnung von Volkseinkommen, Kapitalbildung usw. immer durch politische Grenzen bestimmt werden. Doch politisch definierte Regionen sind selten gleichzusetzen mit Wirtschaftsregionen. Das gilt für Nationalstaaten ohnehin, selbst für kleine Nationalstaaten wie Belgien oder die Schweiz, aber auch für kleinere Verwaltungseinheiten wie etwa die preußischen Provinzen. Dennoch kann etwa die Verteilung der Erwerbstätigen auf die Wirtschaftssektoren als ein grober Indikator für den Fortschritt der Industrialisierung angesehen werden. Wenn wir beispielsweise das Königreich Sachsen mit dem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin vergleichen, lässt sich leicht ausmachen, welcher deutsche Staat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts industriell fortgeschrittener war. So waren in Sachsen bereits 1871 nur noch 28 % der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt, während es in Mecklenburg-Schwerin im gleichen Jahr 62 % gewesen waren. Demgegenüber gab es auch innerhalb vieler im Durchschnitt weit entwickelter Verwaltungseinheiten, wie etwa der preußischen Rheinprovinz, Regionen, die, wie etwa die Eifel, nicht nur von der Industrialisierung unberührt geblieben waren, sondern die sogar „deindustrialisierten“, indem Kapital, Arbeitskräfte, technisches und unternehmerisches Know How abwanderten, weil der vorindustrielle Standortvorteil des Holzreichtums im Zeitalter der Steinkohle nichts mehr Wert war, nun aber die periphere Lage und die schwierige verkehrliche Erschließung als Standortnachteile durchschlugen.
Probleme der Periodisierung
Im Gegensatz zu vielen anderen nationalstaatlich definierten Industrialisierungswegen legen fast alle genannten Indikatoren im deutschen Fall eine Industrialisierungsphase zwischen der Mitte der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts, nur kurz unterbrochen durch die Revolution von 1848 und ihren Folgen, und der Mitte der siebziger Jahre mit dem Abflauen der Hochkonjunktur nach der Reichsgründung nahe. In der Literatur über die deutsche Industrialisierung wird diese Periode deshalb mit guten Gründen bis heute als die Phase der „Industriellen Revolution“ oder entsprechend der Terminologie älterer industrialisierungstheoretischer Vorstellungen als „Take off“ oder als „Big Spurt“ bezeichnet, der eine vorbereitende Phase, die Frühindustrialisierung, vorgeschaltet war und der nach Überwindung der Wachstumsschwäche der späten siebziger und achtziger Jahre eine Phase der Hochindustrialisierung folgte.
So sinnvoll diese Periodisierung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Zollvereinsstaaten bzw. des Deutschen Kaiserreichs auch ist, sie verdrängt die regionalen Besonderheiten und passt die deutsche Entwicklung viel zu wenig in den gesamteuropäischen Kontext ein. Die Wirtschaftsordnung und die Wirtschaftspolitik, im 19. Jahrhundert insbesondere die Handelspolitik, können zwar Bedingungen schaffen, die nur innerhalb bestimmter politischer Grenzen Gültigkeit besitzen, aber Waren, Kapital, Arbeitskräfte und nicht zuletzt auch Know How zirkulierten auch schon im 18. Jahrhundert über Grenzen hinweg, so dass die britischen Versuche ganz aussichtslos waren, zwar Baumwollgarne und Baumwollstoffe nach Kontinentaleuropa zu exportieren, nicht aber Maschinen und Menschen, die diese Maschinen aufstellen und bedienen konnten. Spätestens nach der Beendigung der Kontinentalsperre und dem kaum gebremsten Zugang englischer Garne und Stoffe auf den kontinentaleuropäischen Markt orientierten sich immer mehr Zeitgenossen in Deutschland am britischen Vorbild, auch wenn die dort zu beobachtenden sozialen und politischen Folgen der Industrialisierung durchaus auch kritisch gesehen wurden.
Industrialisierung als europäisches Phänomen
Immerhin mussten aber die kontinentaleuropäischen „Nachzügler“ das Rad nicht neu erfinden, sondern konnten vom britischen Vorbild lernen und einige der dortigen Errungenschaften auf die eigenen Verhältnisse angepasst übernehmen. Die Kostenersparnis einer intelligenten Nachahmung war beträchtlich und erklärt zu einem Gutteil, weshalb manche kontinentaleuropäische Volkswirtschaften sowie die USA den britischen Vorsprung bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts in vielen Bereichen ein- und in manchen sogar überholen konnten. Die Erkenntnis, dass sie nicht mehr die „Werkstatt der Welt“ waren und dass es durchaus Sinn machte, von den Nachbarn zu lernen, war für die Briten ein sehr schmerzhafter und deshalb auch langwieriger Prozess. In manchen Bereichen verpassten sie deshalb den Anschluss und holten den Vorsprung, den sich die dynamischsten aller Nachzügler, die USA und Deutschland, vor dem Ersten Weltkrieg etwa in der elektrotechnischen Industrie erarbeitet hatten, nie wieder ein. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der europäischen Staaten, so prekär sie im Einzelfall auch gewesen sein mag, begann keineswegs mit ihrer Institutionalisierung in den „Römischen Verträgen“ im Jahr 1957 oder gar erst mit dem Beitritt Großbritanniens zur EWG 1973, sondern weitaus früher.
Grenzräume
Abgesehen von der grenzüberschreitenden Bedeutung des wirtschaftlichen Austauschs hielten sich auch die Rohstoffvorkommen, insbesondere die Steinkohle, aber auch Eisenerz und andere Bodenschätze nicht an nationalstaatliche Grenzen, so dass Industrieregionen auf beiden Seiten von Grenzen entstanden. Man denke im deutschen Fall nur an das deutsch-belgische Revier zwischen Lüttich und Aachen, das deutsch-französische Saarrevier oder den sächsisch-böhmischen bzw. den schlesisch-böhmischen Grenzraum. Jeder Versuch, die gegenseitige Befruchtung benachbarter Wirtschaftsräume zu unterbinden, hätte nicht nur dem Nachbarn geschadet, sondern hätte auch die eigene Entwicklung gebremst. Da mögen die Abneigungen der Preußen gegenüber dem aus einer Revolution geborenen Belgien noch so groß gewesen sein, ohne die Impulse aus den belgischen Revieren wäre nicht nur die Geschichte des Aachener Reviers, sondern auch die Geschichte des Ruhrgebiets anders verlaufen.
Verlässt man aber die nationalstaatliche Perspektive ist es nicht mehr möglich, die Periodisierung der Industrialisierung in Frühindustrialisierung, „Take off“ und Hochindustrialisierung aufrechtzuerhalten. Denn während Preußen zum Zeitpunkt der Gründung des Deutschen Zollvereins noch in der Phase der Frühindustrialisierung steckte, war Großbritannien bereits ein Industrieland, das seinen ersten Eisenbahnboom erlebte, während die russische Wirtschaft andererseits noch ganz in den Fesseln des Feudalismus gefangen war.
Im Folgenden soll deshalb einem anderen Periodisierungsschema gefolgt werden. Die Forschung geht heute einhellig davon aus, dass die Industrialisierung ein sowohl sektoral als auch regional ungleichgewichtiger und ungleichzeitiger Prozess war. Das gilt im nationalen Rahmen selbst für einen vergleichsweise kleinen Staat wie Belgien, und demzufolge noch viel stärker für den gesamten Kontinent Europa.
Regionale Ungleichzeitigkeit
Regional ungleichzeitig und ungleichgewichtig bedeutet, dass regionale Wachstumskerne entstanden, die untereinander in Beziehung traten und Impulse auf benachbarte, noch rückständige Regionen absonderten. Sehr schematisch betrachtet handelte es sich dabei, von England ausgehend, um eine West-Ost-Wanderung industrieller Wachstumszonen entlang der Kohlevorkommen von der französischen Kanalküste bis nach Nordböhmen und Oberschlesien sowie um eine Nord-Südwanderung entlang des Rheins bis in das schweizerische Voralpenland und darüber hinaus bis nach Piemont.
Sektorale Ungleichzeitigkeit
Sektoral ungleichzeitig und ungleichgewichtig bedeutet, dass nicht alle Gewerbezweige gleichzeitig von der Industrialisierung erfasst wurden sondern nach und nach. Dabei bildeten sich bestimmte, auf „Basisinnovationen“ wie der mechanischen Baumwollspinnerei, der Eisenbahn oder der Elektrifizierung beruhende industrielle Führungssektoren heraus, die über einen längeren Zeitraum in der Lage waren, den Wachstumsrhythmus maßgeblich zu bestimmen. Die Wachstumsimpulse dieser Führungssektoren hielten in der Regel bei leichten Schwankungen über mehrere Jahrzehnte an, bis sie an Dynamik einbüßten. In diesen schwächeren Wachstumsphasen erfolgte dann der Durchbruch einer neuen Basisinnovation, die sich nach einiger Zeit zu einem neuen industriellen Führungssektor entwickelte und ihrerseits die Wachstumsdynamik bestimmte.
Industrialisierung unter der Bedingung relativer Rückständigkeit
Wenn eine rückständige nationale Volkswirtschaft den Anschluss an die industrialisierenden Volkswirtschaften herstellen wollte, musste sie sich im 19. Jahrhundert in der Regel dem Wachstumsmuster der höher entwickelten Volkswirtschaften anpassen, indem sie etwa ihre geringere Arbeitsproduktivität und Produktqualität durch niedrigere Lohnkosten ausglichen. Während der Boomphasen war die Nachfrage meist so hoch, dass auch die anfangs noch teuren und qualitativ kaum konkurrenzfähigen Produkte ihre Absatzchancen besaßen. Mit der Zeit wurden die Produkte der nachholenden Volkswirtschaften durch Nachahmung dann qualitativ besser, so dass sie dank der weiterhin vergleichsweise niedrigen Lohnkosten zumindest auf dem Binnenmarkt und bei den noch rückständigeren Nachbarn dauerhaft konkurrenzfähig wurden. So konnte ein selbst tragendes Wachstum über die nachholende Industrialisierung in bestimmten Schlüsselbranchen erreicht werden.
Die folgende Darstellung wird sich an diesen langwelligen Industrialisierungsmustern orientieren. Sie gliedert sich in drei Phasen, die durch unterschiedliche Führungssektoren bestimmt wurden: die Phase der Baumwollindustrie von den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts bis in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts (leichtindustrielle Phase), die Phase des Eisenbahnbaus von den dreißiger/vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts (schwerindustrielle Phase) und die Phase der elektrotechnischen Industrie seit den achtziger/neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges (Phase der „neuen“ Industrien).