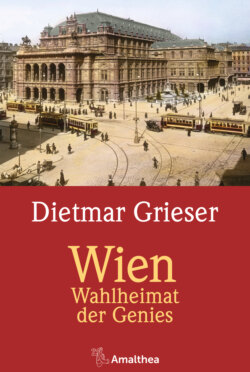Читать книгу Wien - Dietmar Grieser - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wundersame Verwandlung Mitsuko Aoyama
ОглавлениеDie Grafen Coudenhove stammen aus Brabant, sind flämischen Ursprungs. Das Adelsprädikat verdanken sie einem Kreuzritter dieses Namens, der bei der Eroberung Jerusalems anno 1099 in vorderster Reihe stand. Die heutigen Mitglieder des berühmten Geschlechts können auf einen Stammbaum verweisen, der ohne Lücke bis zu dem 1259 verstorbenen Urahn Gerolf zurückreicht.
Heinrich Coudenhove-Kalergi kommt am 12. Oktober 1859 in Wien zur Welt. Die seit Langem in Österreich ansässige Familie hat dem Kaiserhaus so manchen verdienten Staatsmann gestellt; Schloss Ronsperg in Böhmen ist ihr Stammsitz. Heinrich ist für die diplomatische Laufbahn ausersehen, im Jesuitenkolleg Kalksburg bei Wien erhält er das dafür nötige Rüstzeug. Sein erster Auslandsposten ist Athen, sein zweiter Rio de Janeiro. Als Großwildjäger in den brasilianischen Urwäldern bringt er es zu Weltrekorden, die ihm über seinen Tod hinaus einen Ehrenplatz im Sportman’s Handbook sichern. Noch imponierender ist sein ungewöhnliches Sprachtalent: Als er – nach weiteren Botschaftsposten in Konstantinopel und Buenos Aires – schließlich in Tokio landet, beherrscht der 33-Jährige nicht weniger als 18 Sprachen.
Besonders die Kultur Japans hat es ihm angetan. Und er unternimmt alles, nicht nur sich selbst die fernöstliche Denkweise anzueignen, sondern sie auch seinen europäischen Landsleuten nahezubringen. »Japan ist heute«, so berichtet er 1894 an das Außenministerium in Wien, »ein Staat voller Kraft, Streben, Jugendfrische und Leben, von einem Optimismus beseelt, der ihn nichts für unerreichbar halten lässt, mit seinen 40 Millionen Einwohnern von gleicher Rasse und gleicher Sprache, seinem gesunden Klima, seiner sicheren insularen Lage, beim glühenden Patriotismus seiner Bewohner, bei der allgemeinen Lust zum Studium und zur Arbeit.« Doch Graf Coudenhove-Kalergi ist seiner Zeit weit voraus: Sein engagierter Hinweis auf die »Ersprießlichkeit der Gründung einer Lehrkanzel für Chinesisch und Japanisch an der Wiener Universität« landet in der Schublade.
Auch als Privatmann fängt er in seinem Gastland Feuer: Als er die Bekanntschaft der 15 Jahre jüngeren Mitsuko Aoyama macht, Spross eines alten Tokioter Samurai-Geschlechts, ist ihm keine Hürde zu hoch, das Unerreichbare zu erreichen und dieses zauberhafte Wesen zur Frau zu gewinnen.
Japan und Österreich – dazwischen liegen Welten. Eben noch ein mittelalterlicher Feudalstaat, unternimmt das fernöstliche Kaiserreich die ersten zaghaften Schritte, sich dem Westen zu öffnen – eine Heirat über derart gravierende Grenzen hinweg hat es kaum je gegeben und schon gar nicht auf dieser gesellschaftlichen Stufe. Dass die beiden jungen Leute einander leidenschaftlich zugetan sind, zählt da wenig: Nicht sie haben zu entscheiden, sondern ihre Oberen, und das sind auf der Seite der Braut deren Vater, der Mikado – und auf der Seite des Bräutigams der Wiener Hof. Eine Japanerin als Frau eines künftigen österreichischen Botschafters – wer kann sich das zu dieser Zeit vorstellen? Aber die noch weit größeren Hindernisse stehen einer solchen Verbindung in Japan entgegen: Mitsuko, im Geist des Buddhismus und in der Moral des Konfuzius erzogen, soll ihre Heimat verlassen und den katholischen Glauben annehmen?
Die Taufe in der Kathedrale von Tokio wird zwar mit allem Pomp gefeiert, bleibt aber in den Augen vieler Landsleute ein unverzeihlicher Verstoß gegen den strengen Sittenkodex Japans, und die Kaiserin, die die Braut zur Abschiedsaudienz empfängt und ihr einen kostbaren Fächer aus geschnitztem Elfenbein überreicht, nimmt der »Abtrünnigen« das feierliche Versprechen ab, in ihrem Leben in der Fremde niemals die Ehre Japans aus dem Auge zu verlieren.
Mitsuko ist ein Bild von einer Braut: zart und schlank, ebenmäßiges Gesicht und elfenbeinfarbener Teint, tiefschwarzes Haar von bläulichem Glanz. Alles, was man von einem Mädchen ihres Standes erwarten darf, beherrscht sie: die Kunst der Kalligrafie, die Kunst des Blumenbindens, die Kunst des Mandolinenspiels. Sie weiß in kniender Haltung zu sitzen, sich nach den altüberlieferten Höflichkeitsregeln zu verbeugen, sich mit vollendeter Anmut zu bewegen, ihre wahren Gefühle lächelnd zu verbergen. Damit die Gelenkigkeit ihrer Finger die gewünschte Vollkommenheit erreicht, wird sie als Schulkind – die Hände in einen Sack voll trockener Erbsen gesteckt – zu ausdauernden Bewegungsübungen angehalten. Den Gehorsam gegenüber dem Vater, den man ihr anerzogen hat, übt sie nun im Umgang mit ihrem Mann und später – wiederum in strenger Befolgung des altjapanischen Sittenkodex – im Umgang mit ihrem ältesten Sohn. Heinrich Coudenhove-Kalergi weiß es zu schätzen: Der japanische Patriarchalismus ist ganz nach seinem Geschmack, weibliche Emanzipation in seinen Augen ein Gräuel.
Mitsuko Aoyama, nunmehr den Namen Maria Thekla Mitsu Gräfin Coudenhove-Kalergi tragend, folgt ihrem Gemahl nach Österreich, und Wien, um die Jahrhundertwende eine der internationalsten Hauptstädte der Welt, nimmt die bildschöne Exotin mit dem geheimnisvollen Lächeln mit offenen Armen auf. Die noch in Tokio in Dienst gestellten Ammen und Graf Coudenhove-Kalergis langjähriger armenischer Kammerdiener treten die Reise nach Europa mit an. Im Vatikan empfängt Papst Leo XIII. das Paar in Privataudienz, in der Wiener Hofburg Kaiser Franz Joseph I.
Ihrem Mann in allem ergeben, bleibt Mitsuko im tiefsten Inneren Japanerin. Die beiden erstgeborenen Kinder, die Söhne Hans und Richard, werden ihr, da noch in der alten Heimat Japan zur Welt gekommen, stets näher sein als die fünf, die ihnen folgen. Auf dem Familiensitz ihres Mannes, Schloss Ronsperg in Deutsch-Böhmen, geboren, sind sie für sie »die Böhmer«. Nur aus einem von ihnen, Sohn Gerolf, wird später ein »Japaner« werden: Er ist der Einzige, der die Sprache seiner Mutter beherrschen, sich als Übersetzer von Haiku-Versen einen Namen machen und auch (als Beamter der Japanischen Gesandtschaft in Prag) in japanische Dienste treten wird. Richard, der Zweitälteste (und als Begründer der Pan-Europa-Bewegung zugleich der Berühmteste), wird zum Weltbürger par excellence, dessen Friedenspläne selbstverständlich auch den Fernen Osten einbeziehen. Und dass auch er die Verbindung zur mütterlichen Heimat aufrechterhält, bezeugt schon der Umstand, dass sein philosophisches Gesamtwerk nicht in Deutsch, sondern in Japanisch veröffentlicht werden wird.
Zu gut für diese Welt: Mitsuko Aoyama
Über sein Verhältnis zur Mutter wird Richard Coudenhove-Kalergi später sagen: »Wir Kinder liebten sie, wie man ein Wesen liebt, das zu gut ist für diese Welt. Durch all die Jahre war sie schön wie ein Bild. Nach sieben Geburten wog unsere Mutter 48 Kilo und konnte ihre Taille mit ihren beiden Händen umfassen. Am schönsten war sie, wenn sie ihre japanischen Kleider trug. Oft saßen wir still in der Ecke ihres Salons, wenn sie in japanischer Haltung kniend auf ihren Fersen saß und mit ihrem Tuschpinsel auf endlosen Papierrollen Briefe an ihre Eltern schrieb über ihr seltsames Leben in Europa, Briefe, die dann in Holzkistchen verpackt nach Tokio gingen.«
Richard berichtet weiter, wie sehr die Kinder es liebten, wenn Mitsuko gemeinsam mit ihnen japanische Kinderbücher las und ihnen die zahlreichen mythischen Gestalten erklärte, und wie sehr ihn ein bestimmter Anblick faszinierte: »Noch sehe ich unsere Mutter stundenlang fast unbeweglich vor ihrem Spiegel sitzen. Ihre Kammerjungfer kämmt und bürstet ihre Haarpracht, die wie ein blauschwarzer Mantel über ihre Schultern zu Boden fällt, während sie mit unendlicher Geduld ihre schönen langen Fingernägel poliert, die sie liebt wie andere Frauen ihre Juwelen.«
In der Wiener Aristokratie wird Mitsuko erst zur richtigen Attraktion, als sie im Spätsommer 1908 – nun seit zwei Jahren verwitwet – mit dem Eintritt der älteren Söhne ins Theresianum in die Hauptstadt übersiedelt. Hatte sie bisher in ihrem Turmzimmer auf Schloss Ronsperg wie in einem goldenen Käfig gelebt, wo ihr Mann – seigneural über seinen großen Besitz herrschend und eifersüchtig über seine Gefährtin wachend – Mitsuko von allen Fragen der Güterverwaltung fernhielt, so heißt es für sie nun auf eigenen Beinen zu stehen, und was niemand in der Familie für möglich gehalten hätte, tritt ein: Sie schafft es nicht nur, Vormund ihrer sieben Kinder, sondern auch eine vorzügliche Verwalterin des Familienbesitzes zu sein. Das Doppelleben, das sie an der Seite ihres Mannes geführt hat – auf der einen Seite mit japanischer Dichtung und japanischer Malerei ihr Heimweh stillend, auf der anderen Seite die deutsche Sprache lernend, westliche Gebräuche annehmend und ihre Kinder im europäischen Geist und im katholischen Glauben erziehend –, ermöglicht es ihr nun als junge Witwe für ihr Recht zu kämpfen und diesen Kampf – mithilfe erstklassiger Anwälte – auf allen Linien zu gewinnen. Weder gelingt es der Familie ihres Mannes, das Testament, in dem sie als Universalerbin eingesetzt ist, anzufechten, noch ihr – aus Sorge, sie könnte, da erst 32 Jahre alt, eine neue Ehe eingehen und nach Japan zurückkehren – die Vormundschaft über die Kinder streitig zu machen. Aus dem bis dato stillen und scheuen Wesen wird ein Familienoberhaupt von herrischer Strenge.
Sohn Richard wird dies in seinem Lebensrückblick – ebenso bewundernd wie amüsiert und wohl auch mit gelindem Erschrecken, doch letztlich nicht ohne Verständnis – wie folgt schildern: »In allem ging sie nach ihrem eigenen Kopf, erfüllt von tiefstem Mißtrauen gegen alle ihre Berater. Jede Frage, jeden Akt, jede Bilanz, jede Rechnung studierte sie persönlich. Wenn sie etwas nicht verstand, setzte sie an den Rand mit rotem Bleistift ein großes Fragezeichen, und konnte der betreffende Beamte ihre Frage nicht beantworten, wurde er auf der Stelle entlassen. (…) Dieser Umsturz im Leben meiner Mutter hatte einen Umsturz ihres Charakters zur Folge. Sie, einst so sanftmütig und geduldig, wurde hart und despotisch. Ihre frühere Persönlichkeit schwand und machte einer neuen Platz. Als Familienchef war sie von allen gefürchtet. (…) Am meisten hatten ihre Töchter unter ihrem Despotismus zu leiden, denn sie versuchte sie zu asiatischer Selbstbeherrschung und Selbstverleugnung zu erziehen und zu blindem Gehorsam.«
Vor allem Tochter Olga, die an Mitsukos Seite bis zu deren Ableben ausharrt, bekommt die mütterliche Strenge zu spüren. In eine Villa in Mödling zieht sich die Verwitwete von der Welt zurück, als die Kinder aus dem Haus sind und ihren eigenen Weg gehen. Die großen Wiener Auftritte an der Seite ihrer Söhne, die in der schmucken Uniform der Theresianisten – dunkelblauer Waffenrock, Offizierskappe und Degen mit Goldgriff – auf jeder Gesellschaft bewundernde Blicke auf sich ziehen, sind schon lange nur noch Erinnerung …
Die Verbindung mit der japanischen Heimat hält Mitsuko weiterhin aufrecht, ohne allerdings noch einmal eine Reise in den Fernen Osten anzutreten. Seit dem Tod ihrer Eltern weiß sie, dass sich auch Japan stark gewandelt hat, ein Wiedersehen also wohl mit Enttäuschungen verbunden wäre. Umso mehr bedeutet es ihr, vom Bruder des japanischen Kaisers und dessen Frau empfangen zu werden, als diese auf ihrer Weltreise auch in Wien Station machen; sie hält Kontakt zu japanischen Diplomaten, liest weiterhin japanische Bücher und Zeitungen, spielt auf ihrem Grammophon japanische Musik, und was die Karriere ihres Sohnes Richard betrifft, der als Präsident der von ihm ins Leben gerufenen Pan-Europa-Bewegung Schlagzeilen macht, so bedeutet ihr die kleinste Notiz in einem japanischen Provinzblatt mehr als der schönste Leitartikel in einer der führenden europäischen Zeitungen.
Japan dankt es Maria Thekla Mitsu Gräfin Coudenhove-Kalergi bis heute, dass sie in so vielem die Mitsuko Aoyama von einst geblieben ist: In ihrer Heimat werden Bücher über sie geschrieben, Fernsehserien zeichnen ihr ungewöhnliches Leben nach, in einem Manga für junge Mädchen wird sie als Heldin gefeiert, und so mancher japanische Tourist auf Europa-Reise erweist ihr an ihrem Grab auf dem Hietzinger Friedhof, wo sie seit 1941 unter dem Christuskreuz, dem Familienwappen der Coudenhove-Kalergi, einem Mutter-Kind-Relief und dem Vater-unser-Zitat »Zukomme uns dein Reich« ruht, seine Reverenz. Es ist eine stattliche Gruft, die mit Ausnahme des Mädchennamens jeden Hinweis auf die ferne Herkunft der Toten vermissen lässt, und so lassen manche der Besucher, den Mangel kompensierend, japanische Souvenirs auf den Stufen zurück: Reiskuchen und Sake.
Und mancher Eingeweihter legt bei dieser Gelegenheit auch die paar Schritte zu dem nahen Klimt-Grab zurück: Die Affinität so vieler japanischer Kunstkenner zum Wiener Jugendstil rührt von den starken Einflüssen her, die die japanische Malerei auf Gustav Klimts Werk ausgeübt hat.