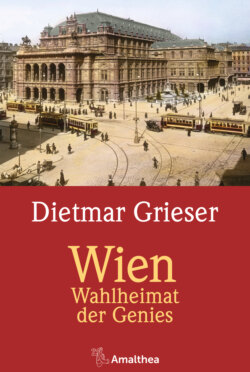Читать книгу Wien - Dietmar Grieser - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wahlwiener in der Politik Der Söldner aus Paris Prinz Eugen von Savoyen
ОглавлениеAlfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie und leidenschaftliche Sigmund-Freud-Antipode, hat dem Phänomen eines seiner Hauptwerke gewidmet: Studie über die Minderwertigkeit von Organen. Kernaussage: Jeder Mensch ist von seinem organischen Aufbau her unvollkommen. Aber ebendiese Minderwertigkeit ist es, die ihn zu außergewöhnlichen Kompensationsleistungen anspornen kann. Beispiel Clara Schumann: Weil sie von Kindheit an unter Sprechstörungen leidet, geht sie umso mehr in der Musik auf und wird zur meistgefeierten Klaviervirtuosin ihrer Zeit. Demosthenes, der größte Redner der griechischen Antike, ist von Haus aus ein Stotterer, der Komponist Friedrich Smetana leidet an einem Gehörfehler, der Maler Toulouse-Lautrec ist aufgrund einer Erbkrankheit kleinwüchsig und hinkt.
Auch Prinz Eugen ist ein »Zwerg«. Wenn man Alfred Adlers Theorie folgt, wird er nicht trotzdem, sondern eben deswegen der größte Feldherr seiner Zeit.
Kaiser Wilhelm II., dessen linker Arm verkümmert ist, legt sich ein besonders säbelrasselndes Gehabe zu – Schulbeispiel für Alfred Adlers zweite These: Organische Unzulänglichkeit stachelt nicht nur zu Kompensationsleistungen an, sondern begründet auch den Drang zur Macht. Um sich zu behaupten, versucht der scheinbar Unzulängliche umso vehementer, seine Mitmenschen zu beherrschen.
Als der knapp zwanzigjährige Eugen Franz von Savoyen-Carignan den Entschluss fasst, das Habit des Geistlichen, das ihm so gar nicht passen will, gegen den Militärrock zu tauschen, und König Ludwig XIV. seine Dienste anbietet, weist ihn dieser aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit schroff zurück und treibt ihn so ins Lager Österreichs: Kaiser Leopold I. nimmt den verfemten Fremdling mit offenen Armen auf. Genau sechs Monate nach der demütigenden Audienz am Pariser Hof von Versailles betritt Eugen zum ersten Mal jene Stadt, die ihm fortan zur zweiten Heimat werden soll: Wien.
Der am 18. Oktober 1663 im Hôtel de Soissons zu Paris Geborene ist das fünfte Kind des Grafen Eugen Moritz von Savoyen-Carignan, der sich zwar verwandtschaftlicher Beziehungen mit drei der großen Herrscherhäuser Europas – den Bourbonen, den Habsburgern und den Wittelsbachern – rühmen darf, selbst aber, ein unbedeutender General der französischen Armee, am Spieltisch bessere Figur macht als auf dem Schlachtfeld. Die Mutter ist Italienerin: Olympia von Manzini, eine Nichte des Kardinals Mazarin, der bis zum Ablauf der Minderjährigkeit des späteren Sonnenkönigs die Geschicke Frankreichs lenkt, erfreut sich der Gunst des Hofes, solange Ludwig XIV. sich ihrer als Mätresse bedient – später, als Verstoßene, schlägt’s ins genaue Gegenteil um. Eugens Elternhaus, übrigens auch nicht mit materiellen Gütern gesegnet, könnte man also eine gute Familie mit schlechtem Ruf nennen.
Eugen ist noch keine zehn Jahre alt, da wird er Halbwaise: Ein mysteriöses Fieber beendet das Leben des erst 38-jährigen Vaters. Als sechs Jahre darauf in Paris eine Serie von Giftmorden aufgedeckt wird, für die man die Wahrsagerin und Quacksalberin Catherine Deshayes verantwortlich macht, droht auch Eugens Mutter Olympia ein Strafprozess: Die beiden Frauen, heißt es, hätten miteinander konspiriert. Und obwohl der Verdacht des Gattenmordes jeglicher Grundlage entbehrt, ist das schlimme Gerücht nicht zum Verstummen zu bringen, teuflische Intrigen bei Hof tun ein Übriges, und so bleibt der Vierzigjährigen keine andere Wahl, als den Weg in die Verbannung anzutreten: Sie flieht nach Brüssel.
Im Hôtel de Soissons übernimmt unterdessen Eugens Großmutter das Regiment: Für den 17-Jährigen brechen freudloskarge Zeiten an. Statt mit Leuten von Stand verkehrt er mit den Kammermädchen und Bediensteten; die tratschsüchtige Liselotte von der Pfalz, die in die Verhältnisse Einblick zu haben scheint, nennt den Prinzen in einem Brief an die Kurfürstin Sophie von Hannover einen »schmutzigen, gar liederlichen Buben, der zu nichts Rechtem Hoffnung gibt«. Auch seiner äußeren Erscheinung kann sie nur wenig abgewinnen: »Wenn Prinz Eugen nicht anders geworden ist, werden Euer Liebden ein kurz aufgeschnupftes Näschen, ein ziemlich langes Kinn und so kurze Oberlefzen sehen, daß er den Mund allzeit ein wenig offen hat und zwei breite Zähne sehen läßt …«
Was soll aus so einem verwachsenen »Gnom« werden? Die Familie denkt an Abschiebung, Mutter Kirche möge sich seiner annehmen; als Gegenleistung wird die Abtretung von Pfründen in Savoyen und Piemont erwogen. Kaum den Kinderschuhen entwachsen, wird Eugen also – es ist das Jahr 1681 – zum »Abbé« geweiht. Ihn selbst reizt die geistliche Laufbahn freilich kein bisschen – bereits als Halbwüchsiger hat er die Lektüre Cäsars und Alexanders des Großen dem Studium der Heiligen Schrift vorgezogen, und so legt er schon nach Kurzem – in einem beispiellosen Akt des Aufbegehrens – die geistlichen Gewänder ab und taucht, aus dem Elternhaus verstoßen, im Freundeskreis unter. Von einem ominösen Bader ist die Rede, der ihm Unterschlupf gewährt, von gutgestellten Mitgliedern der Pariser jeunesse dorée, die ihm zu Darlehen verhelfen, von »schönen Pagen«, mit denen es zu homoerotischen Ausschweifungen kommt. Wieder zeigt sich Liselotte von der Pfalz vortrefflich informiert, in einem Brief an eine ihrer Freundinnen schreibt sie: »Als er den geistlichen Habit quittierte, hießen ihn die jungen Leute nur Madame Simone und Madame Cansiene, denn man pretendierte, daß er oft bei jungen Leuten die Dame agierte. Da seht ihr wohl, daß ich den Prinzen Eugen gar wohl kenne.«
Unter seinen Vertrauten ist ein gewisser Louis-Armand Conti ein besonders enger Freund. Vermählt mit einer legitimierten Tochter Ludwigs XIV. aus dessen Liaison mit der Herzogin de la Vallière, verfügt dieser über beste Beziehungen zum Hof und kann für Eugen im März 1683 eine Audienz beim König erwirken. Der 19-Jährige möchte sich als Offizier bewähren, ersucht Seine Majestät um einen guten Platz in der Armee. Doch ob es nun seine wenig stattliche Erscheinung ist oder gar das Zerwürfnis seiner Mutter mit dem Monarchen, der die einstige Geliebte aus Frankreich verbannt hat – Ludwig XIV. weist den Petenten brüsk ab. In späteren Jahren auf diesen Vorfall angesprochen, wird der König laut Überlieferung antworten: »Die Bitte war bescheiden, aber der Bittsteller nicht. Noch nie nahm sich jemand heraus, mir so frech wie ein zorniger Sperber ins Gesicht zu starren.«
Der »zornige Sperber«, zutiefst enttäuscht und verletzt, fasst daraufhin den Entschluss, der Heimat, die seine Dienste so schnöde verschmäht, den Rücken zu kehren und sein Glück bei den Habsburgern zu versuchen, die gerade alle Hände voll zu tun haben, dem Vormarsch der Türken auf Wien Einhalt zu gebieten. Österreich braucht tüchtige Soldaten, fieberhaft ist Kaiser Leopold I. am Werk, ein Entsatzheer aufzustellen, das die Hauptstadt von ihrer Umklammerung durch die Osmanen befreien soll. Ist nicht auch schon Eugens älterer Bruder Ludwig Julius zu den Österreichern übergelaufen? Im Gefecht bei Petronell von den Türken verwundet, stirbt er in Wien und wird im Dom zu St. Stephan beigesetzt.
Prinz Eugen tritt die Flucht aus Frankreich nicht allein an: Auch der junge Louis-Armand Conti, der ihm die enttäuschende Audienz bei König Ludwig XIV. verschafft hat, ist mit von der Partie. Doch die Ausreißer, Eugen mit Frauenkleidern getarnt, kommen nur bis Frankfurt. Nach einem Gewaltritt über die Grenze gelingt es Joseph de Xaintrailles, dem Sonderbevollmächtigten des Königs von Frankreich, die beiden einzuholen, zu stellen und einen von ihnen sogar zu reumütiger Rückkehr zu bewegen: Conti. Eugen hingegen, weder durch Versprechungen noch durch Drohungen einzuschüchtern, setzt seine Reise ins Ungewisse fort, reitet allein weiter, nimmt in Regensburg Empfehlungsbriefe in Empfang, die ihm seine in der Verbannung lebende Mutter aus Brüssel hat zukommen lassen, und erreicht schließlich Passau, wo der österreichische Kaiserhof auf der Flucht vor den Türken eine provisorische Bleibe gefunden hat.
Eugen spricht kein Wort Deutsch. Neben der französischen Muttersprache beherrscht er Italienisch, und aus der Zeit, da er die geistliche Laufbahn einschlagen sollte, verfügt er selbstverständlich auch über gute Lateinkenntnisse. So wird er die Bittschrift, mit der er den Habsburgern seine Dienste offeriert, in lateinischer Sprache abfassen. Kaiser Leopold I., nun in den engen Mauern des Passauer Bischofspalastes residierend, nimmt das Papier persönlich entgegen – Marchese Borgomanero, der spanische Bevollmächtigte, vermittelt die Audienz. Eugen scheint auf den ebenso klugen wie einflussreichen Mann nachhaltigen Eindruck gemacht zu haben.
Kommt ohne ein Wort Deutsch nach Wien: Prinz Eugen
Ein eigenes Regiment erhält er dennoch nicht: Eugen muss sich mit der Rolle eines »Volontärs« begnügen, dient als Ordonnanzoffizier in der Brigade seines Vetters Ludwig Wilhelm von Baden. Aber er ist nun immerhin einer vom kaiserlichen Heer, und bei der Entscheidungsschlacht vor Wien, die am 12. September den Sieg über Kara Mustafas Truppen bringt, besteht der knapp Zwanzigjährige unter Herzog Karl Leopold von Lothringen seine Feuertaufe. Noch am Abend des nämlichen Tages – die Osmanen treten den Rückzug an, die befreite Stadt bricht in Jubel aus – betritt der junge Söldner aus Paris zum ersten Mal Wien. Und nur zwei Monate später, am 14. Dezember 1683, sieht er sich am Ziel seiner Träume: Eugen Franz von Savoyen Carignan wird zum Obersten befördert und erhält das Kommando über das Dragonerregiment »Khueffstein«.
Der Rest ist Weltgeschichte: ein Zugereister auf der ersten Stufe der Karriereleiter in der neuen Heimat, deren Ruhm er in den folgenden 52 Jahren als Feldherr, Staatsmann und kaiserlicher Berater, aber auch als Kunstsammler, Bauherr und Mäzen aufs Glanzvollste mehren wird. Prinz Eugen, der edle Ritter.