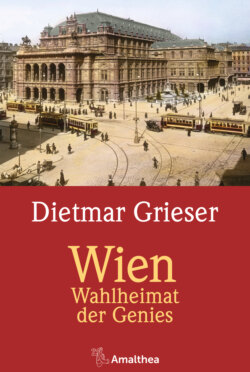Читать книгу Wien - Dietmar Grieser - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеAls Römer, so sagen die Römer, muss man geboren sein. Berliner, so wissen wir seit Kennedy, wird man kraft Bekenntnisses.
Wie wird man Wiener?
Durch Übersiedlung?
Durch Anpassung?
Aus Überzeugung?
Am Ende gar aus Liebe?
In diesem Buch wird der Versuch unternommen, der Sache auf den Grund zu gehen – an ausgewählten Beispielen aus vergangener wie neuerer Zeit. Ihnen allen – dreißig von Tausenden und Abertausenden – ist Wien zur Wahlheimat geworden. Doch wie ist es dazu gekommen, wie hat es funktioniert? Was an dieser Stadt hat sie angezogen, wie hat sie sie aufgenommen, und womit haben sie – im Gegenzug – sich revanchiert?
Leicht ließe sich ein ganzes Lexikon mit ihren Namen füllen. Das Wiener Telefonbuch verrät es auf einen Blick: Die Hauptstadt der Republik Österreich ist in ethnischer Hinsicht ein Sammelbecken sondergleichen. Und in noch ungleich höherem Maße galt dies für die Zeit, da Wien die Metropole eines großen Reiches war: Europas Kulturgeschichte der Neuzeit ist zu einem Gutteil eine Geschichte der in Wien heimisch gewordenen Zuzügler.
Prinz Eugen kam aus Frankreich, Gerard van Swieten und Nikolaus von Jacquin aus den Niederlanden, Theophil Hansen aus Dänemark, Lorenzo Da Ponte und Antonio Salieri aus Venetien, Raoul Aslan aus Griechenland, der spanischstämmige Alfred Piccaver aus England. Beethoven und Brahms, Gluck und Schikaneder sind gebürtige Deutsche, desgleichen Metternich und Gentz, Fernkorn und Semper, Billroth, Thonet und Hebbel. Johann Ulrich Megerle, der sich in Wien Abraham a Sancta Clara nannte, stammte aus dem Badischen, Goethes Schwiegertochter Ottilie aus Westpreußen. Michiko Tanaka und Mitsuko Aoyama waren Japanerinnen, und Angelo Soliman, das vielleicht wunderlichste Exemplar in dieser Galerie der Wahlwiener, kam aus Afrika.
Kommen wir zu den Lebenden: Wander Bertoni, 1925 in der italienischen Provinz Reggio Emilia geboren, kam mit 18 als Zwangsarbeiter nach Österreich – zur »Wahlheimat« wurde es ihm erst mit den ersten großen Nachkriegserfolgen als Bildhauer. Der Pantomime Samy Molcho stammt aus Israel, die Pianistin Elisabeth Leonskaja aus Russland, die Sängerin Olive Moorefield aus den USA. Die Muttersprachen der Schriftsteller Ilja Trojanow und Radek Knapp sind Bulgarisch beziehungsweise Polnisch; die ersten Worte, die der Gastronom Attila Doğudan sprach, waren türkisch, die der Opernsängerin Mimi Coertse afrikaans. Dass Letztere, über drei Jahrzehnte einer der Lieblinge des Wiener Publikums, in späteren Jahren in ihre Heimat Südafrika zurückkehrte, haben manche nicht verstanden, so eng war Mimi Coertse mit Wien verbunden (wo sie nicht nur auf der Staatsopernbühne, sondern – man denke – auch mit Wienerliedabenden brillierte!).
Die Liste der prominenten Wahlwiener, ob lebend oder verstorben, ließe sich in jegliche Richtung fortsetzen. Aber sind sie deswegen auch schon allesamt Genies im klassischen, im strengen Wortsinn? Nicht erst die jüngste Ausgabe des Duden meidet alles Elitäre, lässt auch Meisterschaft und Ideenreichtum als »genial« gelten, Scharfsinn und Talent. Was unsere Kandidatinnen und Kandidaten – und mit ihnen eine Riesenzahl Namenloser, ob böhmischer Schneider oder Gottscheer Amme, ob bosnische Programmiererin oder persischer Kinderarzt – jedenfalls gemeinsam haben: Von fernher zugezogen, haben sie ihre weit über dem Durchschnitt liegende Lebensleistung allesamt in Wien erbracht. Und damit Wien um ebendiese bereichert. Fremdenfeindlichkeit ist eines der Schlagworte unserer Tage, und auch oder gerade Wien hat sich damit herumzuschlagen. Im vorliegenden Buch geht es um das Gegenteil: um Fremdenfreundlichkeit. Und um die Früchte, die diese Fremdenfreundlichkeit getragen hat und trägt.
Leser meiner Bücher haben mir, als sie von meinem neuen Buchprojekt erfuhren, zugeredet, bei dieser Gelegenheit auch einiges zu meiner eigenen Person zu sagen – ich sei doch ebenfalls ein gutes Beispiel dafür, wie ein Zugereister Teil dieser Stadt werden, in Wien zu beruflicher Erfüllung, ja zu seinem Lebensglück finden kann.
Also gut, ein paar Streiflichter aus jener Übergangsphase, da sich der Wunsch des Kennenlernens zum Entschluss des Dableibens verfestigte, will ich gern beisteuern. Wer sich davon freilich eine feierliche Deklaration, das große patriotische Credo erwartet, wird enttäuscht sein: Mehr als in jeder anderen Stadt sind es in Wien die kleinen Dinge des Alltags, die über Affinität (oder auch Abneigung) entscheiden. Ich hatte das Glück, vom ersten Tag an in Richtung Affinität punkten zu können.
In Hannover geboren, in Oberschlesien beziehungsweise der Saarpfalz aufgewachsen, war nach Lehrjahren in Münster wohl auch ein erster Auslandsaufenthalt fällig. Einer meiner Professoren, selbst in hohem Maße Wien-affin, schickte mich in die Stadt an der Donau. Das war damals, drei Jahre nach Abschluss des österreichischen Staatsvertrages, töricht bis tollkühn (an Vorsehung mag ich nicht glauben). Wenn, dann ging man zu jener Zeit den umgekehrten Weg: In Deutschland war mehr zu verdienen, die Leute waren besser gekleidet, undenkbar dort solche trödelnden Straßenbahnen, solche abscheulichen Wohnungen mit Stiegenhaus-Klo.
Ich kam mit dem Nachtzug auf dem Westbahnhof an, also auch noch zu einer unmöglichen Zeit: 6 Uhr früh. Und dann dieser missmutige Kleinbeamte am Gepäckschalter, der meinen Koffer in Verwahrung nahm, das fensterlose Hotelzimmer im Dunstkreis der Donaukanalratten, nur ein Masochist konnte solch geballter Unbill Reize abgewinnen. Es war wohl ein bisschen so, wie man später aus dem Westen in den Osten reiste – es deprimiert, aber es richtet zugleich auch auf: Da hat’s unsereins halt besser, schau dir das ein paar Tage an, dann nix wie wieder weg.
Ich aber blieb.
Es traten Ereignisse in mein neues Leben, die mich in eine Art permanentes Entzücken versetzten – und zugleich in Neugier, was denn wohl das Nächste sein werde. Eine Phase nicht enden wollender Prolongierungen.
Ich wohnte damals mitten im Warenhausviertel der Mariahilferstraße, in einer der weniger turbulenten Seitengassen kaufte ich meine täglichen Lebensmittel ein. Ich war Stammkunde, man kannte meine Präferenzen, die Frau am Wurststand rief, sobald sie meiner ansichtig wurde, schon von Weitem ihr fröhliches »Zehn Deka Baskische – wie immer?«, und ich bejahte ebenso fröhlich. Auch als ich der »Baskischen« längst überdrüssig war, blieb ich dabei – die Ärmste hätte sich’s zu Herzen genommen.
Dann, von einem bestimmten Tag an, blieb die Baskische aus, und so sehr sich die Händlerin auch bemühte, der Artikel war nicht wieder aufzutreiben. Mir kam es wie gerufen, nur sie schien damit nicht fertigzuwerden – immer wieder kam sie auf den wunden Punkt zurück, klagend das eine, zuversichtlich das andere Mal: Nur nicht verzagen, noch sei nicht alles verloren, sie werde schon wieder geliefert werden, die Baskische.
Es kam der Tag, an dem ich aus dem 7. in den 3. Bezirk umzog, natürlich ging ich nun in andere Geschäfte einkaufen, und so sehr ich es mir auch vorgenommen hatte: Nie wieder betrat ich meinen lieben alten Greißlerladen von einst.
Drei Jahre später kam ich an einem Sonntag, auf dem Weg zu einem Bekanntenbesuch, durch das bewusste Viertel. Eine Frau mittleren Alters, sonntäglich aufgeputzt, versperrte mir unter tausend Entschuldigungen den Weg: »Nicht bös’ sein, dass ich Sie mitten auf der Straße ansprech’, aber ich wollt’ Ihnen nur sagen, die Baskische wär’ wieder da.«
Es war die Frau vom Wurststand. Sie war fest davon überzeugt, dass ich nur ausgeblieben war, weil sie mit ihren Bemühungen um die Wiederbeschaffung der Baskischen gescheitert war. Nun endlich, nach Jahren, war die Sache aus der Welt geschafft.
Es mag schon sein, dass es in den großen Dingen sehr oft drunter und drüber geht in dieser Stadt – in der Art, wie sie sich in die kleinen verbeißt, im Bösen wie im Guten, stellt sie tagtäglich ihre eigenen Rekorde ein.
Als seinerzeit die Mode der schulterlangen Männerhaare auch Österreich (und mich) erreichte, kam das Wort auf: »In Wien drehen sich sogar die Langhaarigen nach den Langhaarigen um.« Na schön, anderswo laufen sie eben aneinander vorbei. Auch das Sich-Umdrehen aus Missgunst ist noch immer eine Art von Kommunikation.
Das Café H. im 3. Bezirk wurde mein erstes Stammquartier. Es lag günstig, nahm mich durch seinen unprätentiösen Gebrauchscharakter für sich ein und ließ sich vor allem in jeder gewünschten Weise nutzen. Ich weiß, es riecht nach Anekdote, doch es ist die reine Wahrheit: Wann immer ich eine heikle Situation zu bestehen, eine schwierige Verhandlung zu führen hatte, wählte ich dieses Lokal zum Austragungsort und gab den Besitzerinnen – zwei Schwestern, die sich den Tag- und Nachtdienst teilten – vorher die entsprechenden Direktiven: wie ich im gegebenen Fall anzureden, welche Aura um mich zu verbreiten, mit welchen Stichworten mir beizustehen sei. Es hat jedes Mal vorzüglich geklappt, und ich täusche mich nicht: Es hat den beiden auch noch Spaß gemacht.
So also wird man Wiener?
Es ist der Punkt gekommen, wo ich gestehen muss: Auch Erpressung war im Spiel. Es war zu einer Zeit, als ich ganz gut verdiente, eine mir befreundete Familie hatte einen momentanen finanziellen Engpass zu überwinden, ich sprang mit einem Darlehen ein. Schon wenige Monate später wäre ohne alle Mühe die Rückzahlung möglich gewesen, dennoch wurde sie von Jahr zu Jahr hinausgeschoben – und immer mit der Begründung: Du weißt, wie sehr wir an dir hängen, wir wollen nicht, dass du auf dumme Gedanken kommst, am Ende gehst du weg aus Wien, wir haben beschlossen, das Geld auf ein Sperrkonto zu legen. Am Tag, als ich im Wiener Rathaus mein frisches Staatsbürgerschaftsdekret in Händen hielt, wurde das Konto geöffnet – wohlverzinst.
Selbstverständlichkeiten darf ich hier beiseitelassen: dass es mir längst auch die Schönheit der Stadt angetan hatte, ihr kultureller Reichtum, das riesige Reservoir, aus dem ich schöpfen konnte, als ich begann, Bücher zu schreiben. Wien war und ist die ideale Bodenstation für meine literaturtopografischen Umtriebe. Alles an einem Ort, alles in Reichweite: Bibliotheken und Kunstsammlungen, Kulturinstitute und Botschaften, Verkehrsmittel und – die »richtigen Leut’«.
Bald kam auch das anheimelnde Echo aufs erste Österreich-Buch: die stolze Hausbesorgerin, die darauf bestand, das Ereignis mit einem wappengeschmückten Guglhupf zu feiern, der patriotische Ministerialrat, der sich zu der Wunschvorstellung verstieg, den schreibenden Neubürger (wortwörtlich) »in die österreichische Nationalflagge einzuwickeln«. Gleichzeitig konnte ich lässig auf totale Assimilierung verzichten. Niemand hinderte mich daran, weiterhin »hinten« zu sagen, wenn ich – wie ortsüblich – »rückwärts« in die Straßenbahn stieg; im Gegensatz zu Bayerns Preußen kam ich ohne alle Landestrachtanbiederung aus, und wenn man, einem hiesigen Hang zur Slawisierung folgend, meinen deutschen Familiennamen mitunter zum böhmischen »Krisa« verfremdete, wertete ich es als Zeichen gelungener Integration in meine Wahlheimat Wien.
Doch genug von mir. Wenden wir uns den anderen zu, den Großen, den Berühmten. Wie lief’s bei denen?