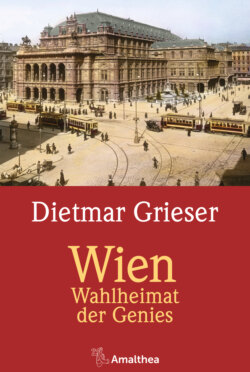Читать книгу Wien - Dietmar Grieser - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Kammerdiener Seiner Majestät Jean Baptiste Cléry
ОглавлениеWien ist reich an ungewöhnlichen Friedhöfen. Und an ungewöhnlichen Gräbern. Dieses aber ist unter ihnen allen eines der ungewöhnlichsten: Es befindet sich in einer der älteren Abteilungen des Hietzinger Friedhofs, trägt die Nummer III/6 und ist, ansonsten schmucklos, mit einem Stein aus dunkelgrauem Granit ausgestattet, der dem Besucher nicht weiter auffiele, wäre da nicht, schon stark verwittert, die geheimnisvolle Inschrift: »Le fidèle Cléry, dernier serviteur de Louis XVI.«
Des Französischen Unkundige haben in den Sterbematrikeln aus dem Adjektiv »fidèle« den Vornamen »Fidèle« gemacht, doch einen Mann dieses Namens gab und gibt es nicht. Der hier seit dem 27. Mai 1809 unter der Erde ruht, heißt mit vollem Namen Jean Baptiste Cléry. Um seine irrtümlich verschleierte Identität zu klären, genügt es, die 1848 erneuerte Grabinschrift zu entziffern und mit Sorgfalt ins Deutsche zu übersetzen: »Der treue Cléry, letzter Kammerdiener Ludwigs XVI.«
Ludwig XVI. – das ist der mit der Österreicherin Marie Antoinette vermählte Franzosenkönig, der, neun Monate vor dieser, auf dem Schafott des Revolutionstribunals hingerichtet wird. Wie kommt sein Domestik nach Wien?
Ludwig XVI., König von Gottes Gnaden, ist 28 und seit acht Jahren auf Frankreichs Thron, als Jean Baptiste Cléry, aus der Gegend um Versailles stammend und fünf Jahre jünger als Seine Majestät, in dessen Dienste tritt. Als im Sommer 1792 die Tuilerien gestürmt und die königliche Familie im »Temple«, jener düsteren Zwingburg in der Gegend der heutigen Place de la République, festgesetzt wird, begleitet Cléry den König (den die Revolutionäre Louis Capet nennen), die Königin, den kleinen Dauphin, Tochter Marie Thérèse sowie Madame Elisabeth, die Schwester des Königs, auf deren Weg in die Gefangenschaft.
In den den königlichen Arrestanten zugewiesenen Räumlichkeiten im dritten und vierten Stock des im 13. Jahrhundert von den Tempelrittern errichteten und seit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 leer stehenden Gebäudekomplexes außerhalb der Pariser Stadtmauern sorgt der seinem Herrn unterwürfig ergebene Cléry für das leibliche Wohlbefinden des Königs – bis zu dessen letztem Atemzug auf der Guillotine. Zwei Tätigkeiten sind es insbesondere, die dem sensiblen Mann nahegehen: Er soll Seiner Majestät die schon fadenscheinig werdende Kleidung in Ordnung halten, und er muss ihm, da im Temple strengstes Messer- und Gabelverbot besteht, das Essen vorschneiden.
Während dieser fünf Monate wird der inzwischen 33-Jährige – neben den Mitgliedern der königlichen Familie – zum engsten Vertrauten des todgeweihten Monarchen: Sein Bett steht neben dem des Königs. In seinem »Tagebuch über die Vorgänge im Temple während der Gefangenschaft von Louis XVI.«, das ihn später berühmt, ja sogar zu einem reichen Mann machen wird, wird er über den Alltag im Gefängnis aussagen:
»Der König stand gewöhnlich um 6 Uhr morgens auf; er rasierte sich selbst, dann frisierte ich ihn und half ihm beim Ankleiden. Gleich darauf ging er ins Lesezimmer. Weil dieser Raum sehr klein war, blieb der Kommissar im Schlafzimmer – jedoch bei halboffener Tür, um den König ständig beobachten zu können. Seine Majestät betete kniend fünf bis sechs Minuten lang, anschließend las er bis 9 Uhr. Inzwischen räumte ich sein Zimmer auf, deckte den Tisch fürs Frühstück und ging sodann hinunter zur Königin. Ich frisierte den kleinen Prinzen, half der Königin bei der Toilette und begab mich in das Zimmer von Madame Royale und Madame Elisabeth, um diesen den gleichen Dienst zu erweisen. Dieser Augenblick der Toilette bot Gelegenheit, die Königin und die Prinzessinnen von Dingen, die ich erfahren hatte, in Kenntnis zu setzen. Ein Zeichen von mir machte deutlich, daß ich ihnen etwas zu sagen hätte; daraufhin begann eine von ihnen ein Gespräch mit dem Kommissar und lenkte diesen dadurch ab. Um 10 Uhr ging Seine Majestät ins Zimmer der Königin hinunter und verbrachte dort mit seiner Familie den Tag. Er widmete sich der Erziehung seines Sohnes, ließ diesen einige Stellen aus Corneille und Racine aufsagen oder gab ihm Geographiestunden und Anweisung im Kartenzeichnen. Die Königin befaßte sich ihrerseits mit der Erziehung ihrer Tochter. Danach wurde genäht, gestrickt oder gestickt. Um 1 Uhr ließ man die königliche Familie bei Schönwetter in den Garten gehen, und ich spielte bei dieser Gelegenheit mit dem kleinen Prinzen Ball oder mit der Wurfscheibe, ließ ihn laufen und andere Übungen machen. Um 2 Uhr gingen wir in den Turm zurück, wo ich das Mittagessen servierte.«
In diesem Stil geht es in Clérys Protokoll weiter – bis zur Schilderung der Nachtruhe, die König und Kammerdiener Seite an Seite genießen. Auch sonst ist man gewohnt, alles miteinander zu teilen, und eines Morgens, als Cléry infolge eines Versäumnisses seiner Aufpasser beim Frühstück leer ausgeht, reicht ihm der König eine Hälfte seines Brotes: »Nehmen Sie dies, mir genügt der Rest.« Cléry lehnt das Angebot beschämt ab, doch der König besteht darauf.
»Da konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten, und als Seine Majestät dies bemerkte, ließ auch er den seinen freien Lauf.«
Die Stunde der Hinrichtung naht, Louis XVI. setzt sein Testament auf. Jean Baptiste Cléry, »der sich aus wahrer Anhänglichkeit zu mir an diesem Ort hat einschließen lassen, obwohl er fürchten mußte, Opfer seiner Treue zu werden«, möge man, so verfügt Seine Majestät, »meine Kleider, meine Bücher, meine Uhr, meine Börse und die anderen Kleinigkeiten aushändigen, die bei der Kommission deponiert worden sind«.
Am frühen Morgen des Hinrichtungstages ministriert Cléry dem Gefängnisgeistlichen bei der letzten Messe; kniend nimmt der Diener den Segen seines Königs entgegen. Die beiden letzten Handreichungen, die sich dieser von seinem treuen Gefolgsmann erbittet, scheitern am Einspruch des Aufsichtspersonals: Weder darf er dem König, wie dieser es wünscht, die Haare schneiden, noch darf er ihm auf dem Schafott aus den Kleidern helfen. Lakonischer Bescheid des Kommissars: »Der Henker ist gut genug für ihn.«
Letzter Eintrag in Clérys Tagebuch: »Ich blieb allein im Zimmer zurück, von Schmerz übermannt und beinahe von Sinnen. Trommeln und Trompeten verkündeten, daß Seine Majestät den Turm verlassen hatte. Eine Stunde später hörte man Artilleriesalven und Rufe ›Es lebe die Nation! Es lebe die Republik!‹ Der beste aller Könige war nicht mehr …«
Jean Baptiste Cléry, schon vor der Revolution in königlichen Diensten, darf bei den neuen Herren mit keinerlei Nachsicht rechnen: Bis 1. März im Temple unter Arrest gestellt, wird er sechs Monate später auf seinem Landsitz, wohin er sich nach seiner Entlassung zurückgezogen hat, aufs Neue verhaftet und für die Dauer eines Jahres eingesperrt. 13-mal auf die Liste der Hinzurichtenden gesetzt, wird sein Name gleichwohl regelmäßig von unbekannter Hand gelöscht, und nach dem Sturz Robespierres im August 1794 geht Cléry endgültig frei.
In Straßburg, wo sein älterer Bruder ein Handelshaus unterhält und als Armeelieferant gut im Geschäft ist, findet er als Rechnungsprüfer Unterschlupf, gleichzeitig beginnt er mit der Abfassung seiner Erinnerungen an jene fünf Monate im Temple; ein verschwiegener Schreiber geht ihm dabei zur Hand. Als das Gerücht aufkommt, Madame Royale, die Tochter »seines« Königs, solle im Austausch gegen französische Gefangene auf österreichisches Gebiet entlassen werden, unternimmt Cléry alles, sich ihr anzuschließen und fortan Prinzessin Marie Thérèse zu dienen. Nur – so einfach ist das nicht. Erstens zieht sich das Austauschverfahren in die Länge, zweitens hat er weder Pass noch Geld, und drittens müsste er seine Familie – Frau und drei Kinder – in Frankreich zurücklassen. So schickt ihn sein Bruder zum Schein auf Geschäftsreise in die Schweiz, und bei Basel gelingt es Cléry mit Hilfe von Freunden, heimlich die Grenze nach Österreich zu passieren. Via Augsburg gelangt er nach Wien, in Wels kommt es zu einem kurzen Zusammentreffen mit der 17-jährigen Marie Thérèse.
Aus seinem Plan, in deren Dienste zu treten, wird freilich nichts: Österreich und Frankreich stehen miteinander im Krieg; der Wiener Hof unternimmt alles, die beiden voneinander fernzuhalten. Nur für sein Auskommen ist gnädig gesorgt: noch am 31. Jänner 1796 erteilt Kaiser Franz II. Obersthofmeister Fürst Starhemberg die Weisung, dem Ankömmling eine Starthilfe von 100 Dukaten sowie eine Pension von jährlich 800 Gulden zu gewähren.
Auch die Wiener Gesellschaft nimmt den Franzosen freundlich auf; als sich seine Frau nach seinen Lebensumständen erkundigt, schreibt er ihr nach Frankreich, er diniere in den feinsten Wiener Häusern, ein Viertel des Tages bringe er »mit Promenaden, Visiten und Ruhen« zu. Seine Rolle in den letzten Tagen der französischen Monarchie macht Jean Baptiste Cléry zu einer interessanten Persönlichkeit in den tonangebenden Wiener Salons. Die berühmte Malerin Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun, die posthume Porträts des Königspaares vor Besteigen des Schafotts anfertigen will, lässt sich – von Petersburg aus – von Cléry in die Details einweihen, gibt jedoch, von seiner Darstellung geschreckt, ihren Plan wieder auf. Geschreckt ist auch Clérys jüngerer Bruder, der eine Stelle als königlicher Kammerdiener in Berlin innehat: Seit zwölf Jahren haben sie einander nicht mehr gesehen, also bittet der Jüngere den Älteren um ein Porträt. Als er den Brief öffnet und das eigens für ihn angefertigte Profil zur Hand nimmt, erfasst ihn Entsetzen: Das Martyrium im Temple hat aus dem noch nicht Vierzigjährigen einen Greis gemacht.
Ein neues Leben in Österreich: Jean Baptiste Cléry, der letzte Kammerdiener König Ludwigs XVI.
Jetzt geht es darum, Clérys »Journal de ce qui s’est passé pendant la captivité de Louis XVI.« zum Druck zu befördern. An interessierten Verlagen wäre kein Mangel, auch die Zahl der Subskribenten kann sich sehen lassen – nur die Wiener Regierung legt sich quer. Also reist Cléry mit seinem Manuskript nach London. Noch im selben Jahr 1798 verlässt die fingerdicke Broschüre mit dem Temple-Turm auf der Titel- und einem Faksimile der Handschrift Ludwigs XVI. auf der Rückseite die Druckerpresse. Übersetzungen in mehrere Sprachen folgen, bald kündigt die Wiener Buchhandlung Schaumburg & Co. auch eine deutsche Fassung an. Einen Gulden beträgt der Ladenpreis. Innerhalb von drei Tagen sind sämtliche 6000 Exemplare der ersten Auflage abgesetzt – ein Bestseller! Noch Jahre danach werden die Buchhändler stöhnen: »In ansehnlichen Büchersammlungen steckten oft bis zu zwanzig Exemplare; kein Antiquar-Katalog, kein Auktionsverzeichnis ohne ›Cléry-Journal‹; kein Mensch in Wien, der es nicht wenigstens gesehen hatte; die Stadt war überschwemmt damit.«
Auch die Wiener Presse stürzt sich auf das Thema: Sollte das Journal nicht eigentlich erst fünfzig Jahre nach dem Tod seines Autors das Licht der Öffentlichkeit erblicken? Und wohin mag das Manuskript geraten sein? »Ist es in Wien aufbewahrt – und bei wem? Das weiß der Himmel!« Spärlich auch, was man über die Person des Autors zu berichten weiß: »Monsieur Cléry war ein anständiger Mann. Er hatte Geist wie alle französischen Kammerdiener, aber seine Seele war geknickt, und Gram zehrte an seiner Lebenskraft.«
Mit 44 lässt sich Cléry (der auch eine Reihe von Reisen im Auftrag des späteren Louis XVIII. unternimmt) ein letztes Mal in Paris blicken: Er will seine Kinder wiedersehen. Sohn Karl ist Offizier, die Töchter Benedikta und Hubertine sind Gesellschaftsfräulein in adeligen Häusern. Und Gattin Marie Elisabeth geborene Duverger? Es scheint, wie wenn sie ihren Platz längst an eine Wiener Lebensgefährtin ihres Mannes habe abtreten müssen: an jenes geheimnisumwitterte Fräulein Adelaide Gaudelet, das in Clérys Testament auffallend generös bedacht werden wird … Dass er seinen für drei Monate bemessenen Aufenthalt in Paris vorzeitig abbricht, hat allerdings andere Gründe: Da er nicht bereit ist, der von ihm betriebenen französischen Ausgabe des Journal ein Napoleonfreundliches Nachwort hinzuzufügen, fällt er bei den französischen Behörden in Ungnade und muss neuerlich das Weite suchen.
In Wien hat er es unterdessen zu Ansehen und Wohlstand gebracht: 40 000 Franken sind in englischen Staatspapieren angelegt, vom Rest erwirbt Cléry zwei Grundstücke auf der Löwelbastei. Als diese günstig weiterveräußert sind, kauft er sich auf der Mölkerbastei an, und hier, in einem ziegelgedeckten einstöckigen Haus mit sieben Wohnräumen und drei Küchen (damalige Anschrift: Kleppersteig 3), bezieht er bis zu seinem frühen Tod Quartier. Als er, eben fünfzig geworden, vier Tage vor seinem Ableben sein Testament abfasst, ist er vom »abzehrenden, schleichenden Fieber« bereits so geschwächt, dass seine zittrige Hand statt der Unterschrift nur noch fünf Kreuze zustande bringt. Sein letzter Wille verfügt das einfachste Begräbnis sowie zwanzig Seelenmessen, und da ihn der Tod nicht in seinem Haus in der Inneren Stadt, sondern in der Maxingstraße ereilt (wo sich vermutlich seine dort wohnhafte Lebensgefährtin Adelaide Gaudelet des Sterbenskranken annimmt), fällt auch für Hietzing einiges an Legaten ab: 20 Gulden für die Pfarre, 10 Gulden für die Normalschule. Auf dem Hietzinger Friedhof wird er auch zur ewigen Ruhe bestattet: am 27. Mai 1809, wenige Tage nach Napoleons Niederlage in der Schlacht bei Aspern. Die französische Botschaft in Wien kommt bis heute für die Grabkosten auf.
Überflüssig zu erwähnen, dass der ehemalige königliche Kammerdiener und spätere Bestsellerautor und Hausbesitzer sich in seinen letzten Wiener Jahren eigenes Personal leisten konnte. Und nach dem Beispiel seines einstigen Herrn, des Königs von Frankreich, der ihm kurz vor seiner Hinrichtung sein letztes bisschen persönliche Habe überschreibt, versäumt es auch Jean Baptiste Cléry in seinem Testament nicht, seinen Diener zu bedenken: »Je donne à mon domestique six chemises et tous mes habits.«
Sechs Hemden und alle seine Anzüge.