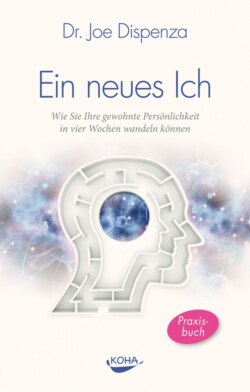Читать книгу Ein neues Ich - Джо Диспенза - Страница 15
Alles ist Materie, nichts ist Geist?
Alles ist Geist, nichts ist Materie?
ОглавлениеWissenschaftler und Philosophen gleichermaßen hatten schon immer ihre Schwierigkeiten damit, den Bogen zwischen der äußeren, physischen Welt und der inneren, mentalen Welt des Geistes zu schlagen und Zusammenhänge herzustellen. Für viele Menschen scheint der Geist auch heute noch nur sehr geringen bzw. keinen messbaren Einfluss auf die Welt der Materie zu haben. Wahrscheinlich herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass die materielle Welt mit ihren Konsequenzen sich auf den Geist auswirkt; doch wie kann der Geist umgekehrt die soliden, festen Bestandteile physisch verändern? Geist und Materie scheinen voneinander getrennt zu sein – allerdings nur, bis sich unser Verständnis von der Existenzweise des Physisch-Festen wandelt.
Ein solcher Wandel hat stattgefunden, und zwar vor noch nicht allzu langer Zeit. Das historisch als »die Moderne« bezeichnete Zeitalter war zum großen Teil von der Überzeugung geprägt, die Grundnatur des Universums unterliege einer gewissen Ordnung und sei somit vorhersehbar, berechenbar und erklärbar.
Man denke beispielsweise an den Mathematiker und Philosophen René Descartes: Er entwickelte im 17. Jahrhundert eine ganze Reihe von Konzepten, die bis in unsere heutige Zeit für die Mathematik und andere Wissensbereiche von großer Relevanz sind (»Ich denke, also bin ich« – na, klingt das nicht irgendwie bekannt?). Doch im Rückblick richtete eine seiner Theorien letztendlich mehr Schaden als Nutzen an. Descartes war ein Verfechter des mechanistischen Weltbilds – eines Modells, in dem das Universum berechenbaren Gesetzen unterliegt.
Im Hinblick auf das menschliche Denken stand Descartes vor einer echten Herausforderung: Der menschliche Geist mit seinen allzu vielen Variablen ließ sich nicht so einfach an irgendwelche Gesetzmäßigkeiten anpassen. Descartes schaffte es nicht, sein Verständnis der physischen Welt mit der Welt des Geistes in Einklang zu bringen, obwohl beides existierte, und so ersann er ein höchst elegantes Gedankenspiel: Da, so seine Überlegung, der Geist nicht den Gesetzmäßigkeiten der objektiven, physischen Welt unterworfen sei, sei es nicht möglich, ihn naturwissenschaftlich zu erforschen. Das Studium der Materie lag im Zuständigkeitsbereich der Naturwissenschaften (alles ist Materie, nichts ist Geist); der Geist wiederum war das Werkzeug Gottes, und dafür war die Religion zuständig (alles ist Geist, nichts ist Materie).
Descartes begründete im Wesentlichen ein Glaubenssystem, das von einer Dualität zwischen dem Konzept des Geistes und dem Konzept der Materie ausging. Jahrhundertelang war diese Trennung die anerkannte Basis für das Verständnis des Wesens der Wirklichkeit.
Sir Isaac Newtons Experimente und Theorien taten ein Übriges, um die kartesischen Überzeugungen weiterzuführen. Der englische Mathematiker und Naturwissenschaftler untermauerte nicht nur das Konzept eines Universums, das wie eine Maschine funktionierte, sondern stellte auch eine Reihe von Gesetzmäßigkeiten auf, die besagten, der Mensch könne die Funktionsweise der Welt mit ihren geordneten Bahnen ganz genau bestimmen, berechnen und vorhersagen.
Gemäß der »klassischen« Newton’schen Physik war alles fest. Energie konnte man beispielsweise als Kraft verstehen, die Objekte in Bewegung versetzte oder den physischen Zustand von Materie veränderte. Doch wie wir noch sehen werden, ist Energie viel mehr als eine äußere, auf materielle Dinge angewandte Kraft. Energie ist das eigentliche Gewebe aller Materie und reagiert auf den Geist.
Somit führte die Arbeit von Descartes und Newton zu einem Denken der Vorbestimmtheit: Wenn die Wirklichkeit mechanistisch funktionierte, hatte der Mensch kaum Einfluss auf die Resultate. Die gesamte Wirklichkeit war von vornherein festgelegt.
Ist es angesichts dieser Weltsicht ein Wunder, dass der Mensch sich nur schwer vorstellen konnte, seine Handlungen, geschweige denn seine Gedanken bzw. der freie Wille spielten im großen Plan eine Rolle? Sogar heute noch wird der Mensch oft als »Opfer der Umstände« gesehen.
Diese Überzeugungen beherrschten jahrhundertelang das Denken der Menschen, und es bedurfte revolutionärer Denkansätze, um Descartes und Newton wirklich etwas entgegensetzen zu können.