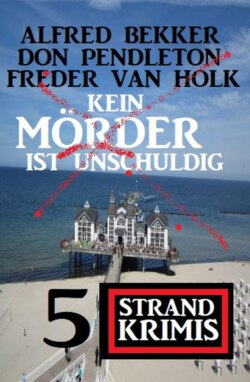Читать книгу Kein Mörder ist unschuldig - 5 Strand Krimis - Don Pendleton - Страница 7
Kubinke im Fadenkreuz Alfred Bekker
Оглавление1.
Ein Harry Kubinke Krimi
Der Berliner Kommissar Harry Kubinke gerät ins Visier eines kriminellen Clans aus dem Wedding. Gleichzeitig erschüttert eine Reihe von Morden die Bundeshauptstadt, bei denen ein Spezialgewehr für Scharfschützen eine Rolle spielt. Kubinke und sein Team müssen alles daransetzen, die Hintermänner zu finden. Für den Kommissar selbst wird dieser Fall eine Frage von Leben und Tod.
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2018 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbekker.de
Alfred Bekker: Kubinke im Fadenkreuz
––––––––
Kommissar HARRY KUBINKE ermittelt in Berlin.
Kommissar RUDI MEIER ist sein Kollege.
*
Ein dummes Gefühl, wenn man weiß, dass man sich im Fadenkreuz eines Killers befindet...
Das war in Kreuzberg vor einer urigen Kneipe, an deren Außenwand noch ein großer roter Stern und ein Anarchisten-Zeichen aufgemalt war. Man fühlte sich irgendwie in die Achtziger zurückversetzt, als die die Stadt voller Punks und Hausbesetzer gewesen war und alle möglichen Politsekten des linken Spektrums hier das Straßenbild geprägt hatten. Alternative, Anarchisten, Autonome...
Damals alles junge Leute, inzwischen aber in Jahre gekommen.
So wie der Inhaber der Kneipe. Sein Outfit war originalgetreu. Wer seine Figur über die Jahre behält, kann seine Sachen ewig tragen.
Seine Klamotten waren dieselben geblieben. Etwas ausgebleicht von unzähligen Wäschen, aber dieselben, so als wollte er ein einsames Fanal gegen den Konsumterror setzen. Nur er selbst hatte sich verändert. Er trug immer noch die Haare zu einem Zopf zusammengefasst, nur waren es inzwischen sehr viel weniger Haare. Und sie waren grau. Die kahle Stelle am Hinterkopf wirkte wie eine Mönchstonsur.
„Willste ‘nen Kaffee?”, fragte er.
„Ja”, sagte ich. „Immer noch der Magenunfreundliche aus Nicaragua?”
„Ist für die Solidarität.”
„Schon klar.”
„Sind gute Projekte.”
„Hoffe ich.”
„Ey, echt!”
„Echt.”
Der Sowjet-Stern und das Anarcho-Zeichen waren von dem Kneipier in all den Jahren immer wieder sorgfältig nachgemalt worden. Die einzigen Stellen an dieser Fassade, die einen gepflegten Eindruck machten.
Für mich waren der Sowjet-Stern und das Anarcho-Zeichen eigentlich Gegensätze. Aber den Kneipier schien das nicht weiter zu jucken. Das war eben Hausbesetzer-Nostalgie. Inzwischen hatte der Typ wahrscheinlich seit Jahrzehnten einen ganz spießigen Mietvertrag.
Man schrieb 2018, aber ein Besuch hier war immer wie eine Reise mit der Zeitmaschine in die 80er, die Zeit des Kalten Krieges, der Mauer und die Zeit von Präsident Reagan, der von Gorbatschow forderte, die Mauer niederzureißen.
Ich traf mich in diesem Lokal normalerweise mit einem Informanten. Mein Kollege Kommissar Rudi Meier war auch dabei.
Diesmal trafen wir uns genauer gesagt eigentlich nicht in dem Lokal, sondern davor, denn der autonom-alternative Kneipier hatte ein paar Stühle auf den Bürgersteig gestellt. Eine Genehmigung hatte er dazu mit Sicherheit nicht. Aber ein bisschen Revoluzzertum musste ja sein.
Wir saßen mit dem Informanten zusammen und der sagte mir: „Ich wills heute kurz machen, Harry.”
„Wieso nicht?”
„Jemand mag dich nicht.”
„Das wäre nicht das erste Mal.”
„Tu nicht so, als würdest du nicht wissen, was ich meine, Harry. Jemand sehr Mächtiges mag dich nicht und nach allem, was ich gehört habe, hat er auch Grund dazu, dich zu hassen.”
„Es wird viel geredet.”
„Er will dich umlegen, Kriminalhauptkommissar Harry Kubinke. Du sollst ausradiert werden. Es ist eine Frage der Ehre. Die Sache mit seiner Schwester lässt ihm keine andere Wahl.”
Kopfgeld auf mich, Harry Kubinke. Das war im Prinzip nichts Neues.
„Sag mal, wieso beschäftigen wir dich eigentlich als Informanten, wenn du uns nur Dinge erzählst, die wir sowieso schon wissen?”, fragte ich.
Wie ich schon erwähnte, ich hatte schon die ganze Zeit über ein mulmiges Gefühl gehabt. Man entwickelt im Laufe der Zeit in diesem Job einen sechsten Sinn für sowas.
Und ich war nun wirklich lange genug dabei, um diesen besonderen Sinn für die Gefahr entwickelt zu haben. Ein Sinn, der einem mitunter das Leben retten konnte.
Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung, warum ich gerade in diesem Augenblick auf auf das dritte Obergeschoss im Haus schräg gegenüber blickte. Tatsache ist, dass es geschah. Ich sah einen Mann ein Gewehr in meine Richtung halten. Ein Scharfschützengewehr.
Ich war im Fadenkreuz.
Der Informant hatte ganz Recht.
Der Typ, den ich geärgert hatte, würde die Sache mit seiner Schwester nicht auf sich beruhen lassen.
Er sagte einfach einem seiner Leute bescheid und schickte einen Typ, wie den dort oben im dritten Obergeschoss, um mich zu erledigen.
„Runter, Rudi!”, rief ich.
Ich warf mich zu Boden und riss den Informanten mit mir.
Der Schuss ging dicht an mir vorbei und blieb in der Wand stecken.
Genau im roten Sowjet-Stern.
Ich rappelte mich auf, rettete mich ein geparktes Fahrzeug. Inzwischen hatte ich meine Dienstpistole in der Faust. Aber ernsthaft daran denken, sie zu benutzen, konnte ich in dieser Situation natürlich nicht; die Gefahr, Unbeteiligte zu treffen, war viel zu groß.
Ein paar weitere Schüsse ließen die Scheiben des Fahrzeugs zersplittern, hinter dem ich mich verschanzt hatte.
Spätestens jetzt war klar, dass ich gemeint war.
Rudi hatte unterdessen den Informanten gesichert und war mit ihm in das Lokal geflohen.
Die ersten Passanten bemerkten jetzt, was geschehen war und gerieten in Unruhe.
Panik war jetzt nur eine Frage der Zeit.
Ich sah, dass die Gestalt, die auf mich geschossen hatte, jetzt nicht mehr am Fenster zu sehen war.
Also tauchte ich aus meiner Deckung hervor. Ich lief über die Straße. Ein Lieferwagen musste bremsen. Dann erreichte ich das Gebäude, aus dem geschossen worden war.
Einen kurzen Moment hielt ich inne.
Dann nahm ich einen schmalen Durchgang, der zu einem Hinterhof führte.
Manchmal muss man sich einfach in sein Gegenüber hineinversetzen.
Ich hätte jedenfalls anstelle des Killers versucht, hinten aus dem Haus zu kommen - und nicht vorne.
Und genau da fand ich ihn dann auch.
Er hatte das Gewehr, mit dem er auf mich geschossen hatte, noch in der Hand und rannte auf einen Wagen zu.
„Stehen bleiben, Kriminalpolizei!”, rief ich und hob die Waffe.
Er drehte sich um und feuerte sofort.
Ich schoss ebenfalls.
Seine Kugel pfiff dicht an meinem Kopf vorbei.
Mein Schuss traf besser. Getroffen wankte er zurück. Er ließ mir keine andere Wahl, als nochmal zu feuern, denn der Kerl legte erneut auf mich an.
Wie ein gefällter Baum fiel der Killer zu Boden.
Ich senkte die Waffe.
Dass der Kerl tot war, daran konnte kein Zweifel bestehen.
*
Es dauerte nicht lange, bis die Identität des Killers festgestellt worden war. Es handelte sich um einen vorbestraften alten Bekannten. Einen, der bekanntermaßen für Farid Abu-Jamal arbeitete, den Anführer des Abu-Jamal-Clans aus dem Wedding.
Und Farid Abu-Jamal war der Mann, mit dem ich mich angelegt hatte. Oder besser gesagt: Der sich mit mir angelegt hatte.
Es ging um seine Schwester.
Und so, wie die Sachlage sich nunmal darstellte, konnte ich nicht damit rechnen, aus dieser fiesen Nummer so schnell herauszukommen.
*
Vielleicht sollte ich jetzt mal erzählen, wie der ganze Ärger anfing. Das war zwei Wochen vor diesem Schusswechsel, der mich um ein Haar das Leben gekostet hätte und am Ende mit dem Tod des Killers endete.
Ich war zusammen mit Rudi auf einer Polizeidienstelle, irgendwo im Wedding. Wir mussten mit einem Kollegen sprechen, um bestimmte Sachverhalte zu ermitteln. Worum es da gig, tut hier nichts zur Sache.
Jedenfalls ging es auf diesem Polizeirevier ziemlich hoch her.
Das ist manchmal so. Randalierende Betrunkene oder Drogensüchtige - das kann schonmal eine explosive Mischung ergeben. Festgenommene, die logischerweise nicht damit einverstanden sind, das sie festgenommen wurden und so weiter.
In diesem Fall war es eine junge Frau, die randalierte.
Sie schrie, schlug um sich und hatte eine Spritze in der Hand. Die Augen waren auf unnatürliche Weise geweitet. Sie stand ganz sicher unter dem Einfluss irgendwelcher Drogen. Mochte der Teufel wissen, was sie geschluckt hatte. Es machte sie jedenfalls zu einer unberechenbaren Furie. „Ey, isch mach euch AIDS!”, schrie sie. „Ich stech euch und mach euch alle AIDS! Ihr verdammten Wichser und Nazis!”
Sie machte ausholene Handbewegungungen und ließ die Nadel durch die Luft schnellen wie einen Dolch.
Dann stürmte sie auf einen Kollegen zu, der wie gelähmt am Schreibtisch saß.
Ein Schrei kam aus ihrer Kehle.
Die Nadel war in ihrer Faust.
Ich schnellte vor und versetzte der Irren einen kräftigen Tritt zwischen die Beine, um sie zu stoppen.
Ich gebe zu, der Tritt war sehr kräftig. Ich habe schließlich mal Fußball gespielt, auch wenn ich es nie nicht gerade zu Real Madrid geschafft habe.
Aber mit dem, was dann geschah, hatte wirklich niemand rechnen können. Und ich werde es auch ganz bestimmt nie vergessen.
Die Frau explodierte nämlich.
Und zwar im wortwörtlichen Sinn.
Es gab einen dumpfen Knall und und im nächsten Moment gab es in dem ganzen Großraumbüro der Dienststelle wirklich niemanden mehr, dessen Kleidung nicht blutbesudelt gewesen wäre.
*
Am übernächsten Tag, als ich Kriminaldirektor Hoch gegenübersaß, hatte ich den Schock noch nicht wirklich überwunden.
„Was hätte ich tun sollen?”, fragte ich. „Zulassen, dass diese Frau mit ihrer Spritze auf den Kollegen einsticht?”
„Natürlich nicht, Harry”, sagte Kriminaldirektor Hoch. „Sie haben völlig richtig gehandelt. Und trotzdem...”
„Trotzdem was?”
„Trotzdem haben wir jetzt ein Problem.”
„Sie meinen: Ich habe jetzt ein Problem.”
„Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen, Harry.”
„Umreißen Sie mir mal das Problem.”
„Zunächst einmal darf ich mich wiederholen: Man kann Ihnen keinen Vorwurf machen. Sie haben völlig richtig gehandelt. Ich hätte an Ihrer Stelle hoffentlich dasselbe getan.”
„Das klingt, als käme das dicke Ende noch!”
„Es gibt einen entscheidenden Umstand, den Sie nicht wissen konnten.”
„Und der wäre?”
„Ich habe den gerichtsmedizinischen Bericht und diverse Zeugenaussagen von dem betreffenden Revier. Und ein ballistisches Gutachten. Die Frau hatte in ihrer Vagina eine Pistole.”
„Die sollte da nicht sein.”
„Nein, sollte sie nicht.”
„Und wie kam die Waffe dort hin?”
„Die spannendere Frage ist: Wieso war sie immer noch dort? Die Frau ist offenbar sehr schlampig durchsucht worden. Jedenfalls nicht so, wie das den Regeln entspricht.”
„Sieht so aus.”
„Als Sie zugetreten haben, ist die Waffe losgegangen. Den Rest brauche Ihnen ja nicht zu schildern.”
„Von dem, was Sie den Rest nennen habe ich wahrscheinlich noch Albträume, wenn ich schon pensioniert bin”, meinte ich.
„Sie können von Glück sagen, dass der Schuss nicht noch jemanden verletzt hat”, sagte Kriminaldirektor Hoch. „Dem Bericht der KTU nach ist er in die Decke gegangen.”
„Tja...”
„Ihr Problem ist jetzt ein anderes, Harry.”
„Wer war denn die Frau?”
„Genau damit hängt es zusammen. Die Frau war Yasemin Abu-Jamal. Die kleine Schwester von Farid Abu-Jamal...”
„...dem Clan-Chef aus dem Wedding!”
„Genau.”
„Der muss jetzt seine Ehre wiederherstellen. Und das kann er nur, indem er mich tötet.”
„Ja, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.”
„So?”
„Es ist noch schlimmer, Harry.”
„Was kann man Schlimmeres tun, als die Lieblingsschwester des Abu-Jamal-Chefs explodieren zu lassen? Ich nehme an, alle Argumente, die in Richtung Notwehr oder Nothilfe gehen, zählen da nicht viel.”
„Wie ich schon sagte: Es ist noch schlimmer, Harry. Sie haben nämlich durch Ihren beherzten Tritt Farid Abu-Jamal ein Riesenproblem abgenommen.”
Ich runzelte die Stirn.
„Wie denn das?”
„Er braucht jetzt nur Sie zu töten, Harry - und nicht mehr seine Schwester, was ihn in Gegnerschaft zu seinem Geschäftspartner Victor Brilanow von der Russen-Mafia brächte, von dem er eigentlich lieber gerne Drogen aus Usbekistan beziehen würde...”
„Das verstehe ich jetzt nicht”, gestand ich.”
Kriminaldirektor Hoch lächelte nachsichtig. „Yasemin war keineswegs Farids Lieblingsschwester, sondern eher das Gegenteil. Sie war das schwarze Schaf der Familie.”
„Ich nehme an, sie wollte sich nicht bevormunden lassen.”
„Mit Drogen handeln ist in der Familie in Ordnung, Drogen nehmen nicht. Und davon abgesehen hat sie ihrem Bruder das Schlimmste angetan, was man man ihm nur antun konnte.”
„Ist sie mit einem Deutschen durchgebrannt?”
„Schlimmer.”
„Ist auf den Strich gegangen?”
„Schlimmer.”
„Ich glaube nicht, dass es was mit Religion zu tun hatte.”
„Hatte es auch nicht. Sie ist auf den Strich gegangen, aber nicht für irgendwen, sondern in einem Bordell, dass unter der Kontrolle von Victor Brilanow steht. Und der hat das natürlich überall verbreitet. Das war die maximale Demütigung. Farid hätte seine Schwester und am besten auch Victor Brilanow töten müssen, damit man ihn überhaupt noch Ernst nimmt. Aber das konnte er nicht, weil er von dessen Stoff aus Usbekistan abhängig ist.”
„Sowas nennt man eine Zwickmühle.”
„Das ist noch nicht alles! Farid konnte bis jetzt auch nicht seine Schwester umbringen, was seine Pflicht gewesen wäre! Denn dann hätte er Victor Brilanow herausgefordert und der wäre wiederum gezwungen gewesen, etwas gegen Farid zu unternehmen!”
„Schließlich kann der nicht einfach ein Mädchen aus seinem Bordell umbringen lassen!”
„Genau! Aber jetzt haben Sie ihm seinen Job abgenommen und er kann mit Victor Brilanow Frieden halten. Außerdem wird er sich darauf konzentrieren, Sie zu töten, Harry. Und dabei wird sein ganzer Clan hinter ihm stehen.”
Ich atmete tief durch.
„Wirklich schöne Aussichten”, sagte ich.
Zwei Wochen geschah nichts.
Ich dachte schon, die Sache würde sich vielleicht doch von allein regeln.
Tat sie aber nicht.
Ich hatte es geahnt.
Zwei Wochen geschah nichts, dann geschah das Attentat vor dem Anarcho-Lokal in Kreuzberg.
Der Killer war tot.
Aber der war ohnehin nur ein Werkzeug gewesen.
Ein Werkzeug für Farid Abu-Jamal.
*
Ein paar Tage später informierte mich mein Chef darüber, dass der ballistische Bericht zu der Waffe vorlag, mit der auf mich vor dem Anarcho-Lokal geschossen worden war.
„Das ist ein Scharfschützengewehr, wie es normalerweise nur von SEK-Kommandos oder bei der Bundeswehr benutzt wird”, sagte Kriminaldirektor Hoch. „Eine sehr gute Waffe. Heißt nach ihrem Konstrukteur: Weitz.”
„Nie gehört.”
„Ist sehr selten. Und die Waffe, die wir sichergestellt haben, ist so gut wie neu gewesen. Die wurde vorher wahrscheinlich noch nie benutzt.”
Ich zuckte mit den Schultern.
„Der Killer ist tot”, gab ich zu bedenken.
„Und Tote können nicht mehr aussagen.”
„So ist es. Und einen Hinweis darauf, wen Farid Abu-Jamal als nächstes anheuert, können wir uns durch dieses Gewehr auch nicht erhoffen.”
Hoch sah mich an. „Ich frage mich nur, wer zurzeit so etwas hier in Berlin verkauft...”
„Nun...”
„Es gibt da ein paar Gerüchte, Harry.”
„Dann vermute ich mal, dass wir sehr bald wieder auf eine solche Waffe stoßen werden.”
„Ja, das ist zu befürchten”, war auch Kriminaldirektor Hoch überzeugt. „Ach übrigens, wenn Sie angesichts der jüngsten Ereignisse etwas Urlaub machen wollen...”
„Nein”, sagte ich.
„Wirklich nicht?”
„Wirklich nicht.”
Mein Chef hob die Augenbrauen.
Seine Hände steckten in den tiefen Taschen seiner Flanellhose.
Die Hemdsärmel waren aufgekrempelt.
„Ich habe es Ihnen angeboten”, sagte er dann.
„Schon klar.”
„Und ich habe Sie auch auf die Möglichkeit hingewiesen, psychologische Betreuung zu bekommen.”
„Ich bin schon eine Weile im Dienst und weiß, wie die Dinge laufen”, sagte ich.
Kriminaldirektor Hoch nickte. „Gut, ich wollte nur sichergehen.
„Was passiert jetzt mit Farid Abu-Jamal?”
„Nichts. Wir können ihm nichts nachweisen.”
Ich atmete tief durch. „Hatte ich mir fast gedacht. Das heißt dann wohl, ich muss auf mich selbst aufpassen.”
Ich hatte für mich entschieden, einfach das zu tun, was ich am besten konnte. Meinen Job. Am besten, man ließ sich nicht beirren oder einschüchtern. Wenn man das nämlich erstmal zulässt, dann kann man alles vergessen.
Hört sich alles allerdings leichter an, als es in Wahrheit ist.
Tage vergingen.
Sammelten sich zu Wochen.
Aber mir war klar, dass es nicht vorbei war.
Ganz bestimmt nicht.
*
Der Mann mit dem dunklen Haarkranz und der Narbe am Kinn hatte ein verkniffenes Gesicht. Entschlossenheit blitzte in seinen Augen. Er sah durch das Zielfernrohr des Spezialgewehrs. Im Fadenkreuz sah er das Gesicht der Bundeskanzlerin. Der Schütze hielt die Waffe so, dass das Fadenkreuz genau über der Stirn war. Gut so, dachte er. Da gehört es hin, dieses Kreuz.
Er drückte ab.
Die Kugel traf genau zwischen die Augen. Der Kopf zerplatzte. Blutrot troff es herab.
Zufrieden senkte der Schütze die Waffe und juckte sich dann auf eine recht auffällige Weise an der Narbe an seinem Kinn.
„Sie hat es nicht anders verdient“, murmelte er.
*
„Ein guter Schuss“, sagte der andere Mann – hochgewachsen, dunkelhaarig und gut trainiert. Unter dem linken Auge war ein dunkler Punkt, den man auf den ersten Blick für ein Muttermal halten konnte. Wenn man genauer hinsah, erkannte man, dass es eine Tätowierung war. Eine Träne.
Der Kahlköpfige grinste. „Gute Waffe“, meinte er. „Und darauf kommt es, sage ich Ihnen. Auf die Waffe. Und es gibt keine zweite wie diese hier. Das können Sie mir glauben.“
„Wenn Sie das sagen, Herr Weitz.“
Der Kahlköpfige grinste breit. „Ich habe sie konstruiert. Ich kenne jede Schraube an dem Ding und ich sage Ihnen, es ist nie wieder eine Handfeuerwaffe mit einer vergleichbaren Zuverlässigkeit hergestellt worden.“ Er hob die Augenbrauen. „Sie können damit jemandem auf anderthalb Kilometer das Auge ausschießen, wenn Ihre Hand ruhig genug ist.“
„So anspruchsvoll bin ich gar nicht.“
„Das sollten Sie aber sein, Herr. Wer weiß, gegen wen man sich noch alles verteidigen muss! Die Regierung ist wie eine Krake. Eines Tages kriegt die jeden. Sie werden es auch noch sehen. Und am Ende sind Sie auf sich allein gestellt, wenn diese Arschlöcher Sie mit allen Tricks fertig zu machen versuchen.“
Zusammen gingen sie die fast fünfhundert Schritte, die zwischen ihrem Standort und dem Ziel lagen.
Sie erreichten einen Baum mit stark überhängenden Ästen.
Ein Seilstück hing von einem dieser Äste herab.
Es baumelte.
Die Melone, die Weitz damit befestigt hatte, war durch den Schuss auseinandergeplatzt. Irgendwo lag ein Computerausdruck, der ein Foto vom Gesicht des Bundespräsidenten zeigte.
„Sie haben einen eigenartigen Humor, Herr Weitz.“
„Wie?”
„Ich meine es ernst!”
„Wieso Humor?“
„Naja, ich meine, dass Sie die Melonen, auf die Sie schießen, mit Fotos bekannter Leute bekleben.”
„Ja, und?”
„Mit Politikern und so – Sie wissen schon, was ich meine. Tut mir leid, das finde ich schräg.“
„Ich finde es schräg, wie diese Bande von Parasiten unser Land ausbeutet und sich von all denen einlullen lässt, die das Recht auf Waffenbesitz zurückzudrängen versuchen! Aber ich sage immer, wenn ich meine Waffe nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen darf, wie in Berlin, dann ist das der erste Schritt in die Diktatur.“
Weitz bückte sich, hob den Fetzen auf, der von dem Foto der Kanzlerin übrig geblieben war. Sein Gesicht bekam für einen kurzen Moment einen zufriedenen Ausdruck, als er sah, dass der Schuss mit dem Spezialgewehr genau zwischen die Augen gegangen war.
So, wie es sein sollte, ging es Weitz durch den Kopf.
„Ich nehme die Waffe“, sagte der andere Mann. „Haben Sie auch Munition dafür?“
„Ja, habe ich. Die Waffe ist übrigens so konstruiert, dass Sie auch problemlos Standardmunition verwenden können. Und so, wie es aussieht, werden Sie das auch bald müssen, denn ich kann Ihnen bei den Spezialprojektilen nicht garantieren, dass Sie die noch lange nachbestellen können. Mein Vorrat geht nämlich zur Neige – und ein paar bewahre ich für meine eigenen Zwecke auf. Ich will schließlich vorbereitet sein, wenn es soweit ist und alles zusammenbricht.“
Der Mann mit der Träne unter dem Auge runzelte die Stirn. „Die kleinen Modifikationen, die wir besprochen haben – bis wann können Sie die durchführen?“
„Ist alles in ein paar Tagen fertig.“
„Dann komme ich am Dienstag zu Ihnen raus.“
„Nein, nicht Dienstag. Dienstag bin ich in Berlin. Kommen Sie Sonntag Abend oder erst Donnerstag. Und bringen Sie den Betrag in bar mit. Ich misstraue der Regierung und dem Bankensystem. Die überwachen doch, wo jeder Cent bleibt und am Ende drehen sie einem einen juristischen Strick daraus, wenn sie es brauchen und einen aus dem Weg räumen wollen. Da kann ich Ihnen Stories erzählen... Da fallen Sie vom Glauben ab, sag ich Ihnen.“
*
Ich traf mich mich mit einem Informanten aus dem Wedding. Aber diesmal nicht auf der Straße.
Wir gingen in einen Schwulen-Club.
Eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dort nicht jemanden anzutreffen, der dem Abu-Jamal-Clan angehörte.
Selbst wenn diese Typen mir auf Schritt und tritt gefolgt wären - dorthin wäre mir keiner von ihnen gefolgt. Schon, damit sie dort nicht gesehen wurden und jemand das weiter erzählte.
„Du kannst Farid eine Botschaft ausrichten?”, fragte ich.
„Wie stellst du dir das vor?”, fragte der Informant.
„Ja, was ist? Kannst du oder kannst du nicht? Sonst hast du doch immer so groß herumgetönt, dass du das könntest. Und jetzt, wo ich diesen Kanal mal brauche ist bei dir Sendepause?”
„Das habe ich nicht gesagt.”
„Also, was ist nun?”
„Okay, was soll das für eine Botschaft an Farid sein?”
„Sag ihm, dass ich die Sache gerne aus der Welt schaffen würde. Wir können uns treffen. Nur er und ich.”
„Keine Mikros und so?”
„Nein.”
„Keine Kameras und ein SEK-Kommando im Hintergrund?”
„Nur er und ich”, wiederholte ich. „Ich sage ihm Ort und Zeit.”
„Hm...”
„Wenn er will. Und wenn er den Mut dazu hab.”
„Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert.”
„Ich auch nicht.”
Der Informant lachte. „Das stimmt natürlich...”
„Ich höre von dir, okay?”
„Du hörst von mir.”
*
„Keine Ahnung, ob das wirklich eine gute Idee war”, meinte mein Kollege Rudi Meier, als wir später in unserem Dienstwagen saßen.
„Das weiß ich auch nicht. Aber irgendetwas muss ich tun.”
„Kann ich nachvollziehen.”
„Mal sehen, was aus der Sache wird.”
Erstmal schien es so, als würde nichts daraus.
Ich hörte jedenfalls in der Sache nichts mehr.
Naja, ich hatte eigentlich auch nicht wirklich viel erwartet.
Erstmal...
*
Es war ein Dienstag.
Ein Dienstag, der schon schlecht begann, denn als ich meinen Kollegen Rudi Meier morgens an der bekannten Ecke abholte, um mit ihm zum Präsidium zu fahren, fuhr uns der unvorsichtige Fahrer eines alten Ford hinten drauf. Der Schaden an meinem Dienstporsche hielt sich zum Glück in Grenzen. Etwas eingedrücktes Blech, das war alles. Es hätte schlimmer kommen können.
Da der Unfall erst abgewickelt werden musste und wir anschließend in der Fahrbereitschaft sicherstellen mussten, dass die Reparatur durchgeführt wurde, erreichten wir das Büro unseres Chefs mit leichter Verspätung.
Kriminaldirektor Jonathan D. Hoch stand am Fenster und hatte dabei die Hände in den tiefen Taschen einer Flanellhose vergraben. Die Hemdsärmel waren hochgekrempelt, die Krawatte gelockert.
„Ich weiß, dass wir etwas spät dran sind“, begann ich.
Aber Kriminaldirektor Hoch ging darauf gar nicht weiter ein. „Es hat eine Leiche im Park gegeben“, eröffnete er. „Maik Ozanali, 52 Jahre alt, Anwalt. Ozanali hat bis vor kurzem bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet und war dort Spezialist für Fälle, die mit Geldwäsche und organisiertem Verbrechen zu tun hatten. Es wäre also nicht unwahrscheinlich, wenn es da einen Zusammenhang gibt.“ Kriminaldirektor Hoch sah auf die Uhr an seinem Handgelenk. „Der Anruf von der Kollegen kam vor zehn Minuten. Die Untersuchung am Tatort dürfte gerade angelaufen sein.“
„Dann werden wir uns am besten sofort auf den Weg machen“, sagte ich.
„Lassen Sie keine Zweifel daran, dass wir vom BKA die Ermittlungen übernehmen, Harry“, ermahnte mich Kriminaldirektor Hoch. „Die Informationen sind zwar noch recht spärlich, aber eigentlich besteht für mich kein Zweifel, dass die Sache in unseren Zuständigkeitsbereich fällt.“
„In Ordnung.“
Es klopfte. Mandy, die Sekretärin unseres Chefs brachte ein Tablett mit dampfenden Kaffeebechern herein.
„Sie gehen schon wieder?“, fragte sie, als Rudi und ich uns in Richtung Tür bewegten.
Kriminaldirektor Hoch deutete auf die drei dampfenden Becher, die Mandy inzwischen auf den Tisch des Besprechungszimmers gestellt hatte. „Harry und Rudi haben dafür leider keine Zeit mehr, aber lassen Sie sie ruhig hier. Ich trinke alle drei.“
„Wie Sie meinen, Herr Hoch“, sagte Mandy.
*
Da der Dienstporsche repariert werden musste, nahmen Rudi und ich uns ein Fahrzeug aus den Beständen unserer Fahrbereitschaft. Es handelte sich um einen unauffälligen Ford.
Leider verfügte der nicht über einen Bordrechner mit TFT-Bildschirm, wie er in den Dienstporsche eingebaut war.
„Der Name Ozanali kommt mir bekannt vor“, sagte Rudi und ging dabei mit seinem Smartphone ins Netz, um zumindest die wichtigsten, öffentlich zugänglichen Informationen suchen zu können.
„Hat sich selbstständig gemacht, als der neue Oberstaatsanwalt ihm erklärt hat, dass seine Karriere nicht weiter nach oben gehen wird.“
„Woher weißt du das denn, Harry?“
„Habe ich von Manuel Schneyder gehört. Und der hat es von Ozanali selbst.“
Manuel Schneyder war einer unserer Verhörspezialisten im Innendienst. Und die hatten naturgemäß viel mit Anwälten und Staatsanwälten zu tun, denn bei einer großen Zahl von Vernehmungen bestand entweder eine oder beide Seiten auf eine Anwesenheit. Und natürlich fiel da auch schon einmal das eine oder andere private Wort.
„Ein Anwalt, der die Seiten wechselt“, meinte Rudi. „Erst jagt er Geldwäscher und zuletzt verteidigte er wahrscheinlich genau solche Typen, die er zuvor gejagt hat. Muss auch eigenartig sein.“
„Anwalt und Staatsanwalt dienen beide dem Recht“, sagte ich.
„Kann ja sein. Muss aber trotzdem eigenartig sein, plötzlich auf der anderen Seite zu stehen. Wäre interessant zu erfahren, wieso er sich mit seinem beiden Vorgesetzten überworfen hat.“
„Jedenfalls finanziell gesehen dürfte der Ausstieg kein Nachteil für Ozanali gewesen sein“, vermutete ich. „Ich nehme an, dass er mit seinem Spezialwissen bei allen Gangstern Berlins, die ein paar schmutzige Koffer mit Euros weiß zu waschen hatten und dabei erwischt wurden, gerne und zu lukrativen Honoraren engagiert wurde.“
„Willst du ihm daraus einen Vorwurf machen?“, fragte Rudi. „Das war nunmal sein Spezialgebiet! Als Anwalt konnte er ja wohl schlecht als Verteidiger von Verkehrssündern anfangen!“
Wir erreichten schließlich den Tatort. An diesem Dienstag war es zwar kalt, aber es schien die Sonne. Wir stellten den Ford aus unserer Fahrbereitschaft auf einem der Parkplätze ab und wir stiegen aus.
Einige Einsatzfahrzeuge der Schutzpolizei waren hier ebenfalls bereits zu finden. Ein Kollege notierte die Nummernschilder der anderen parkenden Fahrzeuge. Eine vorsorgliche Maßnahme. Jeder, der hier seinen Wagen abgestellt hatte, war möglicherweise auch ein wichtiger Zeuge.
Wir zeigten unsere Dienstausweise.
Der Polizeimeister sah auf.
„Icke bin beeindruckt”, sagte er ironisch.
„Na dann”, sagte ich.
„Kommissar Schaluppke erwartet Sie schon“, erklärte er.
„Christian Schaluppke?“, fragte ich. Ich kannte Schaluppke nämlich von einem gemeinsamen Sicherheitstraining im Umgang mit Handfeuerwaffen, zu dem nach und nach sämtliche Polizeieinheiten Berlins geschickt worden waren, nachdem ein psychisch kranker Mehrfachmörder auf dem Weg zum Gericht trotz Handschellen und Fußfesseln einem Kollegen die Waffe abgenommen und damit ein Blutbad angerichtet hatte. Christian und ich hatten uns gut verstanden. Ich hatte nichts dagegen, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Der Kollege beschrieb uns knapp den Weg zum Tatort, und wir machten uns auf den Weg. Aber die Beschreibung des Kollegen hätten wir streng genommen gar nicht gebraucht.
Auch auf den Rasenflächen des angrenzenden Parks standen mehrere Einsatzfahrzeuge – sowohl von der Schutzpolizei, als auch vom Rettungsdienst sowie von der Abteilung Kriminaltechnische Untersuchung, dem zentralen Erkennungsdienst, der von allen Berliner Polizeieinheiten genutzt wird.
Der Bereich um den Tatort war mit Flatterband abgegrenzt. Schaulustige standen außerhalb davon und sahen zu, wie ein halbes Dutzend Kollegen und Kolleginnen die Grasfläche nach irgend etwas absuchten.
Der Tote war bereits in einen Zinksarg gelegt worden.
Ich bemerkte Dr. Bernd Heinz, einen Gerichtsmediziner der Abteilung Kriminaltechnische Untersuchung. Er winkte uns kurz zu. Jetzt bemerkte uns auch Kollege Schaluppke, der uns bis dahin den Rücken zugewandt hatte.
Wir stiegen über das Flatterband und gingen zu ihnen hin. Unsere Ausweise trugen wir gut sichtbar, damit di Kollegen Bescheid wussten, dass wir dazugehörten.
„Hallo Harry! Hallo Rudi!“, begrüßte uns Dr. Heinz. „Ich habe das Wesentliche gerade schon mit Kollege Schaluppke besprochen. Aber für euch auch nochmal das Wesentliche: Letale Schussverletzung. Die Kugel drang fast genau dort, wo sich die Nasenwurzel befindet, in den Schädel ein. Kaliber kann ich euch erst sagen, wenn ich mit der Obduktion fertig bin.“
„Die Kugel ist nicht ausgetreten?“, fragte ich.
„Nein, sie ist noch im Schädel.“
„Spezialmunition“, meldete sich Christian Schaluppke zu Wort. „Muss sowas Ähnliches sein, was wir auch benutzen.“
Ich wusste natürlich, was Christian meinte. Moderne Waffen haben oft eine enorme Durchschlagskraft. Ein einziger Schuss kann unter Umständen nacheinander mehrere Körper durchschlagen. Gerade bei Polizeieinsätzen zur Geiselbefreiung und ähnlichem würde ein Schusswaffeneinsatz zwangsläufig Unbeteiligte in Mitleidenschaft ziehen, wenn man nicht die richtige Munition benutzt.
„Unser Täter scheint ja richtig rücksichtsvoll zu sein“, sagte Rudi stirnrunzelnd.
Christian deutete in Richtung einer Baumgruppe, die sich ungefähr zweihundert Meter entfernt befand. Links davon waren die Piers und die Anlegestellen der Fähren zur Statue of Liberty zu sehen.
„Aus Turguts Richtung wurde geschossen“, erklärte Christian Schaluppke.
„Turgut?“, echote ich.
Tatsächlich entdeckte ich unseren Chefballistiker Turgut Özdiler. Er kauerte in einiger Entfernung am Boden und führte gerade eine Laserpeilung durch, um den Einschusswinkel näher zu bestimmen und hatte uns noch nicht bemerkt. Er stand anschließend auf und ging auf die Baumgruppe zu.
„Ihr Kollege meint, dass der Schuss ungefähr von der Baumgruppe aus abgegeben worden sein muss“, berichtete Christian.
„Auf zweihundert Meter?“, staunte ich.
„Ein guter Schütze“, kommentierte Rudi.
„Einem Scharfschützen mit einem sehr guten Gewehr und einer hervorragenden Zieloptik“, stellte Kommissar Schaluppke klar. „Die Bäume dort sind im übrigen auch die einzige Möglichkeit für den Täter gewesen, Deckung zu finden. Ihr Kollege meinte allerdings, dass er da noch etwas überprüfen will. Sie fragen ihn am Besten gleich selbst danach.“
Das Gebiet um die Baumgruppe war ebenfalls mit Flatterband abgegrenzt worden. Mehrere Kollegen des Erkennungsdienstes stöberten dort herum, das Gesicht dabei stets aufmerksam auf den Boden gerichtet.
Es war ja schließlich möglich, dass der Täter dort irgend etwas hinterlassen hatte.
„Ihr braucht mich dann ja hier nicht mehr“, meinte Dr. Heinz. Er wandte sich an mich. „Der Tote kommt jetzt zu uns ins Labor. Wenn sich dabei nichts Außergewöhnliches ergibt, dann habt ihr das vorläufige Ergebnis noch heute Mittag. Ich schlage vor, dass das Projektil dann gleich in die KTU-Labors geht, oder besteht ihr darauf, es bei euch zu untersuchen?“
„Nein, nein“, wehrte ich ab. „Wir wollen das Ergebnis so schnell wie möglich.“
„Gut“, nickte Dr. Bernd Heinz. „Wir hören dann voneinander.“
Bevor der Tote fortgebracht wurde, hatte ich noch kurz Gelegenheit, einen Blick auf ihn zu werfen. Sein Blick war starr. Das Einschussloch war ziemlich klein – aber das erstaunt nur diejenigen, die zu viele Action-Filme gesehen haben. Das Einschussloch ist meistens klein, die großen Wunden entstehen bei Austritt des Projektils. Und das war in diesem Fall im Körper geblieben und steckte jetzt vermutlich in der hinteren Schädelwand oder vielleicht auch in den Halswirbeln. Er trug einen grauen Dreiteiler, darüber einen ebenfalls grauen Mantel. Die Schusswunde hatte offenbar nicht stark geblutet. Das weiße Hemd und die sehr gediegen wirkende Krawatte mit dem Anker darauf, hatten kaum Blut abbekommen. Nur ein paar Spritzer, die so klein waren, dass man genau hinsehen musste.
Aber es gab einen roten Fleck in Bauchhöhe, der irgendwie gar nicht dazu passte.
Ich fragte Kollege Schaluppke danach.
„Herr Ozanali aß ein Sandwich, als er erschossen wurde.“
„Verstehe“, murmelte ich.
„Aber ich verstehe nicht, wieso jemand so früh am Morgen sich in den Park begibt und dort ein Sandwich isst!“
„Ditte ist nicht so schwer zu verstehen”, sagte Schaluppke.”
Ich hob die Augenbrauen.
„Ach, nee?”
„Das mit dem Sandwich, meine ich. Oder Stulle, wie das richtig heißt.”
„Aha. Und ich dachte, sowas nennt man Döner.”
„Die gibt es hier in der Nähe“, erklärte Schaluppke. „Was soll es dafür eine Erklärung geben? Ich nehme an, Herr Ozanali hatte einfach Hunger und zu Hause nichts gefrühstückt.“
„Trotzdem eigenartig“, meinte Rudi. „Zur Tatzeit dürften vor allem Jogger hier im Park gewesen sein. Und Leute, die ihre Hunde ausführen.“
„Vergessen Sie die Angler am See nicht“, meinte Schaluppke.
„Meinetwegen. Und Ozanali kommt hier in Schlips und Anzug hin, um ein Sandwich zu essen?“
„Die Kollegen haben einige Zeugenaussagen aufgenommen. Vielleicht ist etwas dabei, was man verwerten kann, Harry.“
„Sag mal – noch was anderes, Christian....“
„Schieß los!“
„Hatte ich das falsch in Erinnerung oder seit wann bist du bei der Mordkommission? Ich dachte, du wärst auf deiner Dienststelle bei der Einheit, die sich mit organisiertem Verbrechen beschäftigt?“
„Bin ich auch immer noch, Harry. Wenn jemand einen Mann mit Ozanalis Vergangenheit erschießt, dann riecht das doch nach organisiertem Verbrechen. Und ich denke, deswegen seid ihr auch hier.“
„Stimmt“, musste ich zugeben, während der Tote weggetragen wurde.
„So wie es aussieht, wir ja nun Ihr Team den Fall an sich ziehen, aber wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir das getan. Und ich gehe jede Wette ein, dass das kein gewöhnlicher Mordfall mit persönlichem Hintergrund ist.“
„Ozanali hat sich hier mit jemandem getroffen“, vermutete Rudi. „Und zwar unter quasi konspirativen Umständen. Dabei bekommt er eine Kugel in den Kopf.“
„Noch ist das eine Vermutung“, gab Schaluppke zu bedenken. „Aber genau so könnte es gewesen sein.“
Etwas später wurden wir zu der Baumgruppe gerufen, von der aus offenbar geschossen worden war.
„Wir haben die exakte Position, von der aus geschossen wurde“, erklärte Turgut Özdiler. „Um eine Patronenhülse zu hinterlassen war der Täter zu clever, aber wir haben einen Fußabdruck, der ihm vielleicht gehört. Größe 42.“ Turgut seufzte. „Ja, ich weiß, das könnte nahezu jeder sein, aber es ist ein Anfang.“ Unser Kollege zeigte uns dann die Stelle, von der seinen Messungen nach geschossen worden war. Der Täter hatte einfach direkt neben einem Baum gestanden. Ein paar Sträucher hatten ihn zusätzlich verborgen. In aller Ruhe hatte er dort offenbar auf sein Opfer gewartet. „Der Killer hat die perfekte Position gewählt“, stellte Turgut klar.
„Sieht alles nach einem Profi aus“, war Rudi überzeugt.
„Womit es wohl immer eindeutiger wird, dass der Fall in unsere Zuständigkeit fällt“, meinte ich und wandte mich an Schaluppke. „Tut mir leid, Christian.“
„Kein Problem. Es ist nicht so, dass wir sonst nichts zu tun hätten und etwas dagegen hätten.“
*
Später suchten wir die Kanzlei auf, die Ozanali nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst bei der Staatsanwaltschaft gegründet hatte. Ozanali & Partner stand an der Tür. Das Wort Partner konnte Einzahl oder Mehrzahl sein. Wer damit gemeint war, sollten wir wenig später erfahren.
Eine Sekretärin brachte uns in das Büro von Linda Kalbitz. Zumindest war das der Name, der an der Tür stand.
„Kommissar Harry Kubinke, BKA“, stellte ich mich vor und hielt ihr meine Dienstmarke entgegen. Ich deutete auf Rudi. „Dies ist mein Kollege Kommissar Meier. Sind Sie Linda Kalbitz, die Partnerin von Herrn Ozanali?“
„Ja, das bin ich“, nickte sie. „Was kann ich für Sie tun?“
Sie war schätzungsweise Anfang dreißig, hatte brünettes, adrett frisiertes Haar und trug ein knapp sitzendes Business-Kostüm. Um Partnerin einer Kanzlei zu sein, war sie entschieden zu jung. Aber offenbar hatte sich für sie bei Ozanali eine einmalige Karrierechance ergeben. Vielleicht war sie auch einfach nur sehr gut in ihrem Job.
„Wir müssen Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen“, eröffnete ich. „Herr Maik Ozanali ist heute Morgen ermordet worden.“
Ihr Gesicht veränderte sich. Sie schien ehrlich betroffen und überrascht zu sein, ehe sie wieder ihren geschäftsmäßigen, freundlichen und angesichts dieser Nachricht sehr gefassten Gesichtsausdruck aufsetzte. „Lassen Sie uns bitte allein“, wandte sie sich an die Sekretärin, der in diesem Moment sämtliche Gesichtszüge entglitten und die fast fluchtartig den Raum verließ.
Manchmal sprechen Gesichter Bände.
Linda Kalbitz bot uns einen Platz an.
Wir setzten uns.
„Was ist genau passiert?“, fragte Linda Kalbitz, nachdem sie sich gefasst hatte.
„Das versuchen wir herauszufinden“, sagte ich.
„Herr Ozanali wurde heute früh in einem Park erschossen“, erläuterte Rudi. „Wir nehmen an, dass der Täter ein professioneller Killer war und es Zusammenhänge zum organisierten Verbrechen gibt und der Mord entweder etwas mit seiner ehemaligen Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft oder mit seinen gegenwärtigen Mandanten zu tun hat. Offenbar hat er sich im Park mit jemandem getroffen, leider wissen wir nicht mit wem.“
„Da werde ich Ihnen leider nicht weiterhelfen können“, sagte Linda Kalbitz. „Erstens werde ich ganz sicher nicht ohne einen richterlichen Beschluss dazu über Mandanten, Termine und Ähnliches aussagen. Sie wissen, dass das Gesetz da auf meiner Seite ist und wenn Sie nicht stichhaltig begründen können, wieso diese Auskünfte für Ihre Ermittlungen unerlässlich sind, dann wird kein Richter in Berlin...“
„Hören Sie, ich wollte eigentlich nicht von Ihnen juristisch bekehrt werden, sondern ich brauche Ihre Hilfe, um einen Mord aufzuklären“, unterbrach ich sie. „Und eigentlich hatte ich gedacht, dass das auch Ihr Interesse ist.“
„Selbstverständlich, Herr Kubinke.“
„Dann schlage ich vor, dass Sie uns einfach alles mitteilen, was irgendwie mit Herrn Ozanalis Tod in Zusammenhang stehen könnte. Es geht uns nicht darum, Sie dazu zu bringen, das Vertrauen Ihrer Mandanten aufs Spiel zu setzen.“
„Es freut mich, dass Sie diesen Punkt immerhin anerkennen, Kommissar Kubinke“, sagte Linda Kalbitz kühl. „Genau darum geht es nämlich.“
„Berührt Sie eigentlich der Tod von Herrn Ozanali?“
Sie hob die Augenbrauen.
Die Art und Weise, mit der sie mich ansah, ließ mich stutzen.
Meine Frage schien sie ziemlich überrascht zu haben. Für einen Moment gab sie die glatte, kontrollierte Fassade mit dem geschäftsmäßigen Lächeln wieder auf.
Sie schluckte. „Hören Sie, diese Nachricht ist für mich ein Schock. Um ganz ehrlich zu sein, mir ist noch nicht einmal klar, wie es ohne Maik hier weitergehen soll. Es kann sein, dass Maiks Tod auch das Ende dieser, wie Sie sehen, ziemlich kleinen Kanzlei bedeutet und ich mir wieder einen Job als angestellte Anwältin suchen muss. Und davon abgesehen, war er ein netter Kerl! Aber...“
Sie sprach nicht weiter. Ihr Blick wirkte in sich gekehrt. Erst jetzt zeigte sich in ihren sonst so kontrollierten Zügen jene Traurigkeit, die man angesichts einer solchen Nachricht eigentlich erwartet. Zumindest dann, wenn der Ermordete einem nicht völlig gleichgültig gewesen ist.
„Sie wollten noch etwas sagen“, hakte ich schließlich nach, als diese Pause des Schweigen sich etwas zu sehr in die Länge zog.
„Wissen Sie, ich weiß nicht so recht, wie ich es ausdrücken soll.“
„Sagen Sie einfach, was Sache ist“, schlug ich vor.
„Ich bin zwar Partnerin in der Kanzlei, aber in manche Dinge hat Maik mich nie einbezogen. Er hatte noch aus seiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft viele Kontakte zu Informanten und reichlich dubiosen Leuten, die ihn mit Informationen versorgten, die er bei der Ausübung seiner Mandate nutzen konnte.“
„Und Sie meinen, mit so jemanden hat er sich heute Morgen getroffen?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Es ist nur eine Vermutung.“
„Haben Sie irgendeine Vermutung, wer es auf Herrn
Ozanali abgesehen haben könnte? Jemand, der ihn vielleicht so hasst, dass er einen Killer auf ihn ansetzt? Schließlich hat sich Herr Ozanali in seiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft ja wohl sicherlich auch Feinde gemacht.“
„Davon können Sie ausgehen“, nickte Linda Kalbitz. „Aber das war alles vor meiner Zeit und ich kann Ihnen wirklich nichts weiter dazu sagen.“
„Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei Ozanali & Partner angefangen haben?“, fragte ich.
Sie sah mich etwas überrascht an. „Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso Sie mich jetzt in den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit stellen“, sagte sie und hob dabei das Kinn.
„Und ich weiß nicht, weshalb es ein Problem sein sollte, diese einfache Frage zu beantworten“, gab ich zurück. „Im Zweifelsfall wird man mir diese Auskünfte auch bei der Anwaltskammer geben können. Sie werden irgendwo studiert haben und Ihre bisherige Tätigkeit als Anwältin wird wohl auch kaum unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben! Es wird ehemalige Mandanten geben, die vielleicht etwas auskunftsfreudiger sind und abgesehen davon...“
„Ich habe nach dem Studium bei verschiedenen Kanzleien in München und Frankfurt gearbeitet, bevor es mich nach Berlin verschlug“, erklärte sie. „Und außerdem bin ich in der glücklichen Lage etwas Geld geerbt zu haben, was sicher ganz hilfreich dabei war, die Chance zu bekommen, Partner eines so renommierten Anwalts wie Herrn Ozanali zu werden. Reicht Ihnen das als vorläufige Auskunft?“
„Als vorläufige Auskunft, ja“, gab ich zurück.
Ich fragte mich unwillkürlich, woher dieser feindselige Tonfall bei ihr kam. Schließlich wollten wir doch nichts anderes, als herauszufinden, wer den Mann getötet hatte, von dem doch angeblich auch ihre eigene berufliche Zukunft ganz maßgeblich abhing.
Aber offenbar schien sie zu glauben, dass wir ihr irgendwie etwas am Zeug flicken wollten. Befürchtete sie, dass wir bei unseren Ermittlungen auf Dinge stießen, die unter der Decke bleiben sollten?
Ich reichte ihr meine Karte.
„Seien Sie so freundlich und stellen Sie uns eine Liste sämtlicher Mandantschaften zusammen, die Ihre Kanzlei seit ihrer Gründung übernommen hat. Und zwar möglichst schnell. Wir können natürlich auch dafür sorgen, dass ein richterlicher Beschluss Sie dazu zwingt. Für uns hätte das den Nachteil, dass es zu einer Verzögerung kommt, die nur dem Täter nützt. Für Sie wiederum bedeutet es, dass Sie den Umfang ihrer Auskünfte nicht mehr selbst bestimmen können.“
„Ich lasse Ihnen die gewünschten Daten zukommen“, versprach Linda Kalbitz.
Ihr Lächeln wirkte so säuerlich, wie es selten bei einer Frau ihres Alters gesehen hatte.
Der PH-Wert musste auf jeden Fall im absolut toxischen Bereich liegen.
„Es wäre nett, wenn Sie dafür sorgen, dass diese Angaben sofort zusammengetragen werden“, sagte Rudi.
Linda Kalbitz rief daraufhin über die Sprechanlage die Sekretärin herein und gab ihr eher widerwillig entsprechende Anweisungen.
„Ich erledige das“, versprach sie. Die Sekretärin sah aus, als hätte sie vor wenigen Minuten noch geweint und nur notdürftig ihr Make-up gerichtet.
„Und ich werde Sie begleiten und kann Ihnen dabei auch noch ein paar Fragen stellen“, kündigte Rudi an. „Wie war nochmal Ihr Name?“
„Sybille Cromers“, gab die Sekretärin bereitwillig Auskunft. Ich schätzte sie auf Mitte zwanzig. Das Haar war blond gelockt. Und der wiederholte Seitenblick zu ihrer Chefin zeigte deutlich, wie wichtig es war, sie allein zu befragen. Allerdings hatte ich meine Zweifel, dass sie dabei auskunftsfreudiger sein würde als ihre Chefin.
Linda Kalbitz schien der Gedanke, dass sich Rudi ohne ihre Anwesenheit mit der Sekretärin unterhalten wollte, nicht zu gefallen. Ihre Mimik war da vollkommen eindeutig.
Allerdings sah sie im Moment wohl auch keine Handhabe, um das irgendwie verhindern zu können.
Ich wartete, bis Sybille Cromers und Rudi den Raum verlassen hatten.
„Kommissar Kubinke, ich habe heute noch ein paar dringende Mandantengespräche vor mir und werde zu einem Termin jetzt schon zu spät kommen. Einen weiteren habe ich bereits absagen müssen. Falls Sie also keine weiteren Fragen haben, möchte ich Sie bitten, mich nicht länger aufzuhalten.“
„Schon erstaunlich, wie sie einfach zur Geschäftsordnung übergehen“, fand ich. „Ich meine, die Kanzlei existiert noch nicht allzu lange, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie doch in dieser Zeit wirklich sehr eng zusammengearbeitet haben. Schließlich sind Sie hier ja nun wirklich keine Großkanzlei, in deren Büro man sich vielleicht gegenseitig tagelang aus dem Weg gehen kann, wenn man an unterschiedlichen Fällen arbeitet.“
„Es wäre überaus liebenswürdig, wenn Sie auf den Punkt kämen, Herr Kubinke“, sagte Linda Kalbitz. Der Klang ihrer Stimme erinnerte an klirrendes Eis. Sie war gereizt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie mir ein paar Dinge über Maik Ozanali hartnäckig verschwieg.
Ich sah sie an und sagte:
„Ich stelle mir vor, jemand hätte meinen Partner, Kommissar Meier, plötzlich über den Haufen geschossen. Da würde ich anders reagieren.”
„Ach, ja?”
„und ich komme ganz ehrlich immer noch nicht darüber hinweg, wie kühl Sie über den Dingen zu stehen scheinen.“
„Emotionen können teuer werden, Herr Kubinke.”
„Wer sagt das?”
„Das ist eine der ersten Lektionen, die ich als Anfängerin in meinem Job lernen musste.“
Ach je! Emotionen können teuer werden - wie das klang! Aber sie war nicht so cool und abgeklärt, wie sie mir glauben machen wollte. Das war alles Fassade. Ich frage mich immer wieder, wieso sich Menschen so viel Mühe damit machen, einem etwas anderes vorzumachen, wo doch die Wahrheit nur allzu offensichtlich ist. Schauspielerei beherrscht nicht jeder. Nicht wirklich gut jedenfalls.
Ich sagte:
„Dann scheinen Sie ja schnell gelernt zu haben!“
Ihr Lächeln war so dünn wie der Automatenkaffee auf mancher Dienstelle.
„Vielleicht ist genau das der Grund, warum ich in relativ jungen Jahren schon Partner einer Kanzlei bin.
„Wenn Sie das sagen...”
„Und so tragisch der Tod meines Partner ist, ich werde alles tun um zu verhindern, dass sich diese Tragödie auch noch auf weitere Personen ausweitet.“
„Anscheinend sind Sie rücksichtsvoll.”
„Ihren Sarkasmus können Sie sich sparen.”
„Wen meinen Sie genau damit?“
„Womit?”
„Andere Personen.”
„Damit meine ich zum Beispiel Sybille, die ihren Job verlieren würde, wenn hier alles den Bach runtergeht. Und Mandanten, für die wir verantwortlich sind...“ Sie schluckte. Erst jetzt schien ihr aufzufallen, dass sie tatsächlich wir gesagt hatte. „Sie merken vielleicht, dass ich noch nicht wirklich umgeswitcht habe, Herr Kubinke.“
„Ja, das habe ich schon mitbekommen.“
„Sie tun alles, um den Täter zu finden, nicht wahr?”
„Natürlich.”
„Wirklich?”
„Das ist mein Job. Warum zweifeln Sie daran?”
Sie schluckte.
*
Wenig später saßen wir wieder in dem Ford aus dem Fahrzeugbestand unserer Fahrbereitschaft. Die Sekretärin hatte Rudi eine Liste der gegenwärtigen Mandaten der Kanzlei erstellt. „Interessante Leute darunter“, fand mein Kollege. „Mir würden allein bei einer oberflächlichen Durchsicht mehrere Namen einfallen, denen ich zutraue, bei Bedarf einen Profi-Killer zu engagieren.“
„Hast du noch irgend etwas aus der Sekretärin herausbekommen können?“
„Leider nicht, Harry. Die war so eingeschüchtert, dass sie nichts weiter rausgebracht hat. Allerdings hat sie der Tod ihres Chefs anscheinend sehr getroffen.“
*
Unsere nächste Adresse war ein exquisites Juwelengeschäft in Berlin Mitte. Klein aber fein, so lautete hier die Devise. Ozanali stand in großen Buchstaben über der Tür. Es gehörte nämlich Maik Ozanalis Ehefrau Joanna. Kollegen hatten sie bereits über den Tod ihres Mannes informiert. Zumindest diese unangenehme Pflicht blieb uns also erspart.
In der Gegend zu parken ist eine Wissenschaft für sich. Einen Stellplatz zu bekommen ist schiere Glücksache und die Plätze in den Tiefgaragen der Kaufhäuser sind meistens zu knapp bemessen. Wir waren deswegen gezwungen, den Ford in einiger Entfernung abzustellen und die letzten zehn Minuten zu unserer Zieladresse zu Fuß zu laufen.
Aber so ein kleiner Marsch kann ganz erfrischend ein.
Zumindest blieb uns auf diese Weise Zeit, sich zu überlegen, wie man einer Frau einfühlsam begegnen konnte, die soeben durch die Kugel eines skrupellosen Killers zur Witwe geworden war.
Eine Angestellte des Juweliergeschäfts geleitete uns in einen der hinteren Räume, wo sich unter anderem ein Büro befand. Dort fanden wir Joanna Ozanali. Sie saß in sich zusammengesunken in dem schweren Ledersessel hinter ihrem Schreibtisch. Auf diesem lagen ein paar Schmuckstücke und eine Lupe. Offenbar war sie gerade damit beschäftigt gewesen, diese Stücke zu begutachten und hatte dann irgendwann damit aufgehört.
Ihr Blick war ins Nichts gerichtet. Sie schien uns zunächst gar nicht zu bemerken. Die Angestellte sprach sie zweimal an, ehe sie schließlich aus ihrem Tranceartigen Zustand erwachte.
„Frau Ozanali?“, fragte ich dann. „Ich bin Kommissar Harry Kubinke vom BKA und dies ist mein Kollege Rudi Meier. Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen.“
„Natürlich“, murmelte sie.
„Ich weiß nicht, was die Kollegen Ihnen schon gesagt haben, aber...“
„Ein Scharfschütze hat meinen Mann auf dem Gewissen und ihn aus zweihundert Metern Entfernung erschossen“, fasste sie zusammen, was man ihr gesagt hatte.
Mich wunderte es, dass sie bereits diese Einzelheiten wusste.
Vermutlich hatte sie danach gefragt.
Im Allgemeinen ist es so, dass man mit Angehörigen, die genauen Details und Tatumstände erst nach einer Weile einigermaßen gefasst besprechen kann.
Schlimme Nachrichten brauchen einfach ihre Zeit, bis sie sich durch die Windungen des Gehirns hindurchgearbeitet haben und wirklich ins Bewusstsein gedrungen sind. Bei Frau Ozanali schien das jedoch anders zu sein.
Sie nickte der Angestellten zu und wies sie damit an, den Raum zu verlassen.
Sie zog sich daraufhin mehr oder minder geräuschlos zurück.
Joanna Ozanali deutete auf die edelsteinbesetzten Schmuckstücke auf ihrem Schreibtisch. „Das ist eine Arbeit, die viel Konzentration verlangt. Ich habe versucht mich damit etwas abzulenken, nachdem Ihre Kollegen von der City Police mir die Nachricht von Maiks Tod überbracht haben.“ Sie sah auf. Ihr Blick musterte mich einige Augenblicke auf seltsame Weise. „Es ist mir nicht gelungen“, stellte sie fest und ihre Stimme war so leise, dass ich sie kaum verstehen konnte.
Mir fiel auf, dass sie blonde Locken trug. Die Ähnlichkeit zu Sybille Cromers, der Sekretärin in der Kanzlei Ozanali & Partner war frappierend. Die beiden wirkten wie Schwestern – oder eigentlich schon eher wie Mutter und Tochter.
„Es freut mich, dass das BKA offenbar den Fall übernimmt“, sagte Joanna Ozanali schließlich. „Das bedeutet für mich, dass Sie die Sache die Priorität einräumen, die angemessen ist.“
„Wenn die zuständige Polizeidienststelle den Fall übernehmen würde, dann hieße das nicht, dass man dort diesen Fall für weniger wichtig erachten würde“, stellte ich klar.
„Mag sein, Herr Kubinke. Aber auf Grund der früheren Tätigkeit meines Mannes bei der Staatsanwaltschaft, gibt es da ja dann doch ein paar besondere Umstände, wie Sie zugeben werden.“
„Wir gehen bisher davon aus, dass es sich um einen professionellen Auftragsmord handelt“, sagte Rudi. „Haben Sie eine Ahnung, wer ein Motiv gehabt hätte, Ihrem Mann einen Killer auf den Hals zu hetzen?“
„Fahren Sie zur JVA Moabit. Oder wahlweise zum Knast in Tegel. Da gibt es wahrscheinlich ganze Zellentrakte, in denen nur Personen einsitzen, die Grund genug haben, meinem Mann irgend etwas übel zu nehmen, Herr Kubinke. Und streng genommen müssen Sie mich auch auch dazuzählen.“
Rudi hob die Augenbrauen. „In wie fern?“, fragte er.
„Maik hatte ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Ich habe mit dem Geld, das ich durch mein sehr gut gehendes Geschäft erwirtschaftet habe, ihm den Start seiner Kanzlei ermöglicht und das war dann sozusagen der Dank dafür...“ Ein bitterer Zug breitete sich jetzt für kurze Zeit in ihrem Gesicht aus. Maik Ozanali ist also seinem Typ treu geblieben, dachte ich. Rudi und ich hatten wohl beide das Gefühl, dass Joanna noch etwas sagen wollte und nur nach den richtigen Worten suchte. Deswegen schwiegen wir und warteten geduldig ab. „So ist nunmal das Leben“, fuhr sie schließlich fort. „Ich sage Ihnen das deshalb, weil Sie ja doch von der Affäre mit Sybille Cromers erfahren hätten und da dachte ich, ist es besser, gleich reinen Wein einzuschenken.“
„Wir wissen Ihre Offenheit zu schätzen“, erklärte ich.
„Auch wenn Maik und ich unsere Probleme hatten, ändert das nichts daran, dass sein Tod für mich ein schwerer Schlag ist und ich Sie bei Ihrer Suche nach dem Täter in jeder Hinsicht unterstützen werde.“
„Darauf werden wir sicher noch zurückkommen“, sagte Rudi.
„Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, dass wir trotz der gerade angedeuteten Probleme wieder enger zusammenkommen und unsere Schwierigkeiten überwinden würden. Und damit sie auch gleich die volle Wahrheit wissen, möchte Ihnen auch noch mitteilen, dass eine Lebensversicherung zu meinen Gunsten existiert, die im Fall von Maiks Tod ausgezahlt wird.“
Ich war etwas verwundert darüber, dass sie uns ein mögliches Mordmotiv nach dem anderen präsentierte. War das wirklich nur der Wunsch, mit offenen Karten zu spielen und die Erkenntnis, dass all die Fakten ohnehin im Laufe der Ermittlungen auf den Tisch kommen würden? Was man nicht verbergen kann, muss man betonen. Das schien Joanna Ozanalis Devise in diesem Punkt zu sein.
„Ja, Sie können davon ausgehen, dass all diese Dinge im Zuge der Ermittlungen überprüft werden und sich daraus natürlich entsprechende Fragen ergeben könnten“, nickte ich.
„Fragen?“ Sie lächelte matt. „Sie meinen, einen Verdacht.“
Ich atmete tief durch.
Sehr tief.
„Meinetwegen, ein Verdacht.“
Sie hob die Augenbrauen.
„Ich nenne die Dinge gerne beim Namen, wissen Sie?“
„Das tun wir auch.”
„So?”
„Wie hoch ist denn die Auszahlungssumme?“
„Eine Million Euro.
„Eine Menge Holz.”
„Und sie ist nicht auf Gegenseitigkeit gewesen, Herr Kubinke.“
„Eine Million Dollar ist wirklich eine hohe Summe.“
„Wissen Sie, das kommt noch aus unserer Anfangszeit. Damals war ich eine kleine Angestellte und Maik war bei der Staatsanwaltschaft und hat Jagd auf Gangster gemacht. Sein Spezialgebiet war damals schon die Geldwäsche und da hat er natürlich gewisse Leute dort gepackt, wo es ihnen am meisten wehtut! Bei ihren Gewinnen nämlich.“
„Das heißt, Sie haben damals schon befürchtet, dass Ihr Mann auf der Abschussliste dieser Leute stehen könnte.“
„Natürlich! Und Maik wollte, dass ich dann abgesichert bin. Mit den Jahren hat sich die Situation allerdings verändert. Ich habe mein Geschäft gegründet und verdiene schon lange mehr als mein Mann. Aber wie das so ist: So eine Versicherung verliert man aus den Augen und wir haben das aus irgendeinem Grund nie geändert. Ich hoffe, dass man mir daraus jetzt keinen Strick dreht.“
„Es ist nicht strafbar, Begünstigte einer Lebensversicherung zu sein“, wich ich aus.
„Nein, aber verdächtig. Und die Summe wäre auch hoch genug, um davon noch einen Profi bezahlen zu können.“
Ich ging nicht weiter darauf ein. Wieso Joanna Ozanali sich so hartnäckig selbst zu belasten versuchte, war mir noch nicht so ganz klar. Aber mein Instinkt zweifelte daran, dass sie irgend etwas mit dem Mord zu tun hatte. Trotz der mehr als stichhaltigen Gründe, ihren Mann zu hassen und vielleicht sogar aus dem Weg räumen zu wollen. Vielleicht war es einfach so, dass ihre Trauer über den Tod von Maik Ozanali letztlich doch einfach zu ehrlich erschien, als dass ich mir vorstellen konnte, dass sie die nur gespielt hatte. Und dass sie ansonsten eher unterkühlt wirkte und ihre Gefühle zurückhielt, ließ das für mich eher noch überzeugender erscheinen, als dass es irgendwelche Zweifel genährt hatte.
Andererseits kann man sich, was solch eine Einschätzung betrifft, sehr leicht vertun.
Ein guter Instinkt ist eine prima Sache – aber man sollte ihm auch nur bis zu einem gewissen Grad trauen.
„Ich habe noch eine andere Frage, Frau Ozanali“, sagte ich. „Was wissen Sie über die Gründe für das Ausscheiden Ihres Mannes aus dem Dienst bei der Staatsanwaltschaft?“
„Die offizielle Version oder die Wahrheit?“, gab sie zurück.
Ich hob die Augenbrauen.
„Ich nehme an, das war eine rhetorische Frage.“
„Wieso?”
„Nur so.”
„Die Arbeit meines Mannes wurde nicht richtig geschätzt. Wir haben nicht nur einmal darüber geredet. Fast jeden Tag hat er darüber geklagt.
„Wie meinen Sie das?”
„Er durfte die Arbeit machen, andere haben sich hinterher in das Kameralicht gestellt und sich mit irgendwelchen Ermittlungserfolgen gebrüstet.”
„Das klingt schlimm.”
„Und bei Beförderungen ist er geflissentlich übergangen worden.“
„Er war zum Schluss immerhin stellvertretender Leiter seiner Behörde.“
„Ja. Aber Friedhelm Dallhaus, der Mann, der sein Vorgesetzter wurde, hat ihm von Anfang an klar gemacht, dass er bei ihm keine Chance gehabt hätte. Maik drohte mit untergeordneten Aufgaben abgespeist zu werden. Und das wollte er sich nicht antun und dachte, es ist besser sich selbstständig zu machen.“
„Und hat ihn nicht irgendwie irritiert, jetzt solche Leute zu verteidigen, die er noch vor kurzem versucht hätte, in Moabit einzuquartieren?“
„Doch, das hat ihn irritiert, sehr sogar. Aber finanziell scheint es sich gelohnt zu haben. Ich habe zwar für die Anschubfinanzierung gesorgt. Schließlich mussten ja Büros eingerichtet und eine Sekretärin eingestellt...“ Sie brach ab. „Ja, das ist ein eigenes Thema, aber irgendwie komme ich immer wieder darauf zurück, wie Sie vielleicht verstehen werden.“
„Das verstehe ich durchaus”, sagte ich.
„Sie sind sehr verständnisvoll.”
„Ich gebe mir Mühe.”
„Na, das ist doch wenigstens etwas...”
*
Etwas später saßen wir wieder im Wagen. Wir hatten uns in der Nähe jeder ein vollkommen überteuertes Sandwich besorgt. Aber die Gegend war nunmal teuer und irgendwohin zu fahren, wo es preiswerter war, dazu hatten wir keine Zeit.
„Was hältst du von Joanna Ozanali?“, fragte Rudi.
„Da bin ich mir noch nicht sicher.“
„Traust du ihr zu, einen Profi engagiert zu haben, um ihren Mann umzubringen?“
„Ehrlich gesagt: Nein.”
Rudi hob die Augenbrauen.
„Wieso nicht?”
Ich zuckte mit den Schultern.
„Das ist nur ein Gefühl, nichts was auf irgendwelchen Tatsachen basiert. Davon abgesehen wissen wir nicht, ob es wirklich ein Profi war.“
„Aber der Schluss liegt doch angesichts der Umstände nahe, Harry!“
„Niemals zu früh festlegen, Rudi, das weißt du doch.“
„Es war ein sehr gezielter Schuss aus großer Entfernung.“
„Das heißt streng genommen nur, dass der Täter ein wirklich guter Schütze ist.“ Ich fädelte den Ford in den laufenden Verkehr ein. „Vielleicht ein ehemaliger Scharfschütze, ein Jäger, jemand der Teil eines SEK-Teams war – da gibt es viele Möglichkeiten.“
„Bin gespannt darauf, was die Ballistik sagt, Harry.“
„Ich auch.“
„Das Obduktionsergebnis an sich dürfte ja weit weniger spannend sein, denn es kann ja wohl niemand im Ernst daran zweifeln, dass die Todesursache die Kugel im Kopf war.“
Wir fuhren zum Präsidium.
Unser gemeinsames Dienstzimmer hatten wir kaum betreten, als unser Kollege Turgut Özdiler herein kam. „Harry! Rudi! Wir wissen jetzt, was für eine Kugel in Maik Ozanalis Kopf steckt“, erklärte er.
„Und?“
„Spezialmunition, wie ich mir schon dachte. Bei der Waffe handelt es sich um eine Weitz MXW-234.“
Ich wechselte mit Rudi einen kurzen Blick. „Nie gehört“, meinte mein Kollege und sprach mir damit aus der Seele. Ich bildete mir schon ein, mich mit Waffen aller Art auszukennen. Das bringt der Alltag in unserem Job nunmal so mit sich. Aber das Fabrikat, das Turgut uns genannt hatte, war mir vollkommen unbekannt.
„Eine Weitz?”,fragte ich. „Dieselbe Waffe, mit der auf mich vor der Anarcho-Kneipe geschossen wurde.”
„Das hatte ich nicht mehr gegenwärtig”, sagte Rudi.
„Die Weitz MXW-234 ist eine wahre Wunderwaffe”, sagte Kollege Özdiler.
„Was soll das Besondere an der Waffe sein?“, fragte ich.
„Sie ist gut.”
„Davon mal abgesehen.”
„Besonders gut.”
„Das sind andere auch, Turgut.”
„Ein Spezialgewehr für Scharfschützen. Gilt in Fachkreisen als eine der besten Waffen dieser Art, die jemals hergestellt wurden. Für eine Weile bestand sogar die Chance, dass die Weitz – übrigens benannt nach ihrem Konstrukteur – zur Standardwaffe für Scharfschützen in der U.S.Army, bei der Bundeswehr und bei den SEK-Teams verschiedener Polizeieinheiten wird. Aber daraus ist aus unerfindlichen Gründen nichts geworden.“
Ich stutzte.
„Und was waren das für Gründe?“, fragte ich, denn so wie das jetzt aus Turgut Özdilers Mund klang, war diese Waffe ein technisch gesehen ziemlich unschlagbares Produkt.
Eine Superwaffe.
„Könnte sein, dass es mit dieser Waffe nicht möglich ist, Standardmunition zu verschießen. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht.”
„Sondern?”,hakte ich nach.
„Ich würde eher vermuten, dass die Herstellerfirma nicht imstande gewesen wäre, die entsprechende Stückzahl innerhalb einer vertretbaren Zeit zu liefern.“
„Also eine seltene Waffe“, schloss ich.
Turgut Özdiler grinste. „Eine sehr seltene Waffe“, stellte er klar. „Und das dürfte uns die Suche nach dem Täter erheblich vereinfachen.“
„Wie viele von diesen Gewehren gibt es denn?“
„Nicht einmal hundert.”
„Weltweit?”
„Ja.”
„Das ist wirklich nicht viel”, sagte Rudi.
„Ich habe mich bereits im Netz informiert. Dieser Weitz ist mit seiner Firma vor einigen Jahren pleite gegangen.“
„Obwohl die Waffe, die er konstruiert hat, doch so gut war?“, wunderte ich mich.
Unser Kollege zuckte mit den Schultern.
„Vielleicht hat er sich einfach übernommen, Harry. Inzwischen tummelt Norman Weitz sich auf radikalen Internet-Seiten, auf denen die Auflösung der BRD und ein Steuerboykott propagiert wird, weil der Staat seine Bürger sowieso nur ausbeutet und bevormundet.“
„Ist Weitz ein sogenannte Reichsbürger?”, fragte ich.
Der Kollege nickte.
„Sowas in der Art.”
„Es müsste sich bei einer so kleinen Anzahl von Waffen doch feststellen lassen, wo die einzelnen Exemplare geblieben sind“, meinte Rudi.
Turgut nickte erneut. „Ist schon in die Wege geleitet.“
„Ist mit speziell dieser Waffe schon einmal ein Verbrechen begangen worden?“, fragte ich.
„Mit der am Park eingesetzten Mordwaffe nicht – aber vor einem halben Jahr hat es einen Fall gegeben. Jörn Mackelhoff, Mitglied eines SEK-Teams der Polizei von München, hat einen Vorgesetzten mit einem Weitz-Gewehr erschossen. Hintergrund ist wohl ein Eifersuchtsdrama. Der Vorgesetzte hatte etwas mit Mackelhoffs Frau. Und ein Zusammenhang mit unserem Fall kann ich da, abgesehen vom Waffentyp, auch nicht erkennen.“
„Hm.”
„Und dann natürlich der tote Killer, der vor dem Anarcho-Lokal auf dich geschossen hat und von dem wir denken, dass der Abu-Jamal-Clan ihn geschickt hat.”
Rudi sagte: Für eine sop seltene Waffe ist sie in letzter Zeit aber ziemlich beliebt bei den Mördern.”
*
Am Spätnachmittag besuchten wir noch einige der Zeugen, deren Aussagen und Personalien am Tatort von den Kollegen der aufgenommen worden waren.
Darunter war auch Josephine Bringemeyer.
Sie nannte sich Objektkünstlerin und wohnte zur Untermiete in einem ehemaligen Lagerhaus.
Als Atelier eigneten sich die hohen Räume sicherlich hervorragend.
Vorausgesetzt, man hatte das nötige Geld, um sich die hohen Heizkosten leisten zu können und hatte nichts dagegen, in einer Umgebung zu wohnen, die in etwa so wohnlich wie eine Autowerkstatt war.
Josephine Bringemeyer bat uns herein.
Das erste, was mir auffiel, war eine lebensgroße Gestalt aus Pappmaché, die Josephine Bringemeyer bemalt hatte. Es roch nach Farbe. „Ich kann Ihnen leider nicht die Hand geben“, sagte sie. „Es sei denn, Sie haben nichts dagegen, wenn sie Farbe abbekommen!“
„Muss nicht unbedingt sein“, gab ich zurück.
„Und es wäre nett, wenn Sie die Tür schließen würden.“
„Sicher.“
Rudi übernahm das. Die Tür war eine relativ schwer zu bewegende Schiebetür. Rudi musste sich ganz schön anstrengen. Die Tür hatte offen gestanden, als wir die Wohnung betraten. Vermutlich um zu lüften.
Josephine Bringemeyer wischte sich die Hände mit einem Lappen ab und betrachtete dabei ihren Pappmaché-Kameraden. Es befanden sich noch einige weitere, schwer zu definierende Objekte im Raum. Darunter eine Vogelscheuche, deren Kopf eine Maske von Donald Trump trug und ein Mobile, das aus kleinen Engeln mit Totenschädeln bestand. Der Luftzug, den schon unser Auftreten verursachte, reichte aus, um sie durcheinander fliegen zu lassen.
In einer Ecke stand ein Bett, daneben ein Tapeziertisch mit Computer und mehreren Papierstapeln. An der Wand hing eine Collage aus den Schnipseln von Zeitschriften.
„Was kann ich für Sie tun?“, fragte sie.
Wir zeigten ihr unsere Ausweise, die sie mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis nahm. „Wir kommen wegen des Mordanschlags, der sich im Park ereignet hat“, sagte ich. „Mein Name ist Kommissar Kubinke und das ist mein Partner Kommissar Meier. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.“
Sie sah mich an.
„Schade“, sagte sie.
„Was meinen Sie damit?“
„Ich hatte schon gehofft, dass Sie vielleicht ein finanziell gut ausgestatteter Galerist wären, oder wenigstens ein Privatkäufer, dem es etwas wert ist, ein echtes Josephine-Bringemeyer-Unikat in der Wohnung zu haben.“
„Tut mir leid, aber damit können wir leider nicht dienen“, sagte Rudi.
Josephine Bringemeyer sah Rudi einige Augenblicke lang an. Dann kehrte ihr Blick wieder zu mir zurück. „Eigentlich habe ich Ihren Kollegen schon alles gesagt. Viel zu sehen war da ja auch nicht... Ich habe nicht einmal den Schuss gehört. Dieser Mann ist einfach tot umgefallen und hatte eine Schusswunde im Kopf.“ Josephine Bringemeyer schluckte. „Schrecklich!“
Sie rieb noch etwas an ihren Händen herum. Dabei stiegen offenbar nochmal die Erinnerungen an das schreckliche Geschehen im Park in ihr hoch. Eine leichte Röte überzog ihr Gesicht. Sie wirkte plötzlich sehr angespannt, auch wenn sie versuchte, dies mit einem ziemlich verkrampften Lächeln zu überspielen.
„Jeder Hinweis, jede Beobachtung kann uns eventuell weiterbringen“, sagte ich. „Auch wenn es Kleinigkeiten sind, die Ihnen vielleicht gar nicht wichtig vorkommen.“
„Ich verstehe“, murmelte sie.
„Wir möchten Sie deswegen bitten, dass wir alles nochmal genau durchgehen.“
„Wissen Sie, ich bin morgens im Park, um die Hunde auszuführen und...“
„Sie haben Hunde?“, unterbrach ich sie.
Josephine Bringemeyer schüttelte den Kopf „Es sind nicht meine Hunde. Wissen Sie, meine Kunst bringt leider noch nicht so viel ein, dass ich alleine von diesen Werken leben könnte. Darum habe ich verschiedene Jobs. Einer davon ist es, die Hunde von Leuten auszuführen, die dafür keine Zeit haben. Und davon gibt es in Berlin eine ganze Menge.“
„Verstehe“, nickte ich.
„Aber um die Zeit sind sowieso fast nur Leute mit Hunden oder Jogger im Park unterwegs. Ich gehe also mit den Hunden daher und hatte gerade etwas Mühe mit einem Terrier, der meinte, er müsste sich unbedingt mit dem Schäferhund eines älteren Herrn anlegen, da fiel dieser Schuss – beziehungsweise er muss gefallen sein, denn gehört habe ich ihn ja nicht.“
Ich holte eine Skizze des Tatorts hervor. „Können Sie mir ungefähr sagen, wo Sie gestanden haben?“, fragte ich.
„Natürlich.“
Sie deutete mit dem Finger auf die Stelle.
„Ein anderer Zeuge, der tatsächlich einen Schäferhund hat, steht auch auf unserer Liste. Wissen Sie noch, wo der stand?“
Sie deutete mit ihrem Zeigefinger an einen Punkt, der ziemlich genau mit den Angaben übereinstimmte, die unsere Kollegen von der City Police von diesem Zeugen erhalten hatten.
„Dann war da noch so ein sportlicher Kerl, der aussah, als würde er für den Ironman trainieren. Der hat gleich den Notarzt angerufen und sich dann um den von der Kugel getroffenen Kerl gekümmert. Da war allerdings nichts mehr zu machen.“
Auch dieser Zeuge stand auf unserer Liste. Es handelte sich um Dr. Gerhard Desendorfer, einen Arzt, der ganz in der Nähe seine Praxis betrieb. Spezialgebiet: Plastische Chirurgie.
„Haben Sie irgendjemanden bei den Bäumen gesehen?“ Ich deutete auf die Skizze und zeigte ihr die Stelle, von der aus geschossen worden war. „Es kann auch später gewesen sein.“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, zuerst hat jeder auf den Toten geschaut und dann erst, woher der Schuss kam. Aber das war mir im ersten Moment auch gar nicht so klar. Einige Leute haben sich geduckt oder sind richtig in Deckung gegangen.“
„Sie nicht?“
„Ich musste die Hunde halten! Und wie gesagt, es waren drei Tiere und die haben zusammen eine ziemlich große Kraft!“
„War da sonst jemand, der Ihnen in irgendeiner Weise aufgefallen ist?“, hakte ich nochmal nach. „Jemand, der vielleicht irgendwie nicht zu diesen Joggern und Hundeausführern gepasst hat oder sich merkwürdig verhielt?“
Auf ihrer Stirn erschien eine Falte. Sie zog die Augenbrauen zusammen, was ihrem Gesicht einen angestrengten Gesichtsausdruck gab. „Doch, da gab es einen“, brachte sie schließlich heraus. „Der passte wirklich nicht dazu! Und er verhielt sich merkwürdig.“
„Können Sie diese Person beschreiben?“
Sie nickte. „Graues Haar, sah sehr verlebt aus und hatte ziemlich deutlich sichtbare Tränensäcke unter den Augen. Er sah aus, als hätte er schon eine Woche nicht mehr geschlafen oder so ähnlich. Und noch was! Er rauchte. Darum ist er mir auch zuerst aufgefallen. Schließlich macht das doch heute fast niemand mehr.“
„Das stimmt“, sagte ich.
„Er wirkte zuerst vollkommen erstarrt und ist dann schließlich abgehauen, bevor die Polizei mit ihm sprechen konnte. Ich sah ihn noch sich entfernen, als die Polizei eintraf. Er schien mit den Bullen nichts zu tun haben zu wollen.“
„Vielleicht redet er ja mit uns“, meinte ich.
„Wir sind auch >Bullen<”, erinnerte mich Rudi.
„Aber andere Bullen”, gab ich zu bedenken.
„Vorausgesetzt, dass wir ihn finden, denn wenn er sich sofort vom Tatort entfernt hat, dann werden unsere Kollegen sicherlich auch keine Personalien von ihm aufgenommen haben“, ergänzte Rudi.
„Fällt Ihnen zu diesem Mann sonst noch etwas ein?“
„Er trug einen Anzug und Mantel, hatte aber eine längliche Sporttasche über der Schulter, die ziemlich vollgepackt wirkte.“
*
Wir statteten auch Dr. Gerhard Desendorfer einen Besuch ab, der nach dem Schuss im Park den Emergency Service gerufen hatte.
Dr. Desendorfer unterhielt eine Privatpraxis. Er empfing uns in seinem Besprechungszimmer. „Ich habe nicht viel Zeit für Sie“, eröffnete er uns gleich. „Den Termin mit Ihnen habe ich zwischen zwei Operationen eingeschoben. Das Team wartet gleich auf mich, machen Sie es also kurz.“
„Neue Brüste und Nasen im Akkord – das scheint ein gutes Geschäft zu sein“, meinte Rudi.
„Mein Spezialgebiet ist die Beseitigung von Unfallfolgen – nicht die Schönheitschirurgie“, erklärte Desendorfer mit einem sehr ernsthaften Unterton. Er schien über Rudis Bemerkung fast ein wenig zornig zu sein. „Tut mir Leid, wenn ich Ihre Vorurteile nicht bestätigen kann.“
„So war das auch nicht gemeint“, betonte Rudi.
Ich legte auch ihm die Skizze des Tatortes vor, ließ mir von ihm zeigen, wo genau er sich befunden und welche Beobachtungen er gemacht hatte. „Leider kam da jede Hilfsmaßnahme zu spät“, erklärte er. „Wissen Sie, ich habe einen Sechzehn-Stunden Tag, das hält man nur durch, wenn man sich extrem fit hält. Deswegen bin ich jeden Morgen im Park und jogge meine Meilen. Das Gute ist, dass der Park für mich quasi um die Ecke liegt und ich keine Zeit damit verschwende, die U-Bahn zum Park zu nehmen oder es gar mit dem Wagen zu versuchen!“
„Wo genau verlief Ihr Jogging Pfad?“, wollte ich wissen.
„Das ist immer derselbe“, erklärte er mir. Er zeigte ihn mir auf der Skizze. Sein Finger fuhr dabei an den Bäumen und Büschen vorbei, wo sich der Täter verborgen hatte.
„Wir gehen davon aus, dass der Schütze sich zwischen diesen Bäumen hier verborgen hat. Das bedeutet, Sie waren kurz vor dem Schuss in seiner Nähe, wenn Sie tatsächlich diesen Weg genommen haben.“
Er runzelte die Stirn. „Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht“, bekannte er.
„Haben Sie irgend etwas zwischen diesen Bäumen dort bemerkt. Genauer gesagt: Jemanden?“
Seine Stirn zog sich in Falten und bildete ein wellenförmiges Muster.
Er sagte:
„Ja, da war jemand.“
„Können Sie denjenigen beschreiben?“
Er lehnte sich auf seinem mit Rollen ausgestatteten Stuhl zurück, was dazu führte, dass er sich mitsamt seinem Stuhl fast einen Meter vom Schreibtisch entfernte.
„Ich war auf mein Training konzentriert und habe kaum darauf geachtet. Vor allem wusste ich ja nicht, dass das später wichtig sein könnte.“
„Trotzdem! Versuchen Sie sich an Einzelheiten zu erinnern.“
„Da war ein Schatten. Und ganz kurz habe ich dann jemanden in einem Parka gesehen. Und mit einer Baseballmütze. Eigentlich bin ich mir auch sicher, dass es ein Mann war. Aber beschwören würde ich das nicht.“
„Hatte diese Person irgend etwas Auffälliges bei sich?“, hakte ich nach.
„Ja. Sah aus wie ein Futteral für Golfschläger oder so ähnlich.“
„Eine gute Verpackung für ein Gewehr“, kommentierte Rudi.
„Ich hoffe, ich habe Ihnen helfen können.“
„Das werden wir sehen“, sagte ich.
„Jedenfalls muss ich mich jetzt auf die nächste Operation vorbereiten.“
„Viel Glück dabei”, sagte Rudi.
„Wieso?”, fragte er.
„Naja, dass Sie nicht daneben schneiden”, meinte Rudi.
Seine Augen wurden schmal. „Falls mir das mal passieren sollte, wäre ich selbst der Allerbeste, um das wieder zu korrigieren”, behauptete er.
*
Eine belebte Geschäftsstraße. Es war bereits dunkel. Lichter von Leuchtreklamen und Fahrzeugen glitzerten. Es hatte zu Nieseln begonnen und ein kalter Wind wehte durch die Straßen. Passanten drängt sich an Geschäften und Restaurants vorbei.
Der grauhaarige Mann mit den stark ausgeprägten Tränensäcken ließ die Zigarette aufglimmen. Er stand im Licht einer Neonreklame, die zu einer Pizzeria gehörte. 'Carlo's Taverna' stand da in ziemlich verschnörkelten Buchstaben, die rot aufleuchteten. Insgesamt gab es zwölf Filialen dieser Kette von italienischen Fast Food Restaurants. Jemand ging sehr nah an ihm vorbei. Er stand irgendwie im Weg. Er wollte noch in die Pizzeria, weil er Hunger hatte und er den ganzen Tag noch nicht richtig etwas gegessen hatte. Aber mit der Zigarette konnte er dort nicht hinein.
Früher war das mal anders gewesen, aber inzwischen gehörten Raucher zu einer diskriminierten Minderheit, wie er fand.
Jemand stieß ihn an. Ein Mann mit dunklem Haar, grauem Anzug und hellem Mantel rammte ihm den Aktenkoffer gegen das Knie und legte einen Arm um ihn.
Beinahe so, als wollte er sich an ihm festhalten. Das Gesicht des Dunkelhaarigen war starr und tot. In der Mitte seiner Stirn befand sich eine kleine Wunde, aus der jetzt Blut heraussickerte.
Der Dunkelhaarige rutschte zu Boden und blieb regungslos liegen.
Der Mann mit der Zigarette stieß ihn von sich. Die noch glimmende Zigarette fiel zu Boden. Sein Blick glitt über die Fensterreihe im dritten Obergeschoss auf der anderen Straßenseite.
Da muss er sein, dachte der grauhaarige Raucher.
Ein Schatten war flüchtig an einem der unbeleuchteten Fenster zu sehen. Unterdessen waren entsetzte Schreie unter den zahlreichen Passanten zu hören.
„Da wurde einer erschossen!“, rief jemand.
„Kennen Sie den Mann?“, fragte den Zigarettenraucher jemand.
„Lassen Sie mich durch!“
Grob bahnte sich der Raucher einen Weg bis zum Eingang der Pizzeria, während ein Passant die Nummer der Polizei in sein Handy tippte.
*
Wir hatten von unserer Fahrbereitschaft die Meldung bekommen, dass der Dienstporsche wieder einsatzbereit war. Also holten wir den Wagen dort ab und tauschen ihn mit dem Ford.
„Es geht nichts über einen vertraute Wagen, Rudi“, meinte ich, während ich mich in den Abendverkehr einfädelte. Es war bereits dunkel und außerdem war es feucht geworden. Es nieselte. Überall spiegelten sich die Lichter in der Nässe.
„Dieser Raucher ist keine heiße Spur“, meinte Rudi.
„Aber vielleicht ein wichtiger Zeuge.“
„Der wird nicht mehr gesehen haben als die anderen. Nämlich fast nichts, wenn man es mal auf den Punkt bringt.“
„Und dass er sich als Einziger vom Tatort entfernt hat?“
„Harry, das kann eine ganz normale Ursache haben. Zum Beispiel, dass er schlichtweg nichts mit der Polizei zu tun haben will. Vielleicht hat er einen ungeklärten Aufenthaltsstatus oder eine Bewährung läuft oder er hatte in dem Park eine Verabredung, von der seine Frau nichts wissen sollte...“
„So früh am Morgen?“, unterbrach ich Rudi.
„Harry, du weißt, was ich meine.“
„Na gut. Aber der Kerl, den der durchtrainierte Chirurg gesehen hat – das dürfte unser Mann sein.“
„Baseballmütze, Parka, Golftasche. Das ist nicht viel, Harry!“
„Ich weiß, Rudi.“
Wir hatten dies Beschreibung natürlich an Walter Stein, unseren Innendienst-Kollegen von der Fahndungsabteilung weitergegeben. Allerdings hatte keiner von uns die Hoffnung, dass diese vagen Angaben dazu führten, dass wir dem Täter in Kürze auf die Spur kamen.
„Wenn es sich tatsächlich um einen Profi handelt, dann hat der ohnehin längst das Weite gesucht“, glaubte Rudi.
Wir hatten die Strecke bis zu der bekannten Ecke, an der ich Rudi nach Dienstschluss zumeist absetzte, noch nicht einmal zur Hälfte hinter uns gebracht, da erreichte uns ein Anruf von Kriminaldirektor Hoch. Über die Freisprechanlage nahmen wir das Gespräch entgegen.
„Es hat einen Mordanschlag gegeben, der vielleicht mit dem Fall im Park in Zusammenhang steht“, berichtete uns der Chef. „Vor einer Filiale einer Schnell-Pizzeria wurde ein Mann durch einen exakten Kopftreffer getötet. Schussdistanz dürfte ähnlich gewesen sein, auch die verwendete Munition und ohne den Kollegen der Ballistik vorgreifen zu wollen, es könnte derselbe Täter zugeschlagen haben.“
„Wer ist das Opfer?“, fragte ich.
„Daniel Nahlenheim, Immobilienmakler, verheiratet, zwei Kinder. Das haben jedenfalls die Kollegen durchgegeben. Zur Zeit läuft dort noch die Untersuchung am Tatort.“
„Wir sind gleich da“, versprach ich.
Rudi ließ das Seitenfenster des Dienstporsches herab und setzte das Rotlicht auf das Dach. An Zeitersparnis würde uns das allerdings aller Erfahrung nach nicht viel einbringen. Dazu hatten wir uns einfach eine zu ungünstige Zeit ausgesucht. Die Straßen der Bundeshaupstadt waren jetzt einfach chronisch verstopft und da brachten auch Rotlicht und Sirene nur wenig an zusätzlicher Geschwindigkeit.
*
Es war ziemlich schwierig, bis zum Tatort vorzudringen, denn aufgrund der vielen Einsatzfahrzeuge hatte sich ein Stau gebildet. Wir fanden schließlich eine Parkmöglichkeit in einer Seitenstraße und mussten fast eine Viertelstunde zu Fuß laufen, bis wir den Ort des Geschehens erreicht hatten.
Der Bereich vor der Pizzeria war mit Flatterband abgegrenzt. Uniformierte Kollegen hielten Schaulustige ab und nahmen Aussagen auf.
„Kubinke, BKA“, stellte ich mich knapp und mit der Dienstmarke in der Hand vor.
Der Nieselregen hatte dafür gesorgt, dass uns inzwischen die Haare am Kopf klebten. Einige Spurensicherer der KTU waren bereits bei der Arbeit. In ihren Ganzkörperoveralls konnte ihnen der Nieselregen zwar nichts anhaben, aber ansonsten war so ein Wetter so ziemlich der perfekte Alptraum eines jeden Erkennungsdienstlers.
Viel erwarten durften wir also nicht.
„Katja Pollarth“, stellte sich uns die Beamtin vor, die den Einsatz offenbar leitete. Sie hatte dichtes rotes Haar, das gelockt über die Schultern fiel. „Die Leiche ist bereits abtransportiert.“
Die Stelle, wo Nahlenheim gelegen hatte, war mit Kreide umrissen worden. Aber es war nur eine Frage der Zeit, wann diese Umrisse sich durch die Nässe aufgelöst hatten.
„Ich habe gehört, das Opfer ist Familienvater“, sagte ich.
„Es ist bereits ein Kollege unterwegs, um die schlechte Nachricht zu überbringen“, erklärte Katja Pollarth. „Zeugen berichten, dass das Opfer plötzlich mit einem Einschussloch auf der Stirn zusammenbrach.“
„Das Projektil ist nicht ausgetreten?“, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf.
„Nein. An der Leiche war keine Austrittswunde zu sehen und wir haben hier auch kein Projektil gefunden.“
Rudi sah mich an. „Die Parallele zu dem Fall im Park ist schon ziemlich groß, Harry.“
„Ein Killer, dem es offenbar darauf ankommt, keine Unbeteiligten in Mitleidenschaft zu ziehen“, schloss ich.
„Das kann man doch gar nicht kalkulieren“, meinte Katja Pollarth. „Na hören Sie mal, selbst bei Spezialmunition kann man nicht sicher sein, dass nicht doch etwas austritt, weswegen man bei Polizeieinsätzen in größeren Menschenansammlungen immer zur Zurückhaltung raten muss.“
Ich lächelte matt. „So steht es in den Handbüchern“, sagte ich.
Katja Pollarth deutete auf die Häuserfront auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Jedes Gebäude sieben bis acht Stockwerke hoch. Dazwischen ein Sandsteinbau mit Flachdach. Im Erdgeschoss waren zumeist Geschäfte. Darüber Büros und in den oberen Stockwerke Wohnungen. Das Übliche eben. „Irgendwo von dort muss der Täter geschossen haben. Wenn man aus so einer Entfernung schießt, dann muss man schon ein Scharfschütze sein, um so exakt zu treffen. Und selbst dann ist es fast unmöglich, Kollateralschäden auszuschließen. Hier laufen so viele Leute herum.“
„Wir haben doch alle unser regelmäßiges Schießtraining“, sagte ich. „Der Schütze muss die Bewegungen des Opfers mit einberechnen...“
„... und außerdem noch die Bewegungen Dutzender Personen in seiner Umgebung?“, unterbrach mich Katja Pollarth. „Ich will gar nicht erst von solchen Faktoren wie dem Wind sprechen.“
„Mit einer guten Waffe und hervorragendem Training ist das denkbar.“
„Dann sollten Sie den Täter in den Reihen militärisch ausgebildeter Spezialisten suchen.“
Ich deutete zu dem Sandsteingebäude. „Haben Sie schon jemanden geschickt, um sich dort auf dem Dach umzusehen?“
„Meine Leute klappern zur Zeit die Häuser auf der anderen Straßenseite systematisch ab, Kommissar Kubinke. Aber wenn der Killer so professionell war wie sein Schuss, dann wird er uns nichts an Spuren hinterlassen haben, woraus wir ihm einen Strick drehen könnten.“
„Es gibt immer irgendwelche Spuren“, gab ich zurück. „Die Frage ist nur, ob wir clever genug sind, sie zu sehen.“
Katja Pollarth hob die Augenbrauen. „Wieso fragen Sie übrigens nach dem Sandsteingebäude, Herr Kubinke?“
Ich sah sie an. „Wenn ich an der Stelle dieses Täters wäre, würde ich von dort oben aus schießen. Oder es zumindest probieren.“
„Die Sicht war ja auch nicht besonders gut, Harry“, meldete sich Rudi zu Wort.
Ich zuckte mit den Schultern. „Vielleicht hatte der Täter ein Infrarot-Zieloptik oder sogar ein Nachtsichtgerät.“
„Vielleicht hat Frau Pollarth Recht und wir sollten tatsächlich davon ausgehen, dass der Täter irgendwann einmal in einer Spezialeinheit bei der Bundeeswehr, beim Bundesgrenzschutz oder der GSG 9 gedient hat“, vermutete Rudi. „Und wenn die verwendete Waffe wieder eine Weitz ist, spräche das ebenfalls dafür.“
Mir fiel plötzlich Rudis starrer Blick auf.
„Die Pizzeria hat eine Überwachungskamera“, stellte er fest.
„Kein Wunder“, äußerte sich Katja Pollarth. „Der Laden hier hat rund um die Uhr auf, und wenn ich nachts um zwei oder drei noch irgendeiner Nachtgestalt eine Pizza servieren sollte, dann hätte ich auch gerne eine Überwachungskamera im Laden – und außerdem am besten noch ein Schrotgewehr unter dem Tresen!“
„Mehr Waffen, mehr Verbrechen”, stellte ich fest.
„Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das immer so ist.”
„Wie bitte?” Ich glaubte mich verhört zu haben. Und sowas dem Mund einer Polizistin? Das war ungewöhnlich. Normalerweise sprechen sich Kollegen immer dafür aus, dass es weniger Waffen in den Händen der Bürger gibt. Mit gutem Grund.
Katja Pollarth sah mich mit großen, ernsten Augen an. „Vor zwei Jahren hat ein Einbrecher meinen Mann erschossen. Ich hatte Nachtdienst und ging Streife. Leider in der falschen Gegend. Wenn die Waffengesetze anders gewesen wären, hätte er sich wehren können und eine Chance gehabt. So einfach ist das. Bis dahin habe ich immer geglaubt, dass nur Spinner fordern, jedermann sollte eine Waffe tragen. Aber seitdem habe ich meine Meinung geändert, Herr Kubinke.“
„Das wusste ich nicht, Frau Pollarth“, sagte ich. Ich war zwar nicht ihrer Meinung, aber ihre Verbitterung konnte ich verstehen. Wahrscheinlich machte sich Katja Pollarth bis heute Vorwürfe – einfach weil sie zum Zeitpunkt des Verbrechens nicht dort gewesen war, wo sie ihrer Meinung nach hätte sein sollen. Ihr Job war es, Menschen zu beschützen und zu verteidigen und in dem einem Augenblick, als es jemanden betraf, der ihr sehr nahestand, war sie nicht zur Stelle gewesen. Solche Selbstvorwürfe entbehren eigentlich jeder Logik, aber sie können zu einer fixen Idee werden, wenn man nicht aufpasst.
Sie schluckte. „Tja, Sie sind jetzt sehr verständnisvoll, Kommissar Kubinke.“
„Das ist doch selbstverständlich.“
„Aber ich weiß genau, was Sie jetzt denken.“
„So?“
„Weil das jeder denkt, der das nicht selbst erlebt hat. Wenn es Ihnen so ergangen wäre, dann würden Sie vermutlich auch Leuten wie Weitz Recht geben.“
„Sagten Sie gerade Weitz?“
„Sagte ich das?“
„Weitz, wie das Gewehr, von dem gerade die Rede war.“
Sie hob die Augenbrauen. „Interessiert Sie ja doch nicht. Und vielleicht wollen Sie mir jetzt auch noch unter die Nase halten, dass mir die Überwachungskamera bisher nicht aufgefallen ist.“
„Die Aufzeichnungen werden wir uns sichern“, kündigte ich an.
„Gut.“
„Aber zurück zu Weitz...“
„Kennen Sie den wirklich nicht? Norman Weitz. Er betreibt eine Website und einen Kanal auf Youtube. Außerdem kann man ihn manchmal in kleineren Sälen reden hören. Er weist nach, wie die Regierung uns alle betrügt und dass jeder sich bewaffnen sollte!“
„Der Herr Weitz, von dem Sie sprechen, ist vermutlich derselbe Weitz, der die Mordwaffe konstruiert hat“, erklärte Rudi trocken.
Katja Pollarth runzelte die Stirn. „Ja, ist es vielleicht schon verboten Waffen zu konstruieren?“
„So kann man das natürlich auch sehen.“
Wir traten in die Pizzeria. Der Leiter der Filiale war ein gewisser Erik Santini. Santini war breitschultrig und korpulent. Er hatte einen dunklen Bart und Arme, die so kräftig waren, wie bei anderen Männern die Oberschenkel. Jemandem wie ihm nahm man es sofort ab, dass er in der Küche stand und den Pizza-Teig selbst knetete. Dass er wahrscheinlich nicht einmal eine Backmischung benutzte, sondern seine Pizzen einfach nur aus dem Gefrierfach holte und aufwärmte, stand auf einem anderen Blatt.
„Ich hoffe, Sie sind mit Ihrer Untersuchung bald fertig“, wandte er sich ziemlich ungehalten an Katja Pollarth. „Das ist geschäftsschädigend!“
„Bei allem Verständnis, aber wir können nichts dafür, dass ein Mord genau vor Ihrer Tür geschah“, erwiderte Katja Pollarth mit einer bemerkenswerten Mischung aus Gelassenheit und Bestimmtheit. Die Unterhaltung über Weitz und die restriktiven Waffengesetze in Deutschland hatten sie meinem Eindruck nach innerlich ziemlich angefasst. Angesichts dessen, was mit ihrem Mann geschehen war, war das auch durchaus verständlich. Allerdings war ihre Ansicht dazu schon außergewöhnlich - für eine Polizistin. Die meisten Kollegen sind froh, wenn so wenig Waffen wie möglich im Umlauf sind. Wer will schon Verhältnisse wie in den Vereinigten Staaten? Jetzt aber schien sie sich wieder vollkommen gefasst und ihre professionelle Haltung zurückgewonnen zu haben.
„Wir brauchen die Aufzeichnungen Ihrer Überwachungskamera“, erklärte ich so sachlich, wie mir das in dieser Situation möglich war.
Er kniff die Augen zusammen. „Das ist nicht Ihr Ernst.“
„Wir brauchen die Aufzeichnungen. Darauf könnte der genaue Tathergang zu sehen sein und das wiederum könnte uns bei unseren Ermittlungen einen entscheidenden Schritt vorwärts bringen.“
„Brauchen Sie nicht einen richterlichen Beschluss?“
„Ich dachte, Sie wären vielleicht auch daran interessiert, dass dieser Killer gefasst wird“, gab ich zurück. „Ist ja schließlich nicht gesagt, dass er das nächste Mal, wenn er zuschlägt, wieder dermaßen genau trifft, dass nicht einmal eine Scheibe zu Bruch geht.“
„Ich nehme nicht an, dass sich ein ähnlicher Fall so kurz hintereinander am selben Ort ereignet“, erwiderte der breitschultrige Santini.
„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Problem dabei sein soll, uns die Aufzeichnungen zu überlassen“, bekannte ich etwas irritiert. „Sie geben uns einfach den Datenträger und fertig.“
Santini seufzte. Er beugte sich etwas näher und sagte dann in gedämpftem Tonfall. „Ich will Ihnen sagen, was das Problem ist. Ich kenne mich mit dem Kamera-System nicht aus. Das hat mein Sohn installiert und ich wäre wahrscheinlich nicht einmal in der Lage, es ein- oder auszuschalten, geschweige denn, Ihnen die Daten zu beschaffen, die Sie haben wollen.“
„Dafür wird sich doch eine Lösung finden lassen“, war ich überzeugt.
„Ich habe diese Anlage in erster Linie, weil sie abschreckend wirkt“, erklärte Erik Santini.
„Es gibt mehrere Möglichkeiten: Entweder, Sie versuchen es doch noch selbst, an den Chip heranzukommen, oder Sie sorgen dafür, dass Ihr Sohn hier schleunigst auftaucht.“
„Der ist leider zurzeit in Paris. Er studiert dort.“
„Dann bleibt nur Möglichkeit Nummer drei“, mischte sich Rudi ein und deutete dabei auf sich selbst. „Sie lassen mich an das Gerät ran. Ein bisschen kenne ich mich damit aus.“
*
Während sich Rudi um die Kamera kümmerte, erreichte die Kollegin Pollarth ein Anruf aus ihrem Revier. Sie wollte offenbar nicht, dass jemand anderes das Gespräch mitanhörte und ging deshalb hinaus.
So blieb ich mit Santini allein.
„Tja, ich glaube, ich werde Ihnen wohl kaum weiterhelfen können“, meinte er. „Und von dem ganzen Ärger wird dieser Abend unseren Umsatz ganz gehörig drücken. Aber für die Sorgen ehrlicher Geschäftsleute haben Leute wie Sie ja sowieso keine Ohren.“
„Wie kommen Sie denn darauf?“
„Nur so, Herr Kommissar... Wie nochmal?“
„...Kubinke“, erinnerte ich ihn an meinen Namen, obwohl ich mich bei ihm vorgestellt hatte. „Ich habe keine Ahnung, woher Ihre negative Meinung über die Polizei kommt, aber ich darf Sie daran erinnern, dass es hier einen Mord aufzuklären gibt. Jemand ist umgebracht worden und jeder hat die Verpflichtung, bei der Aufklärung nach Kräften mitzuwirken.“
„Wenn Sie das sagen.“
„Versuchen Sie sich zu erinnern, was genau geschehen ist!“
„Ja, jede Einzelheit hilft Ihnen. Das ist es doch immer, was dann gesagt wir, was? Aber es tut mir leid.“ Er tickte mit dem Zeigefinger gegen seine Stirn. „Da ist leider nichts gespeichert worden. Ich sehe die Leute kurz an, mache ihnen die Pizza, die sie wollen und vergesse sie dann. Was glauben Sie, wie viele Leute hier jeden Tag ein und aus gehen.“
„Ich hatte nach niemand bestimmtem gefragt, Herr Santini.“
Er kratzte sich am Kinn. „Trotzdem, wo wir uns jetzt so darüber unterhalten... Also ich sehe durch die Scheibe, dass eine Menschentraube entsteht. Es war wohl dieser Nahlenheim erschossen worden, soweit ich das mitbekommen habe.“
„Ja.“
„Ich kenne ihn flüchtig. Ab und zu ist er hier etwas. Aber der springende Punkt ist, als diese Traube sich um den Toten versammelt und die Leute noch wild durcheinander schreien, jemand das Handy ans Ohr nimmt, um Rettungswagen und Polizei zu verständigen, da fällt mir dieser Typ auf, der in die Pizzeria drängte.“
„Erzählen Sie weiter“, forderte ich ihn auf. Möglich, dass sein Bericht so konfus und nichtssagend blieb, wie es bei seiner bisherigen Aussage der Fall war.
„Gegessen hat der Kerl nichts. Er wollte nur durch meine Küche durch und den Hinterausgang benutzen. Pah, stank der nach Zigarettenrauch! Der hatte sich schon an mir vorbeigedrängt, als ich ihn noch aufhalten konnte. Ich habe gesagt: Hey, das ist hier keine Durchgangspassage, mein Herr!“
„Und was hat er gesagt?“
„Er hat mir hundert Euro gegeben und gefragt: Wo geht's hinten raus? Der Schubwagen mit den Backmischungen stand nämlich vor der Tür, die hinten rausgeht. Deswegen konnte er nicht gleich sehen, wo es hingeht und ist überhaupt stehen geblieben. Ich dachte nur: Meine Güte, was hat der ausgefressen, dass er hundert Euro dafür bezahlt, um auf die andere Seite des Blocks zu kommen.“
„Wie sah der Kerl aus?“, fragte ich.
„Also, der Killer kann das doch nicht gewesen sein. Jedenfalls habe ich von den Cops gehört, dass von der anderen Straßenseite aus geschossen worden sein soll und außerdem...“
„Beantworten Sie einfach meine Frage!“, unterbrach ich ihn. „Wie sah der Mann aus?“
„Graue Haut, graues Haar, ausgeprägte Tränensäcke. Er trug Krawatte, Anzug und Mantel, dazu eine Sporttasche. Das passte irgendwie nicht zusammen, wenn ich so darüber nachdenke. Mit der Sporttasche hat er aus Versehen drei Glasschalen mit Dessert abgeräumt. Der ganze Pudding lag dann zwischen den Scherben auf dem Boden. Und wer musste das dann wegmachen?” Er zeigte auf sich selbst. „Natürlich Icke!”
„Sie haben mein Bedauern.”
„Erst dachte ich, er wäre einfach nur ein Trottel.“
„Und was hat Ihre Meinung geändert?“, hake ich nach.
„Als ich ihn drüben in der Küche einholte und ihm ins Gesicht sah.“
„Was meinen Sie genau?“
„Der Mann war fix und fertig. Der zitterte und schwitzte wie jemand der furchtbare Angst hat. Also wenn direkt neben mir jemand erschossen würde, würde es mir vielleicht auch so gehen. Andererseits denke ich, hätte er doch auch froh darüber sein können, dass es ihn nicht erwischt hat.“
„So kann man das natürlich auch sehen“, gab ich zu.
„Und ich bin vor allem erleichtert, dass es keinen Glasbruch gegeben hat. Vor zwei Monaten hat es nämlich schonmal eine Schießerei hier gegeben. Die Täter sind bis heute nicht gefasst worden, aber die Scheibe meines Hauptfensters war zersprungen.“
Jetzt verstand ich zumindest einen Punkt.
„Deshalb also Ihre negative Einstellung zur Polizei.“
„Ich gebe zu, das Ansehen der Bullen hat seitdem bei mir etwas gelitten“, nickte er.
„Wir tun immer unser Bestes“, erklärte ich ihm. „Allerdings bedeutet sein Bestes zu geben noch lange keine Erfolgsgarantie.“
Er runzelte die Stirn. „Da mögen Sie wohl recht haben.“
*
Nachdem wir den Chip mit den Aufzeichnungen der Überwachungskamera an uns genommen hatten, sahen wir uns noch auf der anderen Straßenseite um. Zwar waren die Kollegen von der Kommissarin Pollarth dort bereits ausgeschwärmt und befragten überall mögliche Zeugen, aber Rudi und ich wollten uns auch ein eigenes Bild machen.
Vor allem interessierte uns das Dach des Sandsteingebäudes.
Wir sprachen mit dem Hausmeister. Er hieß Moritz Johannsberg, war ein etwa fünfzigjähriger Mann mit schütterem Haar und einer Vorliebe für Filme mit Sylvester Stallone. Jedenfalls lief einer davon in dem DVD-Player, der in seinem Büro stand. Auf dem Tisch lagen einige DVD-Hüllen.
Moritz Johannsberg schaute immer wieder auf den Flachbildschim, um der Handlung zu folgen. Immerhin hatte er wenigstens den Ton ausgeschaltet.
„Ich sagte ja schon, ich werde Ihnen kaum weiterhelfen können“, erklärte er zum wiederholten Mal.
„Führen Sie uns einfach auf das Dach. Dann sehen wir weiter.“
„Brauchen Sie dafür nicht irgend etwas Schriftliches?“ Er zuckte mit den Schultern und erhob sich dann aus dem abgewetzten Ledersessel, in dem er Platz genommen hatte.
„Wir vermuten, das von dort aus auf die andere Straßenseite geschossen wurde.“
„Ach, deswegen waren so viele uniformierte Kollegen im Haus und haben alle Wohnungen abgeklappert“, schloss er. „Bei mir war aber niemand.“
„Helfen Sie uns?“, fragte Rudi.
Ob wir hier einen richterlichen Beschluss gebraucht hätten, war nicht so ganz klar. Der Fall lag wohl irgendwie in einer Grauzone. Mit Gefahr in Verzug hätten wir kaum argumentieren können und letztlich war die Annahme, dass der Täter von dem Dach dieses Gebäudes aus geschossen hatte, nichts als eine Vermutung. Eine Vermutung, die auf kriminalistischem Instinkt beruhte – und auf der Fähigkeit, sich in die Rolle des Täters hineinzuversetzen. Aber nicht auf Fakten. Die genaue Schussbahn war aufgrund der besonderen Umstände vor der Pizzeria nicht mehr zu ermitteln und so kamen mehrere Dutzend Gebäude als Standort des Schützen in Frage. Er konnte in eine leerstehende Wohnung eingedrungen sein und sich an ein Fenster gestellt haben. Oder er war in eine Wohnung eingedrungen, deren Mieter gerade nicht zu Hause waren. Die NYPD-Kollegen würden jede Menge Arbeit haben, um das wirklich überall abzuklären.
„Ich will mal nicht so sein“, sagte Moritz Johannsberg. „Man soll das Gesetz ja unterstützen.“
„Das finde ich auch.“
„Ich will nur später keinen Ärger bekommen. Davon gibt es hier nämlich schon genug.“
Was er damit genau meinte, ahnte ich nicht einmal. Und da ich zunächst auch nicht glaubte, dass es etwas mit unserem Fall zu tun hatte, hakte ich auch nicht weiter nach. „Gibt es hier eigentlich einen Sicherheitsdienst?“, fragte ich.
„Ja und nein“, sagte Moritz Johannsberg.
„Was denn nun?“, hakte ich nach. „Ja oder nein?“
„Ja, es gibt einen Sicherheitsdienst, der eigentlich darauf achten soll, dass hier nichts geschieht. Allerdings ist von deren Angestellten momentan keiner hier.“
„Wieso nicht?“
„Es gibt Unstimmigkeiten zwischen der Eigentümergesellschaft des Hauses und dem Security Service über die Bezahlung. Und so lange die Ansprüche der Sicherheitsfirma nicht beglichen sind, werden die wohl ihren Dienst einstellen.“
„Kann man ihr nichtmal übel nehmen.“
Moritz Johannsberg zuckte mit den Schultern. „Ich halte mich aus diesen Dingen raus. Aber meinen Gehaltsscheck habe ich diesen Monat auch mit Verspätung bekommen.“
„Dann sind die Eigentümer in Zahlungsschwierigkeiten?“, fragte ich.
„Darauf können Sie einen lassen. Ich meine...“ Ihm war seine rustikale Ausdrucksweise wohl plötzlich peinlich.
„Ich weiß schon, was Sie damit ausdrücken wollen.“
„Die Baustelle auf der Rückseite des Hauses kommt ja schließlich schon seit zwei Monaten nicht mehr voran.“
„Welche Baustelle?“, hakte ich nach.
„Die Fassade der Rückfront musste dringend renoviert werden. Hat man jahrelang nicht gemacht! Es wurde immer dafür gesorgt, dass nach vorne zur Straße hin alles gut aussah. Die Gerüste stehen da noch, aber die Firma hat nicht weiter gearbeitet. Vermutlich wollen die auch erstmal Cash.“ Moritz Johannsberg rieb Daumen und Zeigefinger gegeneinander. „Würde ich auch so machen, wenn das mein Job wäre, die Spinnenlöcher in den Fugen zu stopfen.“
„Führen Sie uns jetzt bitte oben auf das Dach“, erinnerte Rudi ihn.
Moritz Johannsberg warf einen kurzen Blick zu dem Stallone-Film, der durch das Abdrehen des Tons zum Stummfilm geworden war, und seufzte. „Kommen Sie mit“, sagte er.
*
Wir fuhren mit Moritz Johannsberg per Lift in den obersten Stock.
Von dort konnte man über eine Treppe auf das Dach gelangen.
Es war von einem Kiesbett bedeckt. Kalter Wind wehte uns den Nieselregen ins Gesicht. Das Licht von Neonreklamen machte es fast taghell.
„Und was genau suchen Sie jetzt hier?“, fragte Moritz Johannsberg und verzog dabei das Gesicht.
„Ist es möglich, von außen hier rauf zu gelangen?“, fragte ich.
„Ja sicher.”
„Wie?”
„Wenn jemand Lust dazu hat und lebensmüde genug ist, kann er über das Gerüst hier hochklettern. Da passt ja auch niemand mehr auf. Und ich kann da nicht auch noch drauf achten.“
Wir gingen zur Rückfront des Gebäudes. Das Gerüst ermöglichte es tatsächlich, ohne großen Aufwand und unbemerkt das Dach zu besteigen. „Der Täter wird diese Chance sicher erkannt haben“, meinte Rudi.
„Kommt darauf an.“
„Worauf?“
„Wie viel Zeit er hatte, sich auf das Attentat vorzubereiten.“
„Du meinst, er muss gewusst haben, dass das Opfer vor der Pizzeria auftauchen würde.“
„Ja.“
„Das wird ja wohl herauszubekommen sein!“
Wir gingen auf die der Straße zugewandten Seite des Gebäudes. Systematisch suchten wir den Randbereich des Flachdachs nach Spuren ab. Das Licht der Neonreklamen machte uns das leicht.
Moritz Johannsberg stand unterdessen daneben, rieb sich die Hände und schlug sich den Kragen seines Arbeitskittels hoch. „Brauchen Sie mich eigentlich noch?“, fragte er bibbernd.
Da wurde Rudi fündig. „Sieh dir das an, Harry!“ Er deutete auf ein paar deutlich sichtbare Vertiefungen im Kies.
„Da hat jemand gelegen“, stellte ich fest. „Das muss unser Killer gewesen sein.“ Ich machte ein Foto mit der Handy-Kamera. Rudi rief unterdessen die Kollegen von der KTU an, die wir von unserem Standpunkt aus sogar auf der anderen Straßenseite vor der Pizzeria bei der Arbeit beobachten konnten.
Sobald diese Spuren genau ausgemessen waren, wussten wir immerhin, wie groß der Täter war.
„Mittelgroß“, schätzte Rudi, nachdem er das Telefonat beendet hatte. „Schade, ein Extrem in die eine oder andere Richtung wäre fahndungstechnisch sicherlich besser für uns gewesen.“
„Kann man sich nicht aussuchen”, sagte ich.
*
Es war schon ziemlich spät, als wir schließlich zum Präsidium zurückkehrten. Kriminaldirektor Hoch pflegte morgens der Erste und abends der Letzte zu sein, der das Gebäude verließ. Er hatte sich seiner Aufgabe, das Recht zu schützen, vollkommen verschrieben und hin und wieder kam es sogar vor, dass er auch mal eine Nacht im Büro verbrachte.
Es wunderte uns also nicht, als wir ihn noch antrafen.
In einem kurzen Bericht fassten wir alles zusammen, was sich bisher zum Fall Nahlenheim sagen ließ.
Während wir sprachen, klingelte eines der Telefone auf Kriminaldirektor Hochs Schreibtisch. Der Chef nahm ab. „Ja“, sagte er zweimal kurz hintereinander. Dann fügte er noch ein „Das habe ich auch nicht anders erwartet!“ hinzu.
Nachdem er das Gespräch beendet hatte, wandte er sich uns zu und sagte: „Das war Dr. Heinz. Er hat das Projektil bereits aus dem Kopf des Toten entfernt und zur ballistischen Untersuchung gegeben – ober vielleicht sollte man sagen, die Teile des Projektils, die er gefunden hat. Es handelt sich wieder um dieselbe Spezialmunition. Das Projektil ist stark verformt, aber die Herkunftswaffe lässt sich trotzdem eindeutig identifizieren. Morgen früh haben wir das Ergebnis, sagen die Ballistiker der KTU.“
„Aber es war eine Weitz?“, vergewisserte ich mich.
„Es war derselbe Waffentyp wie bei dem Mordanschlag im Park, das steht fest.“
„Fragt sich nur, was die beiden Opfer gemeinsam hatten“, meinte Rudi. „Ein Anwalt, der mit Geldwäsche und organisiertem Verbrechen zu tun hat und ein Immobilienmakler – das passt auf den ersten Blick doch irgendwie zusammen.“
Kriminaldirektor Hoch nickte. „Immobilien sind kein unüblicher Weg, um Geld zu waschen. In Panama sind ganze Hotelkomplexe nur zu diesem einen Zweck aus dem Boden gestampft worden, um Investoren von Schwarzgeld zu ermöglichen, ihre illegalen Drogenmillionen in ein legales Projekt zu stecken. Ob das hier auch den Hintergrund bildet, werden wir sehen.“
*
Als wir Kriminaldirektor Hochs Büro verlassen hatten und über den Flur gingen, lief uns Walter Stein über den Weg. Unser Kollege aus dem Innendienst gehört genau wie Kriminaldirektor Hoch zu denen, bei denen man sich fragte, ob sie überhaupt jemals Schlaf brauchten.
„Hallo, Harry! Hallo Rudi! Ich habe etwas Interessantes über Weitz gefunden.“
„Über das Gewehr oder den Mann?“, fragte ich.
„Über den Mann und das Gewehr. Und mir scheint, beide sind auch kaum voneinander zu trennen. Wenn ihr noch einen Moment Zeit habt...“
Rudi seufzte. „Der Abend ist sowieso gelaufen“, meinte er. „Dann zeig uns mal, was du hast.“
Wir folgten Walt in sein Dienstzimmer. Eigentlich teilte er sich das mit ein paar anderen Kollegen aus dem Innendienst, aber die waren wohl alle längst zu Hause.
Mehrere Computerbildschirme waren aktiviert.
Auf einem war das eingefrorene, ziemlich zornig wirkende Gesicht eines Mannes zu sehen. Er hatte eine auffällige Narbe am Kinn. Sein Zeigefinger wirkte wie der Lauf einer Waffe und deutete auf den Zuschauer. Mit der anderen Hand hielt er ein Gewehr. Das musste wohl eine Original-Weitz sein. Die Waffe, mit der innerhalb von 24 Stunden zwei Menschen in Berlin getötet worden waren.
„Das ist ein Video von einem Portal, das einer Organisation betrieben wird, die sich zur sogenannten neuen Rechten zählt. Aber es finden sich da auch einige Leute, die regelmäßig Video-Blogs erstellen und zum Teil ziemlich extreme Ansichten vertreten.“
„Wir sind ein freies Land“, meinte Rudi.
„So frei nun auch wieder nicht. Wenn jemand dazu aufruft, Leute umzubringen, hört der Spaß auf“, sagte Walter. Er ließ das Video laufen. „Seht euch Weitz in Action an!“
„Es hat nie ein besseres Gewehr als dieses gegeben“, sagte Norman Weitz. „Und hätte es diese Verschwörung gegen mich nicht gegeben, dann wäre die Weitz jetzt die Standardwaffe aller Bundeswehr-Scharfschützen, sowie der Scharfschützen bei den SEK-Teams. Chirurgisch genaue Todesschüsse sind damit möglich, ohne dass man Unbeteiligte in Mitleidenschaft zieht.“
„Aber wenn dein Gewehr so gut ist, wie du sagst...“, begann der Interviewer das Wort zu ergreifen. Er sah so aus, wie man sich das Klischeebild eines Soldaten vorstellte. Er war groß, breitschultrig und hatte einen Bürstenhaarschnitt.
„Es ist sogar noch besser!“, unterbrach Norman Weitz den Interviewer. „Besser als alles, was je gebaut wurde. Aber unsere Regierung und die Behörden, die Bundeswehr, die Polizei – das sind als unterwanderte Organisationen. Unterwandert von einer Verschwörung aus Banken, Industrie, Mafia und Geheimgesellschaften. Die lassen jemanden wie mich nicht hochkommen, weil sie weiter ihren eigenen Schrott an die Regierung verkaufen wollen! Darum sage ich immer: Liefert euch dieser Verschwörung nicht wehrlos aus! Kauft euch jetzt eine Waffe, denn ich prophezeie euch: In ein paar Jahren wird es Bürgerkrieg in unserem Land geben.“
„Ich möchte betonen, dass dieses Video in der Schweiz aufgenommen wurde“, meinte der Interviewer grinsend, „und nicht etwa in Deutschland, wo der Besitz solcher Waffen, wie Herr Weitz sie uns hier vorführt, illegal ist!“
„Aber hier darf man sie noch erwerben und besitzen!“, fuhr Weitz dazwischen. „ Noch möchte ich ausdrücklich betonen! Also komm in die Schweiz, kauf dir eine Waffe und bewahre sie zu Hause auf, damit du dich wehren kannst, wenn diese Schweinebande von Verschwörern endgültig die Macht übernommen hat!“
„Norman, du hast mir im Vorgespräch erzählt, wie die Banken und die anderen Verschwörer in den Behörden dich fertiggemacht haben...“, begann der Interviewer.
„Fertig gemacht ist gut! Ich war so pleite wie eine Kirchenmaus!“, sagte Weitz. „So geht es Erfindern in diesem Land! Aber dem berühmten Kalaschnikow in Russland ist es ja auch nicht besser gegangen. Der hat auch nie etwas davon gehabt, dass er ein gutes Gewehr erfunden hat. Auch nicht, als mit dem Kommunismus längst Schluss war. Und was ist bei uns? Da herrscht doch der Kommunismus insgeheim längst und niemand hat es so richtig mitgekriegt! Aber ich bin enteignet worden! Seht mich an! Ich bin ein Beweis dafür, dass es diese Verschwörung wirklich gibt!“
Dabei hielt er die Waffe grimmig empor.
„Der wirkt ziemlich wirr“, meinte Rudi.
Der Interviewer versuchte das Gespräch wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Norman Weitz hatte sich ziemlich in Rage geredet und war dann kaum noch zu stoppen.
„Kommen wir wieder zu der Waffe zurück, Norman. Ich weiß, dass du diese Geschichte schon öfter erzählt hast, aber die Zuschauer unseres Video-Blogs kennen sie vielleicht noch nicht. Deshalb möchte ich dich bitten, noch einmal zu erzählen, wie die Verschwörer dich gelinkt haben, so dass deine Firma geschlossen wurde.“
Norman Weitz schien allerdings nicht viel Lust zu haben, den Vorgaben des Interviewers zu folgen. „Eines Tages wird sich erweisen, dass dies die beste Waffe war, die in diesem jungen Jahrhundert konstruiert wurde! In einer Menge den richtigen Kopf zu treffen und sonst niemanden – das ist überhaupt kein Problem! Gebt mir zehn Todeskandidaten, verteile sie in einem Stadion in der Zuschauermenge und ich sage euch, ich würde sie alle kriegen! Alle!“
Das schien selbst dem Interviewer etwas zu makaber zu sein. Die Falte auf seiner Stirn war deutlich zu sehen und ließ daran keinen Zweifel. „Na, da können wir ja nur hoffen, dass nicht die falschen Leute deine Waffe in die Hände bekommen! Stellst du die Waffe immer noch in Einzelfertigung her oder sind das nur Restbestände aus deiner geschäftlich aktiven Zeit, wenn ich das mal so ausdrücken darf.“
„Einzelfertigungen mache ich – aber das kostet natürlich einiges! Ich muss ja auch leben!“
„Ja, niemand erwartet, dass du umsonst arbeitest, Norman.“
Weitz ging nahe an die Kamera. „Vielleicht sieht sich ja gerade jemand dieses Video an, der vorhat, Regierungsmitglieder zu töten! Dies hier wäre die ideale Waffe dafür! Und ein paar weitere nichtsnutzige Verschwörer gibt’s ja auch noch, die man alle gleich in einem Aufwasch erledigen sollte! Zehn Mann mit so einer Waffe ausgerüstet, könnten dieses Land verändern, sag ich euch!“
Walter stoppte die Aufzeichnung.
„Das geht noch eine Weile so weiter“, erläuterte er. „Und abgesehen davon gibt es noch Dutzende weiterer Auftritte dieser Art.“
„Ein Spinner“, sagte Rudi. „Dem würde ich sofort glauben, dass er seine irren Pläne auch in die Tat umsetzt.“
„Oder er ist nur ein harmloses Großmaul“, wandte ich ein. Ich sah Walter an. „Hältst du es wirklich für möglich, dass Norman Weitz etwas mit den beiden Morden zu tun hat?“
„Es klingt verrückt, aber angenommen, Weitz hätte tatsächlich ernst gemacht und wollte beweisen, dass seine Waffe die Beste ist, dann würden die beiden Morde wie die Faust aufs Auge dazu passen, Harry.“
„Jedenfalls sind beide Morde eine Werbung für seine Waffe“, musste ich zugeben. „Wobei natürlich nirgends in den Medien kommuniziert wurde, um was für einen Gewehrtyp es sich handelt. Insofern hätte Weitz von diesem Ruhm nichts.“
„In den Pressemeldungen ist von einem Scharfschützengewehr die Rede, Harry“, gab Walter zu bedenken.
„Das ist richtig“, erwiderte ich.
„So viele verschiedene Fabrikate gibt es davon nicht, Harry. Und den Leuten, die es interessieren könnte, diese Waffennarren, die sich von irgendwelchen Verschwörungen verfolgt sehen, die kennen sich aus. Selbst wenn es gar nicht gemeldet worden wäre, wüssten die, was für eine Waffe für so ein Attentat nötig ist und es spräche sich garantiert in der entsprechenden Szene auch blitzschnell herum, dass es eine Weitz war.“
„Meinst du, Norman Weitz geht es darum, noch ein paar mehr Gewehre abzusetzen?“, fragte Rudi.
Walt schüttelte den Kopf. „Nein, bestimmt nicht. Nach allem, was ich herausgefunden habe, ist der mit einer Einzelproduktion mehr als ausgelastet. Und einen Kredit, um noch mal eine richtige Firma zu gründen und durchzustarten, kriegt der im Leben nicht mehr. Weitz würde es natürlich den Verschwörern zuschreiben, ich eher der Mathematik. Jede Bank hätte doch Angst, ihm noch einmal Geld zu leihen, nachdem er ziemlich grandios in die Pleite gegangen ist.“
„Du meinst, es geht ihm um etwas Persönliches“, vermutete ich.
„Um Anerkennung“, sagte Walter. „Unser Psychologe meint dasselbe. Er hat sich die Aufzeichnungen auch angesehen.“
„Da wir gerade über Aufzeichnungen sprechen“, begann ich ein anderes Thema. „Wir haben einen Chip mit Videodaten einer Überwachungskamera, die im Fenster der Pizzeria installiert war, vor der der zweite Mord passierte.“
„Lass mir den Chip hier, damit ich mir die Daten herunterziehen kann, Harry“, meinte Walter.
„Es geht um einen Typ mit hängenden Tränensäcken, grauhaarig, fahles Gesicht, Raucher, aber gepflegte Kleidung in Kombination mit eine Sporttasche.“
Walter hob die Augenbrauen. „Und was hat der mit dem Fall zu tun?“, fragte er.
„Das weiß ich nicht.“
„Etwas mehr als einfach nur Gestocher im Nebel wird es doch wohl sein, was dich dazu bringt, mir diesen Hinweis zu geben.“
„Es ist einfach so, dass bei dem Mord im Park auch ein Mann beschrieben wurde, der so aussieht und sich sehr schnell, fast panisch vom Tatort entfernte und offenbar mit den Kollegen der Berliner Polizei nicht reden wollte.“
„Muss nichts heißen, Harry.“
„Diesmal hat er sich durch die Pizzeria gedrängt und wollte unbedingt hinten raus, als hinge sein Leben davon ab.“ Ich zuckte mit den Schultern. „Vielleicht war das ja auch so. Jedenfalls würde ich gerne wissen, wer das ist. Und davon abgesehen stellt dieser Kerl eine der wenigen Gemeinsamkeiten zwischen beiden Mordfällen dar.“
„Von der Tatwaffe abgesehen, meinst du wohl“, mischte sich Rudi ein.
*
„Glaubst du wirklich, dass jemand so irre sein kann, und wahllos Menschen erschießt, nur, um die Qualität einer Waffe zu beweisen?“, fragte Rudi.
„Wieso nicht?”
„Na, komm!”
„Denk doch mal drüber nach, Rudi!”
„Das ist doch wirklich ziemlich weit hergeholt, findest du nicht auch?“
„Einerseits ja.”
„Und andererseits?”
„Tja.”
Wir hatten schon schon beinahe die bekannte Ecke erreicht, an der ich Rudi immer absetze. Ich musste den Dienstporsche an einer Kreuzung anhalten. Der Regen hatte sich inzwischen dermaßen verstärkt, dass die Scheibenwischer im Dauereinsatz waren. Rudi nahm den letzten Bissen des Hot Dogs, den wir uns unterwegs noch geholt hatten.
„Keine Ahnung, Rudi. Aber vielleicht sollte man mal genauer unter die Lupe nehmen, wie viele dieser Waffen Norman Weitz noch in Einzelanfertigung hergestellt hat und an wen diese Exemplare eigentlich gegangen sind.“
„Das ist nicht so leicht, wie es sich anhört, Harry.” „Vielleicht können uns die Kollegen in der Schweiz ja weiterhelfen.“
Wir hatten die Ecke erreicht und ich setzte Rudi dort ab.
*
Norman Weitz strich über den Kolben des Gewehrs, während er es mit der anderen Hand hielt. Eine gute Arbeit, dachte er. Darauf kannst du stolz sein!
Er senkte die Waffe und überprüfte den Sitz der Zielerfassung. Auch die war das Beste vom Besten. Der Sinn für Qualität und Ästhetik, so fand er, ging den heutigen Waffenkonstrukteuren vollkommen ab. Sein Blick glitt durch das Apartment, das er in Berlin bewohnte. Auf dem Tisch lagen drei Revolver und eine automatische Pistole mit Laserzielerfassung. Außerdem ein Nachtsichtgerät, mehrere Blendgranaten und Sprengstoffladungen zum Öffnen von Türen.
Außerdem noch zwei original Weitz-Gewehre. Einmal die Ausführung für Schafschützen, das andere mit etwas kürzerem Lauf und größerem Magazin. Weitz hatte diese Waffe mal als eine Art Kompromiss zwischen Sturmgewehr und Scharfschützengewehr entworfen. Zwanzig Exemplare gab es davon. Weitz hatte sie vor seinem Konkurs zusammen mit ein paar weiteren Kisten mit Gewehren, Munition, Pistolen, Schutzkleidung und anderem Zubehör fortgeschafft. Schließlich hatte er nicht bei Null anfangen wollen, was seine Waffensammlung betraf. Bankrott sein, das war schlimm. Aber waffenlos bankrott sein, dass überstieg beinahe sein Vorstellungsvermögen. Schlimmer konnte eine Demütigung nicht sein. Und das hatte er sich ersparen wollen.
Weitz unterdrückte ein Gähnen.
Er war hundemüde. Trotzdem hätte er jetzt nicht schlafen können. Jetzt noch nicht...
Er hatte noch nicht alles erledigt, was er sich für die Dauer seines Aufenthalts in Berlin vorgenommen hatte. Ich werde wohl einen Tag länger bleiben müssen, ging es ihm durch den Kopf.
Norman Weitz ging zur Balkontür des Apartments, trat hinaus und sah über die Dächer der umliegenden Häuser. Es regnete inzwischen ziemlich heftig, aber der Balkon war überdacht. Weitz sog die kühle Luft ein. In der Ferne dämmerte bereits der Morgen. Weitz hob das Gewehr, peilte einen ganz bestimmten Punkt an und fixierte ihn mit der Zielerfassung. Er hatte sich ein Fenster in einem Wohnblock ausgesucht. Dort brannte noch Licht – oder schon wieder, ganz wie man wollte. Ein schattenhafter Umriss war zu sehen.
Weitz schätzte die Entfernung auf etwa anderthalb Kilometer.
Ein Lächeln flog über sein Gesicht. Es wäre möglich, dem Kerl dort aus dieser Entfernung den Kopf wegzublasen und die Cops würden monatelang brauchen zu ermitteln, woher genau der Schuss gekommen ist!
*
Am nächsten Morgen war eine Besprechung bei Kriminaldirektor Hoch anberaumt. Außer Rudi und mir nahmen daran noch der Chefballistiker Turgut Özdiler, unser Kollege Walter Stein aus dem Innendienst sowie die Kommissare Stefan Carnavaro und Oliver - genannt 'Ollie' - Medina teil.
„Inzwischen ist bei den allermeisten Exemplaren des Gewehrtyps Weitz MXW-234 geklärt worden, wo sie letztlich geblieben sind“, erklärte Turgut Özdiler. „Die meisten dürften ja wohl zur Konkursmasse von Weitz Betrieb gehört haben. In den Jahren danach hat Weitz in kleinem Rahmen einzelne Waffen auf Anfrage gefertigt und verkauft. Genauere Informationen darüber entziehen sich aufgrund der liberalen Waffengesetze in der Schweiz leider unserer Kenntnis.“
„Was ist mit den Schweizer Kollegen?“, fragte Kriminaldirektor Hoch.
„Wir erwarten, dass sie sich melden, sobald sie mit Weitz gesprochen haben. Schließlich brauchen wir eine Liste der Leute, die sich bei ihm solche Spezialgewehre besorgt haben. Und da er gepfefferte Preise genommen hat, müsste die Anzahl überschaubar sein.“
„Und vermutlich finden wir dort den Täter“, glaubte Kriminaldirektor Hoch. „Ich habe heute Morgen schon mit einer Kollegin in Bern telefoniert. Sie ist heute unterwegs nach Lünchburgzell, um diesem Norman Weitz einer Befragung zu unterziehen.“
„Wie heißt der Ort?“, fragte ich, weil ich dachte, ich hätte mich verhört.
„Lünchburgzell“, meldete sich Walter zu Wort. „Dort befindet sich Hof, auf den Norman Weitz in den letzten Jahren zurückgezogen lebte.“
„Was für ein passender Name“, meinte Rudi.
„Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Waffen, die Weitz verkauft hat, bei Leuten aus dem Umkreis des organisierten Verbrechens gelandet sind“, mischte sich Kollege Stefan Carnavaro ein. Er war Kriminaldirektor Hochs Stellvertreter bei uns im Field Office. „Insofern wäre es tatsächlich wichtig, zu erfahren, wer die Käufer waren. Allerdings verstehe ich eins nicht: Dieses Weitz-Gewehr mag ja eine Wunderwaffe sein, aber wenn ich ein professioneller Killer wäre, würde ich zusehen, dass ich mir doch nicht ausgerechnet so ein exotisches Modell besorge, sondern am besten eine Allerweltskanone, von der es Millionen auf der Welt gibt! Das Risiko ist doch viel zu groß!“
„Tja, alles hängt vom Motiv des Täters ab“, meinte Walter. „Wenn es ein Profi ist, der unauffällig für das organisierte Verbrechen Leute ausknipsen soll, dann ist es in der Tat nicht gerade schlau, sich einer so seltenen Waffe zu bedienen. Davon abgesehen sind die Verbindungen zur Unterwelt bei den beiden Opfern zumindest bei Nahlenheim nicht zwingend. Und irgendwelche Verbindungen der beiden Opfer zueinander konnten bisher auch nicht ermittelt werden. Bis auf die Tatsache, dass sie mutmaßlich durch denselben Täter umgebracht wurden.“
„Worauf wollen Sie hinaus, Walter?“, fragte Kriminaldirektor Hoch.
Kollege Walter Stein wandte sich Rudi und mir zu. „Euch habe ich ja bereits einen Ausschnitt von Norman Weitz Auftritten gezeigt. Wenn dieser Weitz tatsächlich so irre ist, beweisen zu wollen, welche Qualitäten sein Gewehr hat, dann ergibt alles andere einen Sinn.“
Walter Stein führte uns mit Hilfe seines Beamers eine andere Sequenz aus dem Online-Interview vor, nachdem Kriminaldirektor Hoch ihn dazu aufforderte. Die ziemlich kruden Statements wiederholten sich immer wieder. Und auch Ausschnitte aus anderen Internet-Auftritten wirkten wie Wiederholungen dessen, was wir schon gesehen hatten. Es lief immer wieder auf dieselben Punkte hinaus. Danach war Weitz Opfer einer Verschwörung geworden, die letztlich zu seinem wirtschaftlichen Ruin geführt hatte. Walter erläuterte uns allerdings, dass die wahren Ursachen wohl eher darin zu suchen waren, dass der Stückzahlpreis eines Gewehrs einfach zu hoch wurde.
„All die aufwändigen Features dieser Waffe haben eben ihren Preis“, meinte Stefan.
Kriminaldirektor Hoch ließ seine Hände in den weiten Taschen seiner Flanellhose verschwinden. Er sah sich nachdenklich das erstarrte Gesicht von Norman Weitz an, das noch in der Projektion des Beamers zu sehen war. Der Hass funkelte einem förmlich aus den Augen entgegen. „Ein Killer, der nur beweisen will, was für ein genialer Waffenkonstrukteur er doch ist?“ Kriminaldirektor Hoch zuckte mit den Schultern. „Wir hatten schon Mörder, die wesentlich verrückter waren. Sobald die Kollegen aus der Schweiz ihren Besuch auf Weitz’ Bauernhof in der Nähe von Lünchburgzell hinter sich gebracht haben, wissen wir mehr.“
In diesem Augenblick klingelte eines der Telefone auf Kriminaldirektor Hochs Schreibtisch. Unser Chef ging hin, nahm das Gespräch entgegen und teilte uns wenig später mit, dass das Ergebnis der ballistischen Tests jetzt zur Verfügung stand. „Die Waffe, durch die Nahlenheim starb, war definitiv dieselbe, die auch im Park benutzt wurde.“
Alles andere hätte uns in diesem Moment wohl auch sehr gewundert. Ich wandte mich an Walter. „Bist du schon dazu gekommen, die die Aufzeichnungen von der Überwachungskamera anzusehen?“
„War gestern zu spät, Harry. Aber das steht gleich als nächstes auf meiner Liste.“
*
Etwa gegen Mittag meldete sich Kollegin Sandra Sulzerli von den Schweizer Ermittlern über eine Skype-Leitung bei uns. Ihr Gesicht erschien auf meinem Computerschirm. Das Haar hatte sie zu einer strengen Knotenfrisur zusammengefasst. Ich schätzte sie auf Ende Dreißig.
„Guten Tag, Herr Kubinke.“
„Nennen Sie mich ruhig Harry.“
„Wie Sie wollen.“
„Haben Sie mit Norman Weitz gesprochen?“
„Leider nicht. Er war auf seiner Farm nicht anzutreffen.“
„Wo könnte er sonst sein?“
„Vielleicht bei Ihnen in Berlin, Harry.“
Ich hob die Augenbrauen. „Wie kommen Sie darauf?“
„Er hat dem Postboten gesagt, dass er ein paar Tage in Berlin sei und der Postbote deswegen nicht extra zu ihm hinausfahren bräuchte. Außerdem hat er am achtzehnten dieses Monates einen Flug von Zürich nach Berlin gebucht.“
„Hat er den Flug angetreten?“
„Ja. Und bisher nicht zurückgekehrt.“
„Sieh an“, murmelte ich. Das bedeutete, Norman Weitz war zur Tatzeit beider Morde in Berlin gewesen und kam daher als Täter in Frage.
„Das bringt uns weiter”, sagte Rudi Meier.
Ich sagte an die Schweizer Kollegin gerichtet: „Wenn Sie mich fragen, dann sollte man seinen Hof auf den Kopf stellen und sehen, ob man da nicht irgendwelche Beweise findet, die ihn vielleicht mit den Morden bei euch in Verbindung bringen.“
Sie nickte.
„Ja, nur leider wird man bei der gegenwärtigen Beweislage gegen Herr Weitz wohl keinen Richter hier bei uns finden, der einen Durchsuchungsbeschluss unterschreibt. Aber wer weiß, vielleicht komme ich darauf nochmal zurück...“
*
Wir beendeten das Gespräch.
„Norman Weitz muss noch in Berlin sein“, meinte Rudi.
„Und wo steckt er jetzt? Bis wir alle Hotels und Pensionen in Berlin überprüft haben, ist er doch längst wieder auf seinem Bauernhof in Lünchburgzell in der Schweiz.“
„Das ist eine Möglichkeit, Harry.“
Ich sah Rudi fragend an. „Und die andere?“
Rudi zuckte mit den Schultern. „Hängt davon ab, ob er glaubt, dass man die Überlegenheit seiner Gewehrkonstruktion schon zu Genüge zur Kenntnis genommen hat. Wenn du mich fragst, bereitet er gerade das nächste Attentat vor.“
Ich atmete tief durch. „Gut möglich“, gab ich zu. „Allerdings halte ich es für wahrscheinlicher, dass er nach Berlin gekommen ist, um sich mit einem Kunden zu treffen. Jemand, der vielleicht so ein Präzisionsgewehr braucht und vielleicht noch ein paar Spezialwünsche hat. Und das ist dann vermutlich der Killer, den wir suchen.“
Rudi lächelte nachsichtig. „An die Möglichkeit, dass Weitz der Killer ist, willst du immer noch nicht denken, was?“
Wir sorgten dafür, dass Norman Weitz zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Dabei wurde er zunächst nur als Zeuge gesucht. Schließlich wollten wir von ihm wissen, an wen er in letzter Zeit seine Hochleistungsgewehre verkauft hatte.
Walter Stein hatte uns einiges an Datenmaterial über Weitz zusammengestellt. Das sah ich mir an. Die Geschichte mit dem angeblich besten Scharfschützengewehr aller Zeiten, das dann doch nicht zur Standardwaffe geworden war, füllte unzählige Internetseiten. Auch dort sah ich mich ein bisschen um. Rudi ging zwischendurch raus und holte sich einen Becher mit Kaffee. Mir brachte er auch einen mit.
„Sag mal, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Für mich sieht das nach Gestocher im Nebel aus!“
„Ich versuche einen Ansatzpunkt zu finden, wo wir die Suche nach Norman Weitz beginnen können. Allerdings geht mir noch etwa anderes durch den Kopf.“
„Und was?“
„Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht den richtigen Ansatz in diesem Fall verfolgen. Das passt alles noch nicht so richtig zusammen.“
Ich nippte an dem Kaffee, den Rudi mir mitgebracht hatte.
Rudi trank ebenfalls einen Schluck und verzog das Gesicht. „Das kann Mandy besser“, meinte er.
Der Kaffee, den die Sekretärin unseres Chefs braute, war unübertroffen. Einfache Automatenbrühe konnte da natürlich nicht mithalten.
Irgendwie schien der Koffeingehalt trotzdem groß genug zu sein, um meine Konzentration soweit zu erhöhen, dass mir fünf Minuten später etwas auffiel. Ich ließ die Finger über die Tasten gleiten und forschte noch ein bisschen weiter. „Wusstest du, dass Weitz eine Wohnung in Berlin hatte?“, fragte ich Rudi.
„Nein – woher auch. Das klingt interessant.“
„Es gab einen Prozess darum. Die Akte sollten wir uns kommen lassen, aber es reicht eigentlich schon, was in den Zeitungsarchiven im Internet darüber zu lesen ist.“
„Worum ging es dabei, Harry?“
„Weitz ist doch bankrott gegangen. Die Wohnung in Berlin hatte er unter fast konspirativen Begleitumständen angemietet – unter dem Namen Jan Schmitt. Er hat offenbar versucht, in dieser Wohnung einen Teil seines Vermögens zu verbergen.“
„Wie soll das funktionieren?“, wunderte sich Rudi.
„Weitz hatte immer Angst davor, dass die allgemeine Verschwörung dafür sorgt, dass unser gesamtes Regierungssystem und die öffentliche Ordnung zusammenbrechen. Darum hat er offenbar einen Teil seines Vermögens immer in Goldbarren angelegt. Und die hat man dann hier in seiner Berliner Wohnung tatsächlich gefunden.“
„Aber wenn er soviel Gold hatte, hätte er da seinen Konkurs nicht abwenden können?“
„Man hat letztlich nur Gold im Wert von hunderttausend Euro gefunden. Das hätte seine Firma nicht retten können. Weitz bekam eine Anklage wegen Konkursbetrugs an den Hals, hat sich aber mit seinen Gläubigern außergerichtlich geeinigt, sodass er nochmal davongekommen ist.“
„Interessante Story, Harry. Aber wie hilft uns das jetzt weiter?“
„Zumindest hilft uns das, ihn zu finden“, war ich überzeugt. „In den Daten des Einwohnermeldeamtes steht nämlich nirgends, dass diese Wohnung jemals anderweitig vermietet wurde. Aber das lässt sich feststellen.“
*
Etwas später saßen wir bereits im Dienstporsche und waren unterwegs zur Adresse eines gewissen Jan Schmitt, dem ein Apartment in in einem Wohnblock vermietet worden war. Aber hinter dem Namen Jan Schmitt verbarg sich ja niemand anderes als Norman Weitz.
Das Apartment lag im 15. Stock eines grauen Wohnblocks.
Die Fassade war auf Erdgeschosshöhe mit Graffiti verunziert. Immerhin funktionierte der Aufzug.
„Wie konnte sich Weitz diese Wohnung nach seinem geschäftlichen Aus leisten?“, fragte Rudi, als wir uns von der Liftkabine hinauftragen ließen.
„Vielleicht haben ihm Leute geholfen, die seine radikalen Ansichten teilen und ihn unterstützen wollten“, vermutete ich. „Wir haben ja gesehen, wie engagiert er sich an gewissen Kampagnen beteiligt hat.“
Rudi machte eine wegwerfende Handbewegung. „Wer sagt dir, dass Weitz mit seinen Einzelanfertigungen nicht hervorragend verdient hat, Harry? Wahrscheinlich mehr, als du oder ich als BKA-Kommissaren jemals bekommen werden.“
Wir standen schließlich vor der Wohnungstür.
Ich betätigte die Klingel. Eine Sprechanlage knarzte zuerst, bevor sich eine Stimme meldete. „Wer ist da?“
„Harry Kubinke, BKA. Wir möchten Ihnen ein paar Fragen stellen.“
Es knackte in der Sprechanlage. Auf eine Antwort warteten wir zunächst vergeblich. Man hörte jedoch den Atem unseres Gegenübers. Dann krachte es plötzlich. Ein Schuss fiel im Inneren der Wohnung und stanzte ein faustgroßes Loch in die Tür. Die Kugel fuhr dicht an mir vorbei und blieb im Putz auf der anderen Seite des Flures stecken. Ein weiterer Schuss aus derselben offenbar großkalibrigen Waffe folgte, dazwischen das ratschende Geräusch, das beim Durchladen einer Pump Gun entsteht. Rudi und ich hatten uns links und rechts der Tür in Deckung begeben.
„Herr Weitz, wir wollen nur mit Ihnen reden! Aber wenn Sie es darauf anlegen, dann wird ein SEK-Team kommen und die ganze Geschichte nimmt vielleicht ein schlimmes Ende. Noch ist weder jemand getötet oder verletzt worden. Und es liegt in Ihrer Hand, wie es jetzt weitergeht.“
Die Antwort bestand aus einer Salve von zwei Dutzend Pistolenschüssen. Ich hörte das am Klang. Offenbar hielt Weitz in jeder Hand eine Waffe. Die Tür war mittlerweile so löchrig wie ein Schweizer Käse.
„Verschwindet!“, rief er. „Ich werde mich der Schweinebande von Verschwörern nicht ausliefern!“
„Sie sind der genialste Konstrukteur von Handfeuerwaffen seit Samuel Colt“, sagte ich. „Vielleicht interessiert es Sie, dass jemand mit Ihrem Scharfschützengewehr zwei Menschen umgebracht hat.“
Mal sehen, wie er reagiert, dachte ich.
Vielleicht konnte man aus seiner Reaktion sogar Rückschlüsse darauf ziehen, ob er selbst der Killer war, den wir suchten – oder vielleicht doch eher einer seiner Kunden.
„Wie?“, fragte er.
Dadurch, dass ich ihn nicht als Verdächtigen angesprochen hatte, vermied ich es, ihn weiter in die Enge zu treiben. Und das zeigte offenbar eine gewisse Wirkung.
Ich wiederholte nochmal, was ich gesagt hatte. Entweder war er wirklich so überrascht, wie er tat und hatte nichts von den Morden mitbekommen, oder er war durch jahrelange Gewehrtests auf dem Schießstand schwerhörig geworden.
Ich wiederholte also mein Statement.
Dass er für den Angriff auf zwei BKA-Kommissare und die erheblichen Sachbeschädigungen, die er angerichtet hatte sowie den Verstoß gegen das Waffengesetz juristisch auf gar keinen Fall ohne eine Bewährungsauflage davonkommen würde, die ihm den Waffenbesitz in den nächsten Jahren verbot, band ich diesem Waffennarren natürlich in diesem Moment nicht auf die Nase.
Er schwieg. Aber wenigstens schoss er auch nicht.
„Mit irgendeinem Mord habe ich nichts zu tun“, sagte er.
„Dann weiß ich nicht, warum Sie sich hier aufführen, als befanden Sie sich in einer belagerten Festung!“, rief ich. „Legen Sie Ihre Waffen auf den Boden und nehme Sie die Hände hinter den Kopf. Sofort!“
Er schien einzusehen, dass er keine Chance hatte, hier lebend herauszukommen, außer er folgte meinen Anweisungen. Und das tat er dann auch. Ich konnte hören, wie er die Waffen auf den Boden legte.
Ich schnellte vor und gab der ohnehin schon ziemlich ramponierten Tür einen Tritt. Sie sprang zur Seite. Norman Weitz stand mit hinter dem Kopf gefalteten Händen vor mir.
Das Apartment glich schon auf den ersten Blick einem Waffenlager. Abgesehen von den automatischen Pistolen auf dem Boden lag die leergeschossene Pumpgun auf der Couch. Dazu mehrere weitere Waffen auf dem Tisch – darunter auch eines jener Spezialgewehre für Scharfschützen, die für Norman Weitz' Ruhm als ungekrönten König der Konstrukteure gesorgt hatten.
Er hatte sich eingerichtet wie in einer Festung, so als hätte er ständig Angst davor, von den sogenannten Verschwörern angegriffen zu werden.
Und da seiner Ansicht nach ja auch die Behörden, die Justiz und die Polizei von diesen Verschwörern unterwandert waren, waren wir seine Feinde.
Allerdings ließ er sich widerstandslos Handschellen anlegen und festnehmen. Ich erklärte ihm seine Rechte, während Rudi mit dem Präsidium telefonierte.
Jemand musste Weitz abholen. Im ziemlich engen Fond des Dienstporsches war ein Gefangenentransport, der den Sicherheitsbestimmungen entsprach, nicht möglich. Und bei jemandem wie Weitz taten wir sicher gut daran, uns haarklein daran zu halten, denn wie gefährlich dieser Mann war, hatte er ja soeben unter Beweis gestellt.
Außerdem forderten wir unsere Erkennungsdienstler an. Abgesehen davon, dass die Waffen sichergestellt werden mussten, würden jetzt unsere Ballistiker auch einiges zu tun bekommen.
„Ich werde nicht schweigen“, sagte er, nachdem ich ihn darüber belehrt hatte, dass genau dies sein gutes Recht war. „Ich will reden! Und alle sollen mich hören! Alle sollen hören, was wirklich geschieht.“
„Herr Weitz, Sie unterliegen wohl einem Missverständnis“, sagte Rudi. „Niemand wird Ihnen eine weitere Bühne zur Verbreitung Ihrer Ideen zur Verfügung stellen. Es geht hier um Morde – und ob Sie damit etwas zu tun haben, wird sich schnell herausstellen.“
Ich deutete auf das Weitz-Gewehr auf dem Tisch. Die Zielerfassung war abgeschraubt worden und lag daneben. Offenbar hatten wir Norman Weitz bei der hingebungsvollen Pflege seiner Waffen gestört. „Mit so einer Waffe sind zwei Menschen erschossen worden. Sie brauchen nicht so überrascht zu tun, es ist kaum möglich, dass Sie das nicht mitbekommen haben. Die Medien waren voll davon und es würde mich schon sehr wundern, wenn jemand, dem dieses Thema so am Herzen liegt wie Ihnen, das nicht mitbekommen hätte!“
„Hören Sie...“
„Wo waren Sie am Dienstag, den...“
„Sie brauchen sich keine Mühe zu geben, ich geb's ja zu!“
Im ersten Moment glaubte ich, mich verhört zu haben. „Wie bitte?“
Weitz nickte. „Ja, ich gebe es zu“, bestätigte er. „Ich habe damit zu tun.“
„Habe ich mich da verhört?“, hakte ich nach. „Gerade haben Sie noch das Gegenteil behauptet.“
„Es ist die Wahrheit. Ich habe diesen Makler und den Ex-Staatsanwalt umgenietet. Jeder konnte sehen, dass meine Waffe perfekt ist. Wirklich perfekt. Und ich finde, wenigstens das sollten auch Sie anerkennen!“
Rudi und ich wechselten einen Blick. Keiner von uns konnte in diesem Moment seine Ratlosigkeit verbergen.
*
Die Kollegen Kalle Brandenburg und Hansi Morell trafen ein und sorgten für Norman Weitz' Abtransport zum Präsidium. Dort würden sich unsere Verhörspezialisten um ihn kümmern. Es war nur zu hoffen, dass sie den Wahrheitsgehalt seines Geständnisses sicher einschätzen konnten.
Nachdem Kalle und Hansi bereits mit dem Gefangenen weggefahren waren, tauchten unsere Kollegen Steinberger und Forster auf. Die beiden gehörten zu den BKA-eigenen Erkennungsdienstlern.
„Sieht ja wie ein Waffenladen aus“, meinte Steinberger.
Ich deutete auf das Scharfschützengewehr. „Es wäre nett , wenn ihr diese Waffe zuerst abspuren könntet. Es könnte nämlich die Tatwaffe sein und das heißt, sie muss so schnell wie möglich zu den Ballistikern.“
„In Ordnung, kein Problem“, sagte Steinberger.
Mein Handy klingelte. Ich nahm das Gespräch entgegen. Kriminaldirektor Hoch war am Apparat. „Ich habe soeben mit Sandra Sulzerli von der Schweizer Polizei gesprochen“, erklärte unser Chef. „Sie wird mit ihren Kollegen eine Durchsuchung von Norman Weitz’ Bauernhof vornehmen. Die neue Sachlage hat dazu geführt, dass ich einen entsprechenden Beschluss erwirken konnte.“
„Dann wissen wir ja in Kürze, was Sache ist“, meinte ich.
„Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, Harry. Nach allem, was ich bisher über diesen Weitz weiß, scheint er ausgesprochen misstrauisch zu sein. Und wenn er sich wirklich so verfolgt fühlt, dann wird er kaum so leichtsinnig sein, etwa Kundenlisten für seine Einzelanfertigungen in seinem Farmhaus herumliegen zu lassen. Aber jedenfalls ist das ein Anfang.“
Kriminaldirektor Hoch beendete das Gespräch.
„Du machst ein ziemlich skeptisches Gesicht“, stellte Rudi fest, während ich das Mobiltelefon wieder in meiner Jackentasche verschwinden ließ.
„Schon möglich“, murmelte ich.
„Na, spuck's schon aus! Was geht dir im Kopf herum?“
Ich hob die Augenbrauen. „Hältst du dieses Geständnis etwa für glaubwürdig?“
„Dazu habe ich erst eine Meinung, wenn die Kollegen jeden einzelnen Tatumstand haarklein mit ihm durchgegangen sind und er sich dann entweder in heillose Widersprüche verstrickt oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar Täterwissen preisgibt.“
„Mein Instinkt sagt mir, dass der Kerl einfach nur nicht richtig tickt.“
„Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, Harry.“
„Wieso?“
„Wenn er jetzt die Wahrheit spricht und tatsächlich die Morde begangen hat, ist er mit Sicherheit verrückt. Nur Verrückte erschießen wahllos Menschen, um den Perfektionsgrad einer Waffe zu beweisen.“
„Richtig“, nickte ich.
„Aber wenn er lügt und sein Geständnis nur irgendeinem übersteigerten Geltungsbedürfnis entspricht, ist er genauso verrückt, würde ich sagen. Aber Psychologen sind wir beide nicht.“
*
Wir unterhielten uns noch mit dem Vermieter, der Norman Weitz die Wohnung unter dem Namen Jan Schmitt vermietet hatte. Er wohnte im Erdgeschoss, trug den Namen Sebastian Rongwald, war Mitte 70 und hatte das ganze Haus vor zwanzig Jahren geerbt.
Seitdem war die Verwaltung seines Besitzes zu seinem Lebensinhalt geworden. Er empfing uns in seiner Wohnung, die so sehr mit Mobiliar vollgestellt war, dass sie ziemlich eng und klein wirkte. „Ich kann Ihnen leider nichts anbieten“, meinte er. „Wieso erkundigen Sie sich nach Herrn Schmitt?“
„Er heißt in Wirklichkeit Norman Weitz“, stellte Rudi fest.
Sebastian Rongwald zuckte nur mit den Schultern, was bei ihm etwas unbeholfen aussah, weil er einen ziemlich krummen Rücken hatte. „Keine Ahnung. Das hat mich auch nie interessiert. Herr Schmitt hat nie Probleme gemacht und seine Miete immer pünktlich gezahlt. Das ist alles, was für mich zählt.“
„Haben Sie gewusst, dass sein Apartment einem mittleren Waffenlager gleicht?“
„Ja, wusste ich“, bestätigte er zu meiner Überraschung. „Wenn er hier war, hat er immer mal wieder andere Waffen hergebracht und in seinem Apartment aufbewahrt. Er war der Auffassung, dies sei legal. Schließlich könnte er auf seinem Privatbesitz machen, was er will.”
Ich sagte: „Die Auffassung ist nicht ist ganz korrekt.“
„Bin ich Jurist? Innerhalb der Mauern dieses Hauses gelten keine Einschränkungen, hat er gesagt. Das ist Privatbesitz. Ich habe ihm neulich noch geholfen, eine Kiste mit Munition in sein Apartment zu bringen. Hätte ich besser nicht tun sollen.“
„Und wieso?“, hakte ich nach.
Ich nahm an, dass er sich jetzt vielleicht vor einer Anzeige fürchtete.
Weit gefehlt.
Er sagte: „Natürlich wegen dem Rücken. Das habe ich noch tagelang gespürt.“
Ich hob die Augenbrauen.
„Was wollte er mit all den Waffen?“
„Nun, ich möchte meinem Mieter eigentlich nicht unbedingt Schwierigkeiten machen.“
„Herr Rongwald, es ist Ihre Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Und ob Sie Ihren Mieter damit in Schwierigkeiten bringen, ist noch überhaupt nicht gesagt“, stellte ich klar.
„Außerdem sind die Schwierigkeiten, in denen er jetzt steckt, so groß, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht“, ergänzte Rudi. „Er hat zugegeben, zwei Morde hier in Berlin begangen zu haben. Und zwar am Dienstag.“
„Das hat er gesagt?“, wunderte sich Rongwald.
„Ja“, nickte ich.
Rongwald schien das tief zu erschüttern. Ich hatte allerdings keine Ahnung weshalb.
Er schüttelte den Kopf. „Ich verstehe das nicht, wie er so etwas sagen kann. Er war den ganzen Dienstag hier im Haus.“
„Woher wollen Sie das so genau wissen?“
„Weil ich ihn gesehen hätte, wenn er den Hauptausgang benutzt hätte. Ich bin meistens in der Küche und von dort aus kann man sehen, wer rein und raus geht.“
„Ab wann sind Sie dort?“
„Meistens ab sechs Uhr morgens. Ich brauche nicht viel Schlaf. Mittags halte ich allerdings ein kleines Nickerchen. Abends sitze ich dann auch meistens in der Küche, weil da der Fernseher ist. Kommen Sie!“
Er führte uns in die Küche. Dort war es nicht ganz so eng, wie im Rest der Wohnung. Vom Fenster aus konnte man tatsächlich sehen, wer ins Haus ging.
„Und Sie waren morgens ab sechs Uhr hier?“
„Ja, das sagte ich“, bestätigte er noch noch einmal und diesmal etwas ungehalten.
„Für wie lange?“, hakte ich nach, denn darauf kam es jetzt an.
„Meistens bis etwa 10 Uhr. Und abends bin ich hier so lange, bis ich etwas müde werde und schlafen kann. Mein Arzt verschreibt mir zwar Tabletten, mit denen das auch ginge, aber man weiß ja nie so genau, was da alles drin ist und außerdem habe ich ziemlich unter den Nebenwirkungen zu leiden.“
Ich wechselte einen kurzen Blick mit Rudi. Wenn Rongwald seine Aussage mit derselben Beharrlichkeit vor Gericht wiederholte, war es gut möglich, dass man ihm glaubte. Mittlerweile fragte ich mich, ob das Alibi nicht vielleicht sogar der Wahrheit entsprach. Zumindest war mir kein zwingender Grund bekannt, aus dem Rongwald uns hätte anlügen sollen.
„Ist das nicht sowohl morgens als auch Abends noch ziemlich dunkel dort?“, mischte sich nun Rudi ein. „Wie will man da etwas Vernünftiges sehen?“
„Bei Dunkelheit ist das draußen hell erleuchtet“, gab uns Rongwald Auskunft. „So hell, dass der Unterschied zum Tageslicht gar nicht zu sehen ist.“
Ich sah aus dem Fenster.
„Vielleicht werde ich mir das mal ansehen, wenn es dunkel ist“, kündigte ich an.
„Tun Sie das ruhig! Aber glauben Sie mir, er war zu den fragliche Zeiten nirgendwo anders. Vor allen Dingen, weil er doch Besuch bekam. Deswegen bin ich mir so sicher.“
„Besuch?“
„Ja. Aber vielleicht habe ich jetzt auch zu viel gesagt und sollte besser aufhören zu reden.“
„Nein, jetzt packen Sie bitte vollständig aus, Herr Rongwald“, verlangte ich.
Er hob die Schultern.
Sein Gesicht verzog sich.
„Ich bin mir ja auch nicht sicher, deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich so aussagen sollte.“
„Dann äußern Sie es als Vermutung!“, verlangte ich.
Sebastian Rongwald rang noch immer mit sich. Rudi half ihm etwas auf die Sprünge. „Sie vermuten, dass Weitz Waffen verkauft hat und dazu Kunden bei sich in der Wohnung empfing.“
Rongwald zuckte mit den Schultern. „Der eine oder andere ist mit einem Paket weggegangen, in dem durchaus eine Waffe gewesen sein kann. Manche gingen auch mit Taschen, die eigentlich für Golfschläger gedacht sind, glaube ich. Aber da war etwas viel Dickeres drin, so als würde sich ein Gewehrkolben abdrücken.“
Ich griff zum Handy und telefonierte mit Kollege Steinberger und fragte ihn, ob in der Wohnung, die Weitz angemietet hatte, auch Verpackungsmaterialien zu finden gewesen waren.
„Jede Menge davon“, erklärte Kollege Steinberger. „Im Schlafzimmer unter dem Bett war so viel Packpapier, das hätte für ein Jahrzehnt Weihnachten gereicht.“
„Und Futterale für Golfschläger?“, fragte ich.
„Etwa ein Dutzend. Nur keine Schläger, die dazu gepasst hätten. Alle fabrikneu. An manchen klebte noch das Preisschild. Er scheint sie in einem Geschäft für Ramschware in Lünchburgzell, Schweiz, erworben zu haben. Jedenfalls deuten die Aufdrucke auf den Preisschildern darauf hin.“
„Danke.“
„Hat diese Frage eine besondere Bewandtnis?“
„Es könnte sein, dass diese Gegenstände das Verpackungsmaterial eines kleinen Waffengeschäfts war, das Herr Weitz hier betrieben hat.“ Nachdem ich das Gespräch beendet hatte, wandte ich mich noch einmal an Rongwald. „Wie oft hat Ihr Mieter seine Wohnung genutzt?“
„Nur sporadisch. Drei, vier Tage im Monat war das Maximum. Manchmal ist er aber auch mehrere Monate nicht gekommen.“
*
Am nächsten Morgen lagen die Ergebnisse der Durchsuchung des Bauernhofs vor. „Etliche Waffen haben die Kollegen aus der Schweiz dabei sicherstellen können“, erklärte uns Kriminaldirektor Hoch, während wir in einem Besprechungszimmer saßen. „Die ballistischen Tests werden etwas umfangreicher sein. Weitz schien über ein richtiges Waffenlager zu verfügen. Einige der Scharfschützengewehre sind bereits überprüft worden. Es gab keinerlei Übereinstimmung zur Tatwaffe.“
„Dasselbe gilt leider für das in Weitz’ Berliner Wohnung sichergestellte Scharfschützengewehr“, ergänzte unser Kollege Turgut Özdiler, der ebenfalls an dieser Besprechung teilnahm. „Mit den anderen Waffen sind wir zum Großteil durch. Keine davon ist bei kriminellen Handlungen benutzt worden. Zumindest nicht, dass es aktenkundig geworden wäre und es deshalb darüber Vergleichsdaten gäbe.“
„Hält Weitz denn weiter an seinem Geständnis fest?“, fragte ich.
Kriminaldirektor Hoch nickte. „Er ist stundenlang verhört worden. Auf einen Anwalt hat er verzichtet, weil er glaubt, dass nur von den Verschwörern gekauft sei, die ihm schon seit eh und je schaden zuwenden wollten.“
„Das Alibi, das ihm sein Vermieter Herr Sebastian Rongwald für die fraglichen Zeiträume geben kann, ist nicht besonders wasserdicht“, stellte ich klar.
„Je nachdem, wie er im Zeugenstand auftritt, könnten aber beim Gericht Zweifel gesät werden“, gab Rudi zu bedenken. „Und das reicht für einen Freispruch aus.“
„Ich glaube nicht, dass er der Schütze war“, meinte ich.
„Solange er selbst das allerdings so vehement behauptet und sich nicht in eklatante Widersprüche zum ermittelten Tathergang verstrickt, lässt sich dagegen kaum etwas sagen“, gab Kriminaldirektor Hoch zu bedenken.
*
Norman Weitz hatte die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbracht. Unser Verhörspezialist Manuel Schneyder hatte sich bereits alle Mühe gegeben, aus ihm etwas über die Kunden herauszubekommen, die bei ihm Scharfschützengewehre gekauft hatten. Viele konnten das nicht sein. Die Einzelanfertigung war aufwändig und zeitintensiv. Aber Weitz schwieg beharrlich zu diesem Punkt, während er, was andere Themen betraf, umso redseliger war.
Insbesondere wenn es darum ging, sich als Opfer einer großen, landesweiten Verschwörung darzustellen, war er sehr eloquent.
Ging es um Einzelheiten der beiden Morde, von denen er behauptete, sie begangen zu haben, dann blieb er auffällig vage. Fast so, als wollte er auf jeden Fall vermeiden, sich in Widersprüche zu unseren Erkenntnissen zu verwickeln.
Jetzt fand eine neue Befragung statt und diesmal war sowohl ein Vertreter der Staatsanwaltschaft als auch ein für Weitz bestellter Pflichtverteidiger anwesend.
Dass die Staatsanwaltschaft gegen Weitz Anklage erheben würde, stand schon fest. Allerdings war noch nicht ganz klar, wie weit die Vorwürfe gegen Weitz ausgedehnt werden sollten.
Für die Staatsanwaltschaft war Martha Dübell anwesend, eine Mittdreißigerin mit strenger Frisur und elegantem Kostüm. Der Pflichtverteidiger war Alwin Dörner von der Kanzlei Donkersmeyer, Pallenberg & Van der Beek. Dörner war noch ziemlich jung. Einer, der sich noch seine Sporen verdienen musste und sich deswegen selbst bei einer Pflichtverteidigung besonders engagierte. Er unterbrach Manuel Schneyder bei jedem Halbsatz mit einem juristischen Einwand. Manuel verdrehte schließlich genervt die Augen. „Herr Dörner, das ist eine ganz gewöhnliche Befragung zur Feststellung einiger Sachverhalte, nichts weiter. Die rechtliche Beurteilung der ermittelten Fakten findet hier nicht statt.“
„Aber mein Mandant hat Rechte“, erklärte Dörner. „Und ich bin dafür zuständig, auf deren Einhaltung zu achten.“
„Auf diese Rechte verzichte ich gerne“, mischte sich Weitz ein. „Dieser Lakai der Verschwörer soll ruhig verschwinden! Was haben die Ihnen gegeben, damit Sie sich den Fall unter den Nagel reißen und entsprechend Ihrer Auftraggeber manipulieren? Machen Sie so etwas schon für vierstellige Beträge oder verlangen Sie mehr?“
„So kommen wir hier nicht weiter“, stellte die stellvertretende Staatsanwältin Martha Dübell fest. „Herr Weitz, durch Ihre Hand sollen zwei Menschen getötet worden sein, darunter ein ehemaliger Mitarbeiter meiner Behörde. Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie mit Ihrem Geständnis auslösen?“
Weitz kam überhaupt nicht dazu zu antworten. Sein ehrgeiziger Pflichtverteidiger hatte bereits wieder die Initiative an sich gerissen.
„Genau das ist meinem Mandanten nämlich offensichtlich nicht klar“, stellte Dörner fest. „Er schädigt mutwillig seine Interessen. Ich beantrage, ihn sofort einer psychiatrischen Begutachtung zuzuführen, um festzustellen, ob er möglicherweise geisteskrank oder zumindest in seiner persönliche Steuerungsfähigkeit gestört ist.“
„Ja, so macht ihr es immer!“, fauchte Weitz seinen Pflichtverteidiger an. „Ihr erklärt alle für verrückt, die sich eine eigene Meinung nicht verbieten lassen!“
„Herr Weitz, ich habe mit Ihrem Vermieter gesprochen“, mischte ich mich jetzt ein. „Er gibt Ihnen ein Alibi. Danach können Sie keinen der beiden Morde begangen haben.“
Es war zwar höchst fraglich, wie belastbar Rongwalds Aussage tatsächlich war, aber in diesem Moment versuchte ich den Eindruck zu erwecken, von deren Wahrheitsgehalt vollkommen überzeugt zu sein.
Weitz sah mich an.
Ein Sekundenbruchteil lang zeigte er ein Erstaunen, das vollkommen aufrichtig war.
Solche Momente sind manchmal aufschlussreicher, als seitenlange Geständnisse.
„Was bitte?“, murmelte er.
„Wenn Sie denken, dass Sie mit Ihrem Geständnis eine Mordanklage mit großer Prozessbühne bekommen, auf der Sie Ihre Ideen in die Welt hinausposaunen können, dann sind Sie im Irrtum. Die Wahrheit wird durch unsere modernen Ermittlungsmethoden schneller herauskommen, als Sie glauben – und dann stehen Sie wie ein Lügner da,´der sich wichtig machen wollte. Ich denke, dann wird man Ihnen auch sonst nichts mehr glauben – und schon gar nicht diese Story von dieser Verschwörung, vor der Sie uns alle warnen wollen.“
Weitz kniff die Augen zusammen und fixierte mich mit seinem Blick.
„Sie sind so ein Neunmalkluger, was? Das sind die Schlimmsten...“
„Der Täter ist höchstwahrscheinlich jemand, dem Sie ein Gewehr verkauft haben. Aber während Sie es sich hier bequem machen und uns mit einem Geständnis beschäftigen, das vorne und hinten nicht stimmt, läuft der wahre Täter frei herum und wird womöglich wieder zuschlagen. Und wenn das passiert, wird Sie das bis ans Ende Ihrer Tage verfolgen, Herr Weitz! Das garantiere ich Ihnen.“
Weitz öffnete den Mund. Er wirkte ein bisschen wie ein Karpfen, als er die Lippen bewegte, offenbar etwas sagen wollte, aber dann doch keinen Ton herausbrachte.
„Ich möchte mit meinem Mandanten jetzt allein sprechen“, fordert Dörner.
Ich zuckte mit den Schultern. „Wenn Ihr Mandant auch mit Ihnen sprechen will, ist dagegen ja nichts einzuwenden.“
*
„Wie können Sie so sicher sein, dass sein Geständnis wirklich erfunden ist?“, fragte Martha Dübell, als wir den Raum verlassen hatten, um Weitz Gelegenheit zu geben, mit seinem Anwalt unter vier Augen zu sprechen.
„Wer sagt Ihnen, dass ich da so sicher bin?“, erwiderte ich.
„Aber...“
„Ich wollte sehen, wie er reagiert. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Dieser Mann ist nicht der Killer – aber ich wette, dass er weiß – oder zumindest ahnt! - wer es ist.“
„Ihre Vorgehensweise kann uns noch teuer zu stehen kommen, Herr Kubinke!“ Die Staatsanwältin wandte sich an Manuel Schneyder. „Kommissar Schneyder, vielleicht erklären Sie Ihrem Kollegen mal, nach welche Regeln Verhöre durchgeführt werden und dass die Aussagen möglicherweise bei einem Prozess als Beweismittel ausgeschlossen werden, wenn Sie zum Beispiel durch eine Täuschung herbeigeführt wurden.“
Ich sagte: „Ja, das weiß ich, Frau Dübell.“
„Dann kann ich nur hoffen, dass dieser Zeuge, der Weitz ein Alibi gibt, auch wirklich was taugt, sonst stehe ich nachher als Trottel da!“
Rudis Handy klingelte. Er nahm das Gespräch entgegen.
„Es hat einen weiteren Mord gegeben“, erklärte er. „In einem Lokal. Der Schuss traf eine Kollegin: Rita Gerath, Abteilung Organisiertes Verbrechen. Der Schuss wurde aus einem Hotelzimmer auf der anderen Straßenseite abgegeben, ging durch die Scheibe und traf die Kollegin in die Stirn.“
Auch wenn erst eine ballistische Untersuchung des Projektils letzte Sicherheit bringen würden, so war die Art und Weise der Durchführung dieser Tat doch sehr charakteristisch.
Ich wandte mich an die Staatsanwältin. „Richten Sie Herrn Weitz aus, dass genau das eingetreten ist, was ich ihm gesagt habe!“
*
„Vielleicht hat das Ganze ja doch mehr mit organisiertem Verbrechen, Mafia, Geldwäsche und so weiter zu tun, als wir glauben, Harry!“
Wir waren unterwegs zum Tatort. Ich saß hinter dem Steuer des Dienstporsches und Rudi auf dem Beifahrersitz.
„Ich weiß nicht, Rudi...“
„Na hör mal: Eine Polizeibeamtin und ein ehemaliges Mitglied der Staatsanwaltschaft, das jetzt Geldwäscher und Wirtschaftskriminelle verteidigt sind unter den Opfern. Und was diesen Immobilienmakler betrifft, da haben wir vielleicht den Zusammenhang nur noch nicht gefunden.“
„Überzeugend klingt das für mich nicht unbedingt, Rudi.“
„Aber immer noch überzeugender als ein Irrer, der behauptet, die Überlegenheit seines Gewehrs beweisen zu wollen!“
„Den können wir ja jetzt wohl ausschließen.“
Wir erreichten schließlich die angegebene Adresse. Ich setzte den Dienstporsche neben eines der Einsatzfahrzeuge. Dr. Bernd Heinz und die Kollegen der KTU waren noch nicht eingetroffen. Wir zeigten den uniformierten Kollegen, der den Tatort abgeriegelt hatte, unsere Ausweise und gelangten schließlich zu Mancinis Taverna, dem Lokal, wo das Verbrechen stattgefunden hatte. Scherben bedeckten den Bürgersteig. Die Fenster waren noch nicht einmal besonders groß. Jemanden zu treffen, der dahinter an einem der Tische platzgenommen hatte, war ausgesprochen schwierig.
Der Schütze musste wirklich gut gewesen sein.
„Wir müssen zusammen mit Walter nochmal sämtliche Daten durchgehen, die wir über ehemalige oder aktive Mitglieder von SEK-Teams oder Scharfschützen in den Streitkräften haben“, meinte Rudi – aber dieser Vorschlag drückte letztlich nur die ganze Ratlosigkeit aus, die er empfand. „Der Täter muss doch eine militärische Ausbildung gehabt haben. So gut schießt doch wirklich nur jemand, der das beste Training genossen hat.“
„Jedenfalls schießt er besser, als der Kerl, der es vor dem Anarcho-Lokal auf dich abgesehen hatte, Harry”, meinte Rudi Meier dazu.
Wir betraten das Lokal.
Ein lockenköpfiger Kollege begrüßte mich. Er hieß Roger Köhler und ich kannte ihn schon von anderen Einsätzen. Offenbar leitete er diesen Einsatz.
„Hallo Harry! Hallo Rudi! Sieht noch wüst hier aus. Die Spurensicherung war noch nicht da und der Gerichtsmediziner auch nicht.“
Ich sah kurz zu der Toten. Sie lag mit erstarrtem Gesicht auf dem Boden. Der Stuhl, auf dem sie gesessen hatte, war umgestürzt. Ihr Cappuccino auf dem Tisch auch. Es stand noch eine zweite Tasse auf der anderen Seite der Tischplatte. Ausgetrunken.
„Kanntest du Rita Gerath?“, fragte ich.
„Eher flüchtig“, sagte Roger Köhler. „Sie war nicht in unserer Abteilung, aber ich hatte ein paarmal mit ihr zu tun, als es um einen Mord an einem Drogenhändler ging, der in unserem Gebiet passierte.“
„Hast du eine Ahnung, mit wem sie sich getroffen hat?“, hakte ich nach und deutete dabei auf die zweite Tasse.
Kollege Köhler schüttelte den Kopf. „Die meisten Zeugen waren weg, bevor wir eintrafen.“
„Und der Betreiber dieses Lokals?“
„Herr Mancini steht unter Schock. Er sitzt drüben in seiner Küche. Eine Kollegin ist bei ihm, aber bislang konnte man kein vernünftiges Wort aus ihm herausholen.“
Rudi blieb am Tatort. Ich ging hinter den Tresen. Dort war der Durchgang zur Küche und dort fand ich Mancini. Er saß mit starrem Gesicht da, hatte den Kopf auf seine Faust aufgestützt und machte ein Gesicht, das seine Erschütterung mehr als deutlich zum Ausdruck brachte.
Eine Polizistin in Uniform sprach beruhigend auf ihn ein.
Beruhigend. Aber vergeblich.
„Herr Mancini?“, fragte ich.
Er blickte auf. „Ja?“
Ich zeigte ihm meine Dienstmarke. „Kubinke, BKA. Ich habe ein paar Fragen an Sie.“
„Es war furchtbar“, meinte er. „Die Frau saß da und dann zersprang die Scheibe und...“ Er sprach nicht weiter, sondern schüttelte nur den Kopf. „Für Sie ist das wahrscheinlich Routine, aber ich komme da nicht so einfach drüber weg.“
„Wenn Sie annehmen, dass das für mich Routine ist, dann irren Sie sich“, erwiderte ich. „Solche Dinge werden niemals Routine, glauben Sie mir.“
„Ich fürchte nur, dass ich Ihnen überhaupt nicht helfen kann. Ich habe nur gesehen, wie die Frau zu Boden fiel. Dann habe ich mich hinter den Tresen geduckt. Ich dachte nur: Wer weiß, was noch kommt.“
„Erinnern Sie sich daran, mit wem die Frau am Tisch saß?“
Er verengte die Augen. „Saß da jemand?“
„Es steht noch immer eine zweite Tasse auf dem Tisch.“
„Ja, richtig. Sie hab Recht.“
„War das ein Mann oder eine Frau?“
„Ein Mann.“
„Wie sah er aus?“
„Unscheinbar.”
„Und sonst?”
„Grauhaarig.”
„Noch was?”
„Er trug einen Anzug, Mantel. Es war nichts Besonderes.”
„Alter?”
„Ich schätze ihn auf etwa auf etwa fünfzig. Naja, plus minus zehn Jahre. Das ist immer schwer zu sagen, und außerdem habe ihn in mir auch nicht so genau angesehen. Schließlich weiß man ja nicht im Voraus, dass man so ein Gesicht mal beschreiben soll...“
„Schon klar.”
Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Dann atmete er tief durch. „Ich sehe immer etwas ganz anderes vor mir, nämlich wie die Frau plötzlich zuckt und die Kugel...“ Er nahm die Hand weg. „Ich habe genau in dem Moment hingesehen, Kommissar Kubinke.“
Seine Hände krampften sich zu Fäusten zusammen. Das Gesicht wurde dunkelrot und er presste die Lippen aufeinander.
„Ich glaube, das hat keinen Sinn“, sagte die Polizistin. „Wir sollten Herr Mancini etwas Zeit geben den Schock zu überwinden.“
„Arbeitet hier noch jemand?“, fragte ich Mancini.
Aber der gab mir keine Antwort. Er wirkte wie weggetreten. Wahrscheinlich hatte ich schon mehr erreicht, als man unter den gegebenen Umständen eigentlich erwarten konnte. Mehr war im Moment wohl einfach nicht drin.
Ich wandte mich zum Gehen. Dass ich mich von ihm verabschiedete, schien er gar nicht mitzubekommen. An der Tür drehte ich mich noch einmal um. „Hat der Mann geraucht, der mit Rita Gerath am Tisch saß?“, fragte ich. „Oder hatte er eine Sporttasche?“
Er blickte zunächst starr auf den Boden. Die Polizistin sah mich tadelnd an, aber ich hatte diese Frage einfach noch stellen wollen. Verlieren konnte ich ja nichts dabei.
Er hob plötzlich den Kopf und nickte. „Ich habe auch mal geraucht. Ist nicht so einfach, sich das abzugewöhnen, sag ich Ihnen.“
„Schon gut, Herr Mancini.“
*
Ich kehrte zu Rudi zurück. Inzwischen war Dr. Heinz zusammen mit Palina Galhofener eingetroffen, einer Erkennungsdienstlerin der Abteilung Kriminaltechnische Untersuchung.
Rudi stand dabei und hörte sich an, was Dr. Heinz als Ergebnis seiner vorläufigen Untersuchung verkündete.
Kollege Köhlers Handy klingelte und er nahm den Apparat ans Ohr. Sein Gesicht wirkte angestrengt. Er sagte zweimal kurz „Ja!“ und fügte schließlich hinzu: „Ich bin gleich bei Ihnen.“
„Irgendwas Neues?“, fragte ich.
„In dem Haus, von dem aus vermutlich geschossen wurde, hat jemand anscheinend eine interessante Beobachtung gemacht. Es geht um einen verdächtigen Mann, der vielleicht in eine leerstehende Wohnung im dritten Stock eingedrungen ist. Ich werde den KTU-Kollegen Bescheid sagen, dass die an der Wohnungstür entsprechende Untersuchungen anstellen.“
„Ich würde den Zeugen gerne sprechen“, erklärte ich.
Wir folgten Köhler ins Freie. Als wir das Lokal verließen, fiel mir ein abgebrannter Zigarettenstummel auf dem Boden auf. Er wirkte ziemlich frisch und lag genau in einer Fuge zwischen den Pflastersteinen. Ich blieb stehen.
„Worauf wartest du, Harry?“, wollte Rudi wissen.
„Diese Zigarette könnte von dem Mann kommen, mit dem Rita Gerath sich getroffen hat“, meinte ich. „Wenn er der Raucher mit den Tränensäcken ist.“
Ich sicherte die Zigarette mit einem Cellophanbeutel. Bevor der Raucher sich mit Rita Gerath im Lokal getroffen hatte, warf er zunächst seinen Zigarettenstummel weg – so meine Theorie. Ob diese Spur am Ende ein wichtiges Beweismittel oder nur Müll war, musste sich zwar noch herausstellen.
„Man kann es auch übertreiben“, lautete der Kommentar von Köhler.
*
Wir erreichten das Haus, von dem aus vermutlich geschossen worden war. Köhlers Kollegen hatten das zumindest auf Grund der Aussagen mehrerer Passanten ermittelt.
Im zweiten Stock stand eine Wohnung leer, die renoviert werden sollte, bevor sie erneut vermietet wurde. Dort war der Täter wahrscheinlich eingedrungen und hatte von einem der Fenster aus geschossen. Kollegen der KTU suchten jetzt überall nach Spuren, die der Schütze vielleicht hinterlassen hatte.
„Zwei Wochen später und wir hätten moderne elektronische Schlösser gehabt, für die man eine Chipcard braucht“, erklärte uns Franziska Borgsmöller, eine Frau in den Fünfzigern. Ihr gehörte das Haus. Außerdem betrieb sie im Erdgeschoss eine Boutique mit mehreren Angestellten.
Dort trafen wir sie auch. Für die Dienstmarke, mit der ich mich auswies, schien sie kaum Interesse zu haben, stattdessen redete sie munter drauflos.
„Ich habe gesehen, dass der Mann ins Haus ging“, berichtete sie. „Ich dachte, das wäre vielleicht jemand, der sich für die Wohnung interessiert, die im Moment leer steht. Also bin ich ihm gefolgt und habe ihn dann tatsächlich vor der Tür der Wohnung gefunden, die zur Zeit renoviert werden soll und habe ihn angesprochen.“
„Was hat er gesagt?“, fragte ich.
„Er meinte, das sei wohl ein Irrtum und dann hat er mir gesagt, dass er eigentlich zu den Martinellis wollte. Ich habe ihn dann darauf hingewiesen, dass die einen Stock höher wohnen. Aber ich glaube, er hat den Namen nur unten auf den Klingelschildern gelesen und mich abwimmeln wollen.“
„Wie kommen Sie darauf?“
Sie seufzte und wog den Kopf hin und her. „Ich war mir in dem Moment nicht sicher. Als ich den Flur entlangkam hatte ich eigentlich den Eindruck, dass er sich an der Tür zu schaffen machte. Zumindest war das mein erster Verdacht. Aber dann glaubte ich, ich hätte mich wohl doch getäuscht, denn er ist dann gegangen. Anschließend hat meine Angestellte mich per Handy gerufen. Es gab hier Ärger wegen einer Kundenreklamation. Deswegen musste ich sofort zurück.“
„Wie sah der Mann aus?“, hakte ich nach.
„Mittelgroß, vielleicht 45 Jahre alt. Er hatte hier was am Auge.“ Sie zeigte mit dem Finger an die entsprechende Stelle in ihrem Gesicht. „Erst dachte ich, das wäre ein Muttermal.“
„Und das war es nicht?“
„Es hatte die Form einer Träne.“
„Eine Tätowierung.“
„Genau! Sowas war das. Ich dachte noch: Mitten im Gesicht!“
„Wie war er gekleidet?“
„Parka und Baseballmütze. Ach ja, außerdem trug er noch eine Tasche. Ziemlich lang. Ich glaube, so etwas könnte man für Golfschläger oder so was benutzen...“
*
Endlich was Konkretes!
Jetzt konnte die Jagd beginnen!
Vielleicht...
Wir saßen wieder im Dienstporsche. Ich hatte mich in den Verkehr eingefädelt und eigentlich wollten wir jetzt zum Präsidium zurückfahren.
„Ein Mann, der sich eine Träne tätowieren ließ, der müsste doch aufzutreiben sein“, meinte Rudi.
„Fragt sich nur, ob wir schnell genug sind, bevor er das nächste Mal zuschlägt.“
„Du sagst es, Harry!“
Die Zeiten, da Tätowierungen nur von Gangmitgliedern, Seeleuten und Gefängnisinsassen bevorzugt wurden, waren leider schon lange vorbei. Zwar gab es immer noch bestimmte Zeichen, die Drogengangs als Erkennungszeichen benutzten, aber es gab auch Leute, die sich so etwas als Ausdruck ihrer modischen Individualität stechen ließen. Manchmal wurden dabei ganz bewusst Zeichen benutzt, die eigentlich aus der kriminellen Szene kamen.
Es bestand also kein Anlass, irgendwelche vorschnellen Schlüsse zu ziehen. Aber immerhin machte dieses Merkmal die Identifizierung einfacher und vor allem eindeutiger.
„Mich beschäftigt der Kerl, der sich mit Rita Gerath getroffen hat“, sagte ich. „Ich schlage vor, wir machen eine kleinen Umweg.“
„Und wohin?“
„Zu der Dienstelle, zu der Rita Gerath gehörte. Vielleicht weiß ja ihr Vorgesetzter, mit wem sie sich treffen wollte!“
„Gute Idee.”
„Sag ich doch.”
*
Eine halbe Stunde später saßen wir dem Kollegen Rigobert Möhlmann gegenüber. Er leitete eine Abteilung für Organisiertes Verbrechen.
Über Rita Gerath' Tod war er natürlich schon informiert worden. Dass Kollege Köhler sofort uns eingeschaltet hatte, schien Möhlmann nicht sonderlich zu behagen. „Eigentlich würden wir den Mord an unserer Beamtin gerne selbst aufklären“, meinte er. „Vielleicht war Kollege Köhler etwas voreilig.“
„Nein, das denke ich nicht“, erwiderte ich. „Der Zusammenhang zu zwei anderen Morden desselben Täters ist ziemlich eindeutig. Sie würden in der Sache ganz von vorne anfangen.“
Rigobert Möhlmann zuckte mit den breiten Schultern. Die Krawatte hing ihm wie ein Strick um den Hals. Die Hemdsärmel waren hochgekrempelt und ihm war mehr als deutlich anzusehen, wie sehr ihn die Nachricht vom Tod der Kollegin mitgenommen hatte. Er zerdrückte knackend einen leeren Kaffeebecher. „Vielleicht haben Sie recht“, meinte er. „Von diesen Scharfschützenmorden habe ich natürlich gehört. Haben Sie denn schon irgendeine heiße Spur?“
„Vielleicht können Sie uns die liefern.“
„Und wie?“
„Mit wem hat Ihre Kollegin sich in Mancinis Taverna getroffen?“
„Ich habe keine Ahnung.“
„Wenn sie sich mit einem Informanten getroffen hätte...“
„...dann würde ich das wissen, Kommissar Kubinke. Extratouren gibt es in meiner Abteilung nicht. Was wir tun, tun wir als Team. Ich sage immer, wer selber nicht gut organisiert ist, kann der organisierten Kriminalität nicht die Stirn bieten! Einsame Wölfe, die auf eigene Faust ermitteln und sich persönlich in den Vordergrund spielen wollen, kann ich nicht brauchen.“ Rigobert Möhlmann zielte mit dem zerdrückten Kaffeebecher auf den Papierkorb und verfehlte ihn. „Aber Sie wissen ja selber, wie das ist. Das wird bei Ihnen ja wohl nicht anders laufen.“
„Und Rita Gerath war so eine Team-Playerin?“, fragte ich.
„Im Großen und Ganzen ja.“
„Was heißt im Großen und Ganzen?“
„Naja, zu Anfang, als sie in die Abteilung kam, hatte sie ein paar Angewohnheiten, die ich ihr erst austreiben musste.“
„Wo war sie denn, bevor sie in Ihre Abteilung kam?“
„Rita war ein paar Monate in einer anderen Abteilung, ist da aber mit dem Chef nicht klargekommen. Vorher war sie bei der Drogenfahndung, bevor sie zu uns wechselte wechselte.“
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehten. Das entscheidende Teil aus dem Puzzle fehlte uns wohl einfach noch. So erschien alles ohne Zusammenhang. Rudi erkundigte sich noch nach dem Fall, in dem Rita Gerath zuletzt ermittelt hatte. Es ging dabei um Schutzgelderpressung bei Restaurantbesitzern und Geschäftsleuten. Nichts, was irgendeinen Zusammenhang mit unseren bisherigen Ermittlungsergebnissen zu haben schien. Zumindest auf den ersten Blick.
*
Wir gelangten schließlich zurück zum Präsidium. Walter Stein hatte Neuigkeiten für uns. „Ich bin endlich dazu gekommen, das Bildmaterial der Überwachungskamera vor der Pizzeria unter die Lupe zu nehmen“, eröffnete er uns.
Auf einem Computerschirm war ein gut erkennbarer Screenshot des Rauchers mit den ausgeprägten Tränensäcken zu sehen. Walter hatte aus dem vorhandenen Bildmaterial einen Moment herausgefiltert, in dem der Mann genau in die Kamera gesehen hatte. Die Details stimmten mit den Beschreibungen überein, die wir von ihm hatten. Die offenbar ziemlich vollgepackte Sporttasche trug er über der Schulter. Sein Blick wirkte hehetzt. Die Krawatte war etwas gelockert.
„Die Bildqualität reicht für unsere Gesichtserkennungssoftware aus“, sagte Walter. „Ich habe einen Abgleich seiner telemetrischen Daten mit unseren Datenspeichern durchführen lassen. Ich dachte, außer einer Viertelstunde meiner wertvollen Arbeitszeit kostet uns das nichts.“
Ich hob die Augenbrauen.
„Und?“
„Es gibt einen Treffer.“
Walters Finger glitten über die Tastatur seines Computers. Im nächsten Augenblick verschwand das Foto. Stattdessen war ein Dossier zu sehen. Das Foto, das zu dem Datensatz gehörte, zeigte ein Gesicht, das um ein paar Jahre jünger war. Die Tränensäcke waren noch nicht ganz so ausgeprägt, das Haar nur grau durchwirkt, aber noch nicht vollständig ergraut. Aber es konnte keinen Zweifel an der Tatsache geben, dass es sich um denselben Mann handelte.
„Das ist Ludwig Treßloff“, erläuterte Walter. „Ein ehemaliger Geldwäscher, Buchmacher und Betreiber mehrerer Clubs und anderer Geschäfte, die nur einen einzigen Zweck hatten: Dreckiges Drogengeld in schneeweißes, legales Kapital umzuwandeln.“
„Also doch ein Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen“, entfuhr es Rudi.
„Aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt“, erwiderte Walter. „Dieser Treßloff hat gegen seine Organisation ausgesagt und lebt heute unter falscher Identität unter Zeugenschutz.“
„Dann ist er derjenige, auf den es der Killer abgesehen hat?“, fragte ich.
„Die Toten wären dann nur Kollateralschäden“, meinte Rudi.
„Das ist unmöglich“, war ich überzeugt. „Die Schüsse waren gezielt, der Kerl hatte das beste Gewehr der Welt – nicht nur nach Ansicht von diesem irren Herrn Weitz! Dass der dreimal die Falschen tötet halte ich für ausgeschlossen.“
„Dass er aber immer zufällig am Tatort war, dürfte auch ausgeschlossen sein, Harry“, wandte Rudi ein. „Darauf hast du doch selbst immer hingewiesen, deswegen haben wir diese Spur doch überhaupt nur verfolgt!“
„Ja“, murmelte ich.
Wir waren zwar einen Schritt weiter. Allerdings fehlte uns noch eine entscheidende Kleinigkeit.
Ich wandte mich an Walter. „Zwei Fragen müssen jetzt als nächstes beantwortet werden.“
„Und die wären.“
„Frage eins: Gibt es jemanden mit einer unter dem Auge tätowierten Träne, der irgendetwas mit Treßloffs Fall zu tun hatte?“
„Macht etwas Arbeit, lässt sich aber sicher herausbekommen.“
„Frage Nummer zwei: Hatte eine gewisse Rita Gerath mit Treßloff zu tun? Sie hat sich mit ihm getroffen, das steht fest. Und das wird wohl auch keine zufällige Begegnung gewesen sein.“
Die zweite Frage war schnell beantwortet und stand in den den Dossiers, die es zu Treßloff und seinem Fall gab. Rita Gerath hatte während ihrer Zeit bei der Drogenfahndung gegen ein Drogenkartell ermittelt. Treßloff und seine Geldwäscher waren im Grunde ein verlängerter Arm dieser Organisation gewesen. Ein paar Telefonate mit ihrem ehemaligen Vorgesetzten bei der Drogenpolizei ergaben weitere Details. Offenbar war es Rita Gerath gewesen, die Treßloff schließlich davon überzeugt hatte, auszusteigen und die Seite zu wechseln.
„Er hat sich mit ihr getroffen, weil er ihr vertraut hat“, schloss ich daraus. „Treßloff stand das Wasser offenbar bis zum Hals.“
„Aber wie du schon sagtest, wenn dieser Killer es auf Treßloff abgesehen hätte, dass wäre jetzt in dessen Stirn ein Loch und nicht in den Köpfen der drei Opfer“, gab Rudi zu bedenken.
„Genaueres werden wir wohl erst wissen, wenn wir Treßloff haben“, glaubte ich.
„Er lebt heute unter dem Namen Hans-Georg Moldanow“, erklärte Walter Stein.
„Jetzt muss man ihn nur noch finden“, meinte Rudi.
„Jedenfalls wissen wir nun, nach wem wir fahnden müssen. Das erleichtert die Sache schonmal erheblich“, war Walter Stein überzeugt. „Abfrage von Hotels, Überprüfung von Kreditkartenkäufen – irgend etwas wird ihn schon ins Netz laufen lassen.“
„Noch wichtiger ist der Kerl mit der Träne“, erklärte ich.
Doch auch der war jetzt schnell gefunden. Der einzige, der etwas mit Treßloff zu tun hatte und auf den dieses besondere Merkmal zutraf war ein gewisser Frank Melkowski. Sieben Jahre hatte er in der JVA eingesessen. Er hatte zu der Organisation von Geldwäschern und Drogenhändlern gehört, die Treßloff durch seinen Seitenwechsel hatte auffliegen lassen.
„Entlassung wegen guter Führung vor einem halben Jahr“, las Walter aus dem Dossier vor.
„Dann müsste er noch unter Bewährung stehen“, schloss ich.
„Tut er auch“, nickte Walter. „Vor allem haben wir jetzt eine Adresse.“
*
Die Adresse, die Frank Melkowski gegenüber seinem Bewährungshelfer angegeben hatte, gehörte zu einem Wohnhaus.
Wir fuhren sofort dort hin. Unser Kollegen Kalle Brandenburg und Hansi Morell folgten uns mit einem Mitsubishi aus den Beständen unserer Fahrbereitschaft.
Wenn Frank Melkowski der Mann war, der die Morde begangen hatte, dann hatten wir es zweifellos mit jemandem zu tun, der kompromisslos zurückschlug, wenn er sich bedroht fühlte. Er war gefährlich und es war nicht damit zu rechnen, dass er sich so einfach festnehmen ließ.
Mit Blaulicht näherten wir uns dem Ort des Geschehens.
„Auch wenn jetzt alles auf diesen Melkowski hindeutet, ich verstehe dessen Motiv nicht“, sagte Rudi während der Fahrt. „Angenommen, er hat Treßloffs neue Identität herausgekriegt und will sich an ihm rächen – wieso erschießt er ihn nicht und stattdessen andere Leute?“
„Vielleicht ist das genau der Dreh, Rudi.“
„Worauf willst du hinaus?“
„Melkowski saß wegen Treßloffs Aussage im Gefängnis. Das ist ein starkes Motiv. Aber wenn Melkowski Treßloff erschießt, kann er das nur einmal tun – und wenn er so gut trifft, wie es bei den bisherigen Mordanschlägen der Fall war, dann muss das Opfer nicht einmal leiden. Aber so treibt er Treßloff nach und nach in den Wahnsinn.“
„Unbeteiligte abschießen, die einfach nur in der Nähe stehen?“
„Naja, Rita Gerath war ja nicht ganz unbeteiligt. Aber ich glaube letztlich musste auch sie nur sterben, weil sie in Treßloffs Nähe saß. Stell dir das doch mal vor! Wie aus dem Nichts schlägt dieser Killer plötzlich zu, aber immer haarscharf daneben. Damit zeigt er dir: Ich könnte dich jederzeit töten und irgendwann tue ich es vielleicht. Aber du wirst nicht wissen, wann.“
„Zumindest würde das Treßloffs Panik erklären“, stimmte Rudi zu.
„Das erklärt vieles in diesem Fall, Rudi! Zum Beispiel, weshalb Treßloff sofort in die Pizzeria gestürmt ist und zum Hinterausgang wollte!“
„Du meinst, er hat geahnt, wer ihn jagt, Harry?“
„Davon würde ich ausgehen.“
„Er hätte sich an uns wenden sollen, Harry!“
„Er hat sich an Rita Gerath gewendet. Ich kann das auch verstehen. Diese Anschläge konnten doch nur klappen, wenn Melkowski sein Opfer überrascht hat.“
„Und wie? Handyortung?“
„Zum Beispiel. Vielleicht hat er das Ganze aber auch einfach nur gut vorbereitet und kannte die Anlaufstellen, die Treßloff hier in Berlin noch hat.“
„Viele können das eigentlich nicht sein. Schließlich musste er alle Kontakte abbrechen und als Hans-Georg Moldanow ein völlig neues Leben anfangen.“
„Im Grunde war es schon nicht besonders klug, hier an der Spree zu bleiben“, meinte Rudi.
„Dafür gibt es vielleicht einen Grund“, meinte ich.
„Familie? Angehörige?“
Rudi hatte erraten, woran ich gedacht hatte. Er rief Walt an. „Überprüf doch mal, welche Verwandte Treßloff hier in Berlin hat und ob es da eventuell noch jemanden gibt, zu dem er eine besondere Bindung hatte.“
„Mache ich“, sagte Walt über die Freisprechanlage. „Ich habe übrigens noch eine Neuigkeit für euch.“
„Und die wäre?“, fragte Rudi.
„Treßloff alias Hans-Georg Moldanow besitzt im Berliner Umland ein Haus, in dem er offenbar die letzten Jahre ziemlich zurückgezogen gelebt hat.“
„So nah?“, wunderte ich mich. „Ich kann da nur staunen. Dieser Melkowski dürfte schließlich nicht der einzige in Berlin sein, der eine Stinkwut auf Treßloff hat. Und auch wenn die meisten von denen noch sehr lange in Moabit sitzen, heißt das ja nicht, dass die nicht auch von dort aus einen Killer beauftragen könnten.“
Es musste also wirklich einen guten Grund für Treßloff gegeben haben, in der Nähe seiner alten Heimat zu bleiben.
„Stefan und Ollie sind schon unterwegs“, erklärte Walter. „Auch wenn ich nicht annehme, dass wir Treßloff dort zur Zeit auffinden werden, ergeben sich vielleicht Hinweise darauf, wo er zurzeit steckt.“
*
Die Wohnung von Frank Melkowski lag im zwölften Stock. Ich betätigte die Klingel. Rudi und ich hatten die Dienstpistolen in der Hand. Abgesehen davon hatten wir auch einen Durchsuchungsbeschluss dabei.
Ich klingelte ein zweites Mal, nachdem beim ersten Mal keine Reaktion erfolgte.
Dann traten wir die Tür ein. Sie sprang zur Seite. Ich stürzte als erster in das Apartment.
„Keine Bewegung! BKA!“, wollte ich schon rufen, aber bereits nach den ersten Silben verstummte ich. Ich ließ die die Dienstwaffe vom Typ SIG Sauer P226 sinken.
Es war niemand im Apartment. Rudi überprüfte Bad und Schlafzimmer.
„Nichts“, stellte er fest.
„Hier ist es so aufgeräumt, als hätte hier auch schon lange niemand mehr gewohnt“, sagte ich.
Alles war wie glatt geleckt. Nicht eine Kleinigkeit war zu finden, die irgendeinen Rückschluss auf die Person desjenigen zuließ, der hier wohnte. Die Kleiderschränke waren leer. Es gab keine Zahnbürste im Bad und der Kühlschrank war gar nicht erst angeschlossen worden.
Rudi steckte seine Waffe wieder ein.
Inzwischen waren auch Kalle und Hansi durch die Tür gedrängt.
„Mir scheint, das große Aufgebot war in diesem Fall etwas übertrieben“, äußerte sich Kalle Brandenburg. Der Kollege schüttelte den Kopf. „Der hat diese Adresse nur zur Tarnung benutzt.“
„Wer es sich leisten kann, ein Weitz-Gewehr anfertigen zu lassen, der kann auch die Miete für so ein Nest bezahlen“, sagte ich.
Leute wie Melkowski schafften es leider immer wieder, einen Teil ihrer ergaunerten Gewinne irgendwo zu bunkern.
„Ich glaube, hier wird jetzt nicht einmal die Spurensicherung noch etwas finden können – außer den Staub von mehreren Monaten“, murmelte Rudi.
*
Unsere Kollegen Stefan und Ollie erreichten das abgelegene, an einem See gelegene Haus von Hans-Georg Moldanow.
„Er hat ja tatsächlich ziemlich einsam hier gewohnt“, meinte Ollie.
„Für jemanden wie ihn allerdings eigentlich nicht einsam genug“, glaubte Stefan. „Auch wenn man den Eindruck hat, dass sich hier Fuchs und Hase gute Nacht sagen – Alaska oder die Antarktis wären vielleicht eine bessere Wahl gewesen für Ludwig Treßloff alias Hans-Georg Moldanow.“
Sie parkten den Ford, mit dem sie hier herausgefahren waren in der breiten Einfahrt. Das Haus war aus Blockbohlen errichtet und sah aus wie auf Bildern über die amerikanische Pionierzeit.
Rudi und Ollie stiegen aus.
„Siehst du einen Wagen, Ollie?“
„Nee.”
„Hm.”
„Vielleicht in der Garage dort.“ Stefan deutete zu dem Nebengebäude. „Aber für mich sieht das eher aus als wäre niemand zu Hause.“
Nebel hing über dem Wasser und waberte das Ufer empor. An einer Anlegestelle lag ein Motorboot.
Stefan und Ollie gingen zur Haustür. Eine Klingel gab es nicht. Wozu auch? Wer hier rausfuhr wurde erwartet und hatte sich vor allem vorher höchstwahrscheinlich den Weg beschreiben lassen.
Stefan klopfte. Es gab keine Reaktion.
Auch nach dem zweiten energischen Klopfen nicht.
„Ich sehe mich mal hinten um“, schlug Ollie vor.
„Okay.“
Ollie umrundete das Haus, trat auf die Veranda an der Rückfront. Das Fenster war zersprungen. Ollie griff zur Waffe und blickte hinein. Eine Frau saß in einem Ledersessel, das Gesicht dem Fenster zugewandt. Die Züge waren wie gefroren, die Augen allerdings geschlossen. Mitten auf der Stirn war ein Einschussloch zu sehen.
*
Stefans Anruf erreichte uns, als wir wieder Mobilfunk hatten.
In knappen Worten fasste er zusammen, was Ollie und er im Haus vorgefunden hatten. „Das muss der erste Mord dieser Serie gewesen sein, Harry.“
„Wer war die Frau?“, fragte ich.
„Wir haben ihre Identität inzwischen ermittelt. Sie hieß Regina Balduin. Sie wohnt in einer kleinen Ortschaft in Brandenburg und wird seit einigen Tagen vermisst, wie uns der örtliche Dienstellenleiter der Polizei informierte. Offenbar hat sie ein Wochenende bei Treßloff verbracht. Und dann hat jemand sie von außen erschossen.“
„Und Treßloff hat in Panik alles stehen und liegen gelassen und ist so schnell wie möglich verschwunden“, schloss ich.
„Vorher hat er der Toten allerdings noch die Augen geschlossen“, ergänzte Stefan.
Wir beendeten anschließend das Gespräch.
„Dieser Mord scheint deine Theorie von Frank Melkowskis Rachemotiv zu stützen“, glaubte Rudi.
Wir waren unterwgs. Walter Stein hatte nämlich herausgefunden, dass Treßloffs Mutter in einem Altenheim lebte. Und wir waren der Überzeugung, dass sie der Grund war, weshalb Treßloff den Großraum Berlin nicht verlassen hatte und letztlich lieber das Risiko eingegangen war, zufällig auf Personen zu treffen, die etwas mit seinem alten Leben zu tun hatten.
Eine halbe Stunde später stellte ich den Dienstporsche vor dem Hauptgebäude der Einrichtung ab. Wir stiegen aus. Die Pflegedienstleiterin empfing uns und wir zeigten unsere Ausweise.
„Frau Treßloff ist leider nicht ansprechbar“, eröffnete uns sie uns. Ihr Name lautete Paula Dunkeltz. Er stand in Großbuchstaben auf dem Namensschild, das sie am Revers ihres Kittels trug. „Demenz im fortgeschrittenen Stadium. Zuletzt hat sie nicht einmal ihren Sohn erkannt, als er das letzte Mal hier war.“
„Wann war das?“
„Vor einer guten Woche. Er besucht seine Mutter regelmäßig.“
„Könnten Sie ihn erreichen – für den Fall beispielsweise, dass sich der Zustand von Frau Treßloff verschlechtert?“
Sie sah mich etwas überrascht an und nickte anschließend. „Wir haben eine Mobilfunknummer, unter der wir Frau Treßloffs Sohn ständig erreichen können – insbesondere in dem Fall, den Sie gerade geschildert haben.“
„Diese Nummer brauchen wir“, erklärte ich ihr.
Sie schrieb mir die Nummer auf einen Zettel, nachdem sie in ihrem Telefonregister nachgesehen hatte. „Ich hoffe, Sie können das lesen, Kommissar Kubinke.“
„Kein Problem. Sie haben uns sehr geholfen. Falls Frau Treßloffs Sohn hier auftauchen sollte, unterrichten Sie uns bitte sofort!“
„In Ordnung.“
Ich gab ihr meine Karte. Eine Frage hätte ich noch“, sagte ich dann und holte einen Fotoausdruck hervor, der Frank Melkowski zeigte. „Haben Sie oder irgendjemand unter Ihrem Personal diesen Mann schon einmal gesehen? Hat er sich vielleicht mal erkundigt oder...“
„Ich kenne diesen Mann.“
„Ach, ja?“
„Ja, ich bin mir sicher - wegen der Träne unter dem Auge. Ein ehemaliger Strafgefangener, dem unser christlich orientiertes Haus eine Chance geben wollte. Er war schließlich nicht wegen eines Gewaltverbrechens verurteilt worden, sondern nur wegen irgendeiner Betrügerei oder so etwas.“
„Geldwäsche.“
„Sag ich doch! Also was Harmloses.”
„Darüber kann man geteilter Meinung sein.”
„Kein Mord oder was Perverses.“
„Frank Melkowski hat hier gearbeitet?“, hakte Rudi noch mal nach.
„Er sollte für drei Monate den Hausmeister vertreten, der sich das Bein gebrochen hatte. Er hat allerdings nur ein paar Tage durchgehalten. Und mit elektrischen Leitungen kannte er sich auch nicht so aus, wie er ursprünglich behauptet hatte. Da, wo er im Gemeinschaftsraum versucht hat, ein Bild aufzuhängen, sieht man immer noch die Macken in der Wand. Ich würde sagen, er hatte zwei linke Hände.“
„Aber dafür einen wachen Verstand“, murmelte ich.
Ich wechselte einen Blick mit Rudi. Dazu brauchte nichts mehr gesagt werden. Jetzt war uns klar, wie Melkowski sein eigentliches Opfer so gut hatte beschatten können und wie er es geschafft hatte, ihm immer wieder aufzuspüren. Melkowski hatte sich zweifellos dieselbe Mobilfunknummer besorgt, die wir jetzt auch zur Verfügung hatten. Eine Nummer, die zwar zu einem Prepaid-Handy ohne Vertrag gehörte – aber einem, das Ludwig Treßloff alias Hans-Georg Moldanow ganz sicher niemals ausschalten würde.
Und eine Handy-Ortung ist für jemanden, der Smartphone oder ein Netbook mit Internetverbindung besitzt, eine Kleinigkeit. Es gibt Dutzende von Diensten, die so etwas anbieten.
*
Während wir auf dem Rückweg waren, telefonierten wir mit dem Präsidium und gaben die Nummer durch. Es dauerte nur Minuten, dann war die gegenwärtige Position von Ludwig Treßloff ermittelt. Da wir noch ein ganze Stück Weg vor uns hatten, wurden unsere Kollegen Kalle Brandenburg und Hansi Morell losgeschickt, um Treßloff in Sicherheit zu bringen. Sie würden vermutlich vor uns am Ort des Geschehens sein.
Rudi rief Treßloffs Nummer über die Freisprechanlage an, denn er musste gewarnt werden.
„Herr Treßloff? Hier spricht Rudi Meier vom BKA. Legen Sie nicht auf. Vertrauen Sie mir. Sie sind in akuter Lebensgefahr, aber unsere Kommissare sind zu Ihnen unterwegs, um Sie zu schützen.“
„Wie kommen Sie an diese Nummer?“, fragte Ludwig Treßloff.
„Wir waren bei Ihrer Mutter. Dort haben Sie die Nummer bei der Pflegedienstleitung für dringende Fälle hinterlegt. Das ist doch richtig, Herr Treßloff?“
„Ja“, lautete die tonlose Antwort. Erst nach einer Pause sprach er dann plötzlich weiter. „Sagen Sie Ihren Kommissaren, sie sollen nicht herkommen! Er wird sie auch erschießen! So macht er es – er erschießt Leute in meiner Nähe, um mir zu zeigen, wie viel Macht er hat!“
„Behalten Sie die Nerven, Herr Treßloff. Und sagen Sie mir genau, wo Sie sich jetzt befinden.“
*
Treßloff befand sich in einem Hotel in Berlin.
Rudi aktivierte den TFT-Bildschirm unseres Bordrechners. Er ließ sich die Umgebung der Pension zuerst als Kartenübersicht und dann als Satellitenfoto anzeigen. Die einzelnen Gebäude waren deutlich zu erkennen. „Melkowski weiß, wo sich Treßloff befindet“, sagte er.
„Davon gehen wir aus“, bestätigte ich.
„Dann wird er ihn beobachten, ihn von einer günstigen Stelle aus belauern. Erinnere dich an den Mord vor der Pizzeria! Wie kann Melkowski gewusst haben, dass er gerade dort hergehen wird?“
„In dem er ihn beobachtet hat, Rudi.“
„Genau! Ich wette, Treßloff hat irgendwo in der Nähe übernachtet und anschließend nur die Wege gemacht, die unbedingt nötig waren!“
„Zum Beispiel in die nächste Pizzeria gehen und etwas essen.“
„Aber dadurch wurde er für Melkowski um so berechenbarer.“
Die Frage war, ob es in der Nähe von Treßloffs gegenwärtigem Aufenthaltsort einen Platz gab, der für Melkowskis Zwecke ideal war. Einen Platz, von dem aus er Treßloff beobachten und dann in aller Ruhe darauf warten konnte, dass sich eine Situation ergab, die er ausnutzen konnte.
Stefan rief uns an.
„Wir sind bei Treßloff“, erklärte er uns. „Ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen. Er ist in Sicherheit und wir werden ihn jetzt zur Federal Plaza bringen.“
„Nein Stefan, tut das nicht“, sagte Rudi.
„Wie bitte?“ Stefan glaubte wohl, sich verhört zu haben.
„Sobald ihr die Pension verlasst, wird Melkowski zuschlagen. Er wird nicht Treßloff töten, sondern einen von euch oder einen Passanten.“
„Es gibt hier zwei Ausgänge, Harry. Einen zur Straße, der andere zu einem Parkplatz, auf dem allerdings relativ viel Betrieb ist.“
„Ich wette, daran hat Melkowski gedacht“, meinte ich.
„In das Zimmer, in dem Treßloff untergekommen ist, kann niemand hereinschießen. Das liegt im Souterrain.“
„Dann bleibt wo ihr seid!“, beschwor Rudi unseren Kollegen.
„Welches Gebäude in der Umgebung ist hoch genug, um sowohl den Ausgang zur Straße als auch den zum Parkplatz im Auge zu behalten – das ist hier die Frage.“
„Du musst dich schnell entscheiden, Rudi. Wir sind gleich da.“
„Es gibt da eine ganze Reihe Gebäude, auf die das zutrifft, Harry. Wir können die nicht alle überprüfen! Womöglich noch mehrere Stockwerke durchforsten, ob da irgendwo eine Wohnung leersteht.“
Wir hatten den Block erreicht. Ich setzte den Dienstporsche an den Straßenrand. „Wir müssen uns in seine Lage hineinversetzen, Rudi. Sonst kommen wir nicht weiter!“
„Was glaubst du denn, was ich die ganze Zeit tue?“
Ich stellte den Motor ab. Rudi vergrößerte die Darstellung auf dem TFT-Bildschirm etwas. Er zeigte auf eine bestimmte Stelle. „Da im Souterrain müsste das Zimmer sein, in dem sich Treßloff jetzt befindet.“
„Die wirklich hohen Gebäude schließe ich aus, Rudi“, war ich plötzlich überzeugt. „Auch wenn sein Gewehr anderthalb Kilometer weit schießen kann, man kann dort die Fenster nicht öffnen. Das Glas zu zerschneiden oder so etwas scheidet aus. Das ist zu kompliziert. Bis jetzt ist unser Täter immer den einfachsten Weg gegangen.“
„Es muss ein Flachdach sein. Wie vor der Pizzeria“, ergänzte Rudi.
„Und ich glaube, dass Melkowski sein Opfer möglichst gut kontrollieren und beobachten will.“
„Im Souterrain nicht ganz einfach, Harry!“
„Da gibt’s sicher auch Fenster. Und selbst wenn er nicht hineinschießen kann, sieht er zumindest, ob Licht brennt.“
Rudi deutete auf ein bestimmtes Gebäude. Es lag auf der dem Hotel gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes. „Hier ist er“, legte er sich fest.
„Dann kann er allerdings nicht sehen, ob Treßloff das Hotel zur Straße hin verlässt.“
„Das braucht er nicht zu sehen, Harry.“
„Wieso das denn nicht?“
„Er geht davon aus, dass Treßloff nicht zur Straße hinausgehen wird, weil dass der Situation vor der Pizzeria gleicht. Harry, er spielt mit Treßloff wie eine Katze mit einer halbtoten Maus. Daraus zieht er seine Genugtuung – oder habe ich dich da irgendwann mal falsch verstanden.“
„Lass uns gehen.“
Wir stiegen aus. Rudi rief per Handy Verstärkung. Das Gebäude, von dem wir glaubten, dass dessen Dach wie geschaffen für Frank Melkowski war, hatte vier Stockwerke und war damit für Berliner Verhältnisse ziemlich niedrig.
Im Erdgeschoss war ein Supermarkt untergebracht. In den darüberliegenden Stockwerken befanden sich Wohnungen und Büros. Über Feuerleitern konnte man auf das Dach gelangen. Und eine davon war kürzlich offenbar benutzt worden. Jemand hatte das unterste Treppenstück heruntergezogen, sodass man aufsteigen konnte.
Wir zogen die Dienstwaffen und stiegen hinauf.
Oben angekommen sahen wir einen Mann im Kiesbett liegen. Er hielt ein Gewehr in der Hand und sah durch das Zielfernrohr. Eine Tasche für Golfschläger lag neben ihm. Den Schirm seiner Baseballmütze hatte er nach hinten gedreht, damit er ihn nicht behinderte.
Er drehte den Kopf und ungläubiges Staunen breitete sich in seinem Gesicht aus.
Melkowski riss das Gewehr herum und feuerte sofort.
Glücklicherweise ein ziemlich überhasteter Schuss. Die Kugel zischte dicht an mir vorbei. Ich drückte nur einen Sekundenbruchteil später ab und traf ihn an der Schulter. Der zweite Schuss, der sich aus Melkowskis Waffe löste, war daher völlig verrissen. Er stöhnte auf und wurde durch die Wucht des Projektils noch herumgerissen.
„BKA! Keine Bewegung!“, rief ich. „Herr Frank Melkowski, Sie sind verhaftet! Die Waffe sofort fallenlassen!“
Er wirkte wie erstarrt. In seinem Parka hatte mein Projektil ein Loch gerissen. Blut sickerte aus seiner Schulterwunde hervor. Für ein Moment wirkte Frank Melkowski unschlüssig, ob er nicht doch seine Waffe noch einmal hochreißen und abdrücken sollte, aber dann ließ er sie sinken.
„Fallenlassen!“, forderte Rudi ihn noch einmal auf.
Er gehorchte. Wenig später nahm ich die Waffe an mich. Eine echte Weitz MXW-234 – die wahrscheinlich beste Scharfschützenwaffe der Welt.
„Sie sind verhaftet, Herr Melkowski“, belehrte ich ihn. Rudi rief unterdessen Stefan an. „Entwarnung, Stefan. Wir haben den Killer“, erklärte er, während in der Ferne bereits Sirenen zu hören waren.
Das musste unsere Verstärkung sein.
*
Der Rettungsdienst brachte Frank Melkowski gleich in die Gefängnisklinik auf Rikers Island. Dort würde er nach seiner Genesung auch gleich bleiben, denn ihn erwartete eine Anklage wegen mehrfachen Mordes. Dass man ihn auf Kaution auf freien Fuß setzte, war ausgeschlossen – nicht nur wegen der Schwere seiner Verbrechen und der latenten Fluchtgefahr, sondern auch, weil er eine Bewährung laufen hatte.
An den folgenden Tagen ergab sich dann durch die Aussagen von Ludwig Treßloff alias Hans-Georg Moldanow, dass Melkowski sogar noch ein weiterer Mord anzulasten war, von dem wir bislang gar keine Kenntnis gehabt hatten.
„Ich wusste nicht mehr, wem ich noch trauen konnte“, sagte Treßloff, als wir ihm in einem der Verhörräume im Präsidium gegenübersaßen. „Ich habe mich deshalb mit Hanns-Peter Ferdinand verabredet. Er war mir noch einen Gefallen schuldig. Von früher – Sie verstehen?“
„Das war aber sehr leichtsinnig“, stellte ich fest. „Man hat Ihnen doch schließlich nicht nur einfach so eine neue Identität gegeben.“
„Ja, ich weiß. Aber ich wollte einfach wissen, was los ist! Am Anfang wusste ich noch nicht einmal, wer da eigentlich hinter mir her ist und Menschen in meiner Umgebung abknallt. Das habe ich erst nach und nach begriffen.“
Hanns-Peter Ferdinand war zu der Verabredung mit Treßloff im Park nie aufgetaucht. Seine Leiche tauchte schließlich in einem Müllcontainer in einem Hinterhof auf. An der Leiche gab es Spuren zahlreicher Misshandlungen. Getötet hatte ihn aber eine Kugel aus dem Weitz-Gewehr, die im Gegensatz zu den anderen Opfern mit aufgesetztem Lauf ins Herz gefeuert worden war. Offenbar hatte Frank Melkowski einiges an Informationen aus Hanns-Peter Ferdinand herausgeholt.
Norman Weitz blieb zunächst bei der Behauptung, er hätte die Morde begangen. Erst als ihm sein Anwalt klarmachen konnte, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen ihn ohnehin einstellen würde und ihm darüber hinaus eine psychiatrische Untersuchung seines Geisteszustandes blühte, wenn er an der Behauptung weiter festhielt, schwenkte er schließlich um und bestätigte, ein Scharfschützengewehr an Frank Melkowski verkauft zu haben.
Strafbar war das allerdings nicht.
Schließlich warf ihm niemand vor, gewusst zu haben, was Melkowski mit dieser Waffe zu veranstalten beabsichtigte. Um eine Anklage wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten würde er allerdings nicht herumkommen.
Ein paar Tage später begleiteten wir Ludwig Treßloff zur Beerdigung seiner Mutter. Die alte Dame war plötzlich verstorben und wir waren kurzfristig zu Treßloffs Schutz abgestellt worden.
„Jetzt werde ich wohl zum zweiten Mal ein neues Leben beginnen“, erklärte er uns danach, als sich der Sarg längst in die Erde gesenkt und der Pfarrer seine bewegenden Worte gesprochen hatte. „Diesmal werde ich es allerdings richtig machen und etwas mehr Abstand zu meinem früheren Leben halten.“
„Das kann ich Ihnen nur dringend empfehlen“, erwiderte ich.
„Viel Glück dabei“, ergänzte Rudi.
„Ich werde es sicher brauchen“, erwiderte Treßloff mit einem verlegenen Lächeln. „Aber ich werde nicht vergessen, was Sie für mich getan haben, Kommissar Kubinke und Kommissar Meier.“
*
Ein paar Tage später bekam ich eine Nachricht von meinem Informanten im Wedding.
Farid Abu-Jamal wollte mich treffen.
Ich ließ ihm übermitteln, wann ich zu Hause sei und und auf ihn warten würde.
Ich wartete.
Ziemlich lange sogar.
Ich dachte schon, es würde nichts mehr aus der Sache.
Er klingelte schließlich an meiner Tür.
„Kubinke?”
„Bin ich.”
„Harry Kubinke? Der Kommissar?”
„Einen Zweiten gibt es nicht.”
„Der Spruch ist gut. Den muss ich mir merken.”
„Du bist Farid Abu-Jamal.”
„Das solltest du eigentlich wissen. Ich bin bei euch doch prominent. Mein ganzer Clan ist bei euch prominent.”
„Komm rein, Farid. Ich darf dich doch so nennen, oder?”
„Klar. Ich bin unkompliziert!”
Er betrat meine Wohnung und sah sich um. „Wäre mir zu eng”, meinte er dann. „Nichts für ungut.”
„Ich kann mir nicht mehr leisten.”
„Weil du für die falschen arbeitest! Deshalb.”
„Ja, kann schon sein. Zumindest, wenn man es rein finanziell betrachtet.”
„Sag ich doch!”
Ich führte ihn in mein bescheidenes Wohnzimmer. Mein Apartment ist nicht besonders groß, aber erschwinglich.
„Ich hab übrigens überprüft”, sagte er.
„Was hast du überprüft?”
„Dass hier nichts abgehört sind.”
„Aha.”
„Da gibts Technik für.”
„Ich weiß”
„Und das keine Kollegen in der Nähe sind.”
„Das hast du auch überprüft?”
„Du bist sauber, Kommissar.”
„Hast du was anderes erwartet?
„Die Menschen sind schlecht.”
Ich seufzte. „Wem sagst du das”
„Sag ich doch.”
„Und du?”
„Was?”
„Und du bist nicht schlecht?”
„Ich sorge für alle. Meine Familie. Und ich gehe in Moschee. Einmal im Jahr oder so. Öfter halte ich das Gelaber nicht aus.”
Er lachte.
Ich lachte auch.
Aber ich wusste auch, dass da noch was anderes kommen würde.
„Du könntest für mich arbeiten und besser leben”, sagte Farid. „Wenn da diese Sache zwischen uns nicht wäre. Ich nehme an, du weißt, was ich meine.”
„Deine Schwester.”
„Genau.”
„Warum sagst du nicht einfach danke und gehst?”
„Ey, was ist?”
„Deine Schwester ist explodiert, weil sie eine Pistole in der Vagina hatte. Deswegen bist du jetzt die Pflicht los, sie selbst umzubringen. Und deswegen bekommst du auch keinen Ärger mit Victor.”
„Victor? Welcher Victor?”
„Der Victor, der dir den Stoff aus Usbekistan liefert. Der Victor, dem die Bordelle gehören.”
Sein Gesicht verfinsterte sich. „Ey, Kommissar, sag nichts gegen meine Schwester, dass sie eine Schlampe war oder so. Hast du verstanden?”
„Ich habe nur die Wahrheit gesagt.”
„Scheiße, Mann...”
„Warum so empfindlich? Was soll ich denn sagen? Du hast einen Killer auf mich angesetzt und mich vor der Anarcho-Kneipe mit dem Sowjet-Stern um ein Haar erledigen lassen. Bin ich deswegen übertrieben sauer?”
„Du verdammter Hurensohn...”
„Über deine Schwester habe ich nur das gesagt, was jeder gewusst hat. Du auch.”
Jetzt veränderte sich sein Gesicht.
Es wurde starr. Und eisig. Er sah aus wie eine Raubkatze vor dem Beutesprung, so angespannt war er. Er riss eine Waffe mit Schalldämpfer unter der Jacke hervor. Ich hatte die Beule vorher schon bemerkt. Für so etwas habe ich einen Blick.
Er feuerte.
Aus weniger als zwei Metern bekam ich die Kugel in die Brust. Die Wucht des Geschosses riss mich zurück und schleuderte mich gegen die Wand. Unter der Kleidung trug ich eine Kevlar-Weste. schließlich hatte ich mich auf diese Begegnung vorbereitet.
Bevor Farid den zweiten Schuss abgeben konnte, hatte ich meine eigene Waffe herausgerissen und abgefeuert.
Ohne Schalldämpfer.
Der Knall war in dem kleinen Apartment geradezu ohrenbetäubend und für sich genommen schon eine Körperverletzung.
Mein Schuss traf Farid in den Kopf.
Er schlug der Länge nach hin und blieb reglos liegen.
Ich brauchte einige Zeit, um erstmal wieder zu Atem zu kommen. Der Treffer, den ich auf die Kevlar-Weste unter meiner Kleidung bekommen hatte, wirkte wie ein sehr heftiger Fußtritt. Das dichte Kevlar-Gewebe verhinderte, dass die Kugel in den Körper drang, aber ihre kinetische Energie blieb natürlich erhalten.
Ich hoffte nur, dass ich mir nicht die Rippen gebrochen hatte.
Jemand klopfte an der Tür.
„Alles in Ordnung bei Ihnen?”
Das war der Nachbar.
„Alles in Ordnung”, sagte ich. Dann griff ich zu meinem Smartphone, um die Kollegen zu rufen.
––––––––
ENDE
ENDE