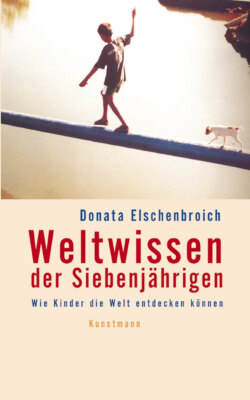Читать книгу Weltwissen der Siebenjährigen - Donata Elschenbroich - Страница 5
Die Eltern
ОглавлениеWas sollte ein Kind in den ersten sieben Lebensjahren erfahren haben, können, wissen?
Wer fragt so? Eltern. Auch für Eltern sind Kinder eine Botschaft des Möglichen.
Das ist nicht nur Verheißung, das ist beunruhigend. Hat dieses Kind, was es braucht? Wenn ein kleiner Abstandsschritt zum Alltag mit einem Kind möglich ist, fragen sich das alle Eltern, irgendwann nach den ersten Jahren. Anfangs war man noch damit beschäftigt, das Kind kennenzulernen, seinen Rhythmus, sein Temperament. Und das Kind war vollauf beschäftigt mit seinem mitgebrachten Programm, seinen frühen ontogenetischen Entwicklungsaufgaben. Jede, kaum bewältigt, löste schon die nächste Aufgabe aus: Fixieren, Greifen, Sitzen, Beißen, Laufen…
Aber dann, je weiter das Kind in der Sprache vordringt, weitet sich der Horizont atemberaubend schnell, und die Möglichkeiten und Alternativen der Anregung vervielfältigen sich. Was wir nicht tun, ist das eine Unterlassung, ist das Vernachlässigung? Was wir nicht anregen, wird das brachliegen? Dabei sein, im Weg sein, umgehen mit allem, was zur Hand war, so war das Kind unterwegs zur Welt, es hatte Stoff, ganz offensichtlich. Aber reicht das für die Zukunft?
Keine Mutter, kein Vater, die nicht insgeheim mehr von sich erwarten. Mehr wovon? Das Gleiche wie in der eigenen Kindheit kann es nicht sein. Wie machen es andere Eltern? Was sagen die Fachleute? Was braucht dieses Kind? Auf einmal beginnt die Zeit knapp zu werden. In den ersten Monaten und Jahren konnte es den Eltern oft nicht schnell genug gehen – bis der Nachtschlaf wieder ungestörter wurde, bis das Kind von sich aus gern einmal in einem anderen Haus übernachtete. Nun läuft die Zeit davon. In Gedanken überschlägt man die restliche Kindheit: wieviel Jahre noch, bevor die Schule beginnt? Sollen das zwei, drei Jahre Spielparadies sein, soll man das Kind schützen vor Ansprüchen, es »in Ruhe« lassen? Aber die Zweitsprache, die jemand in dieser Familie spricht – wenn sie dem Kind je zu einer zweiten Muttersprache werden soll, dann müsste man sie jetzt einführen. Von »Entwicklungsfenstern« hat man gelesen, von optimalen Zeitpunkten für den Erwerb kognitiver Grundfähigkeiten, den mathematischen, sprachlichen, musikalischen. Wird sich mit jeder Kerze auf der Geburtstagstorte ein Entwicklungsfenster schließen? Macht man es sich zu leicht, was hat man übersehen? Die vierjährige Cousine in England unterschreibt schon auf der Postkarte mit ihrem Namen und einem Gruß…
Eltern, nicht anders als Tiere bei der Aufzucht, sondieren das Terrain, in das sie die Jungen schicken. Sie umkreisen es in Gedanken, konzentrisch, wie der Vogel das Nest umflattert. Wo sind heutzutage die nahrhaften Weideplätze, wann ist der ungefährlichste Zeitpunkt für den nächsten Entwicklungsschritt nach draußen? Auf Probegängen erkunden Eltern diesen nächsten Weltausschnitt, den der russische Entwicklungspsychologe Lev Vygotsky die zone of proximal development nannte.
Zugleich wissen wir, dass, anders als Spatzen oder Kängurubabys, der Nesthocker Mensch bei seinem Aufwachsen keinem verlässlichen genetischen Programm folgen kann. Zur Überlebensfähigkeit und zum Glück des Menschen gehört seine Entscheidungsfähigkeit, die Freiheit zu wählen und Nein zu sagen. Nur die eigenen Fragen, nur die eigenen Lösungen des Kindes machen es zu einem Zeitgenossen, zu einem menschlichen Weltwissenden. Ausgesetzt auf der Datenautobahn geht das Kind ein. Wissen ist immer persönliches und soziales, subjektgebundenes Wissen.
Diese gattungsspezifische, diese zeitgenössische Entwicklungsaufgabe begriffen zu haben, heißt alles für das Kind Geplante mit einem Vorbehalt versehen. Ein pädagogisches Zögern, die Skepsis gegenüber Belehrung und Verschulung, ein leise ironisches Verhältnis zur Pädagogik überhaupt, das ist ein Erbe des 20. Jahrhunderts, des »Jahrhunderts des Kindes«. Die Traumstraßen und Irrwege des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach idealen Kindheiten haben uns auch die Erkenntnis hinterlassen, dass Kinder nicht belehrbar sind. Sie können nur selber lernen. Die Frühlese-Trainingsprogramme der 70er Jahre haben die Kinder nicht intelligenter gemacht. Zum Ende des Jahrhunderts haben viele Erwachsene die Entwertung ihres Wissens erfahren, und sie müssen zweifeln an ihrem generationalen Wissensvorsprung. »Er sah, daß sein Kind ihm in vielem voraus war. Und er war der Zeit, der Gegenwart, dafür dankbar«, heißt es 1980 bei Peter Handke in der »Kindergeschichte«.3
Zwanzig Jahre später bemühen sich in einem Vortragssaal fünf Erwachsene vergeblich, einen Video-Beamer in Gang zu setzen. Hilfesuchend: »Ist hier vielleicht irgendwo ein Kind?«
Wie wird man solche Erkenntnisse integrieren bei der Unterstützung im Aufbau von Welt-Wissen? Im Kind die Kraft zu bestärken, sein eigener Lehrer zu sein, darum geht es. Wieviel Überlegung, Zeit, Energie fordert das jungen Erwachsenen ab, die selbst mit ihren Neuanfängen, ihrem eigenen Verlernen und Lernen zu tun haben!