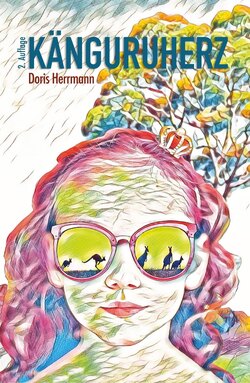Читать книгу Känguruherz - Doris Herrmann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDora
Wunderbare Berührungen
Ich war 15 Jahre alt, und mein Verlangen ein Känguru zu berühren, einen direkten physischen Kontakt mit einem dieser Tiere herzustellen, wuchs von Tag zu Tag. Doch noch gab es unüberwindbare Hemmungen, die mich daran hinderten. Die Gründe hierfür lagen in den unendlich tiefen Empfindungen, die diese Tiere in mir hervorriefen. Keine andere Tierart vermochte dies. Immer, wenn ich im Basler Zoo die Kängurus besuchte, wurde mein gesamter Körper von einem Zittern übermannt, das so stark war, dass ich es kaum beherrschen konnte. Es war ein sowohl seltsames als auch unheimliches Phänomen, da es wie etwas Fremdes über mich kam und mich seelisch quälte. Einige Male beklagte ich mich darüber bei meiner Mama, worauf sie mich aufzumuntern suchte, indem sie scherzte, dies gehöre nun mal zu einer echten Känguruliebe! Bei anderer Gelegenheit versuchte sie mich so zu trösten: „Die Rosen, die man liebt, haben auch Dornen!“
Meine Hemmung währte so lange, bis ich eines Tages im Zoo auf eine Schulklasse traf. Die Kinder hockten in Scharen vor dem Gitter der Kängurustallungen und streichelten einige der zutraulichsten Tiere. Dieser Anblick übte einen unwiderstehlichen Reiz auf mich aus, und so drängte ich mich nach vorne und fuhr mit zitternder Hand über eines der Felle. Ein beseligendes Gefühl durchströmte mich, und voller Staunen bemerkte ich, wie herrlich weich dieses Fell war, weicher sogar als das einer Katze! Es war eben jener körperliche Kontakt, der meine übergrosse Erregung dämpfte und mein Zittern im Laufe der folgenden Monate ganz verschwinden liess.
Es war eines Sonntags im Antilopenhaus, das auch von einer Kängurugruppe bewohnt wurde, als ich meine Mutter bat, den Tierpfleger Glücki anzusprechen, um ihm von meiner Leidenschaft für diese Tiere zu berichten. Sie willigte ein, und wir unterhielten uns angeregt mit ihm. Dann übersetzte Mama mir, dass Glücki mich überraschen und mir eine besondere Freude machen wolle. Ahnungslos harrte ich der Dinge, die da kommen sollten. Der Tierpfleger kam mit einem zweieinhalbjährigen Känguruweibchen zu mir. Es zappelte kurz, blieb aber dann brav in den Armen Glückis. Es hatte einen hübschen Kopf und sah mich mit lieben Augen aufmerksam an. Ich betrachtete es eine Weile. Dann berührte ich es vorsichtig. Wie staunte ich, als ich erfuhr, dass dieses kleine Geschöpf bereits ein Baby in Mäusegrösse in seinem verschlossenen Beutel trug!
Wenig später begann ich meine regelmässigen Besuche bei einer stattlichen Gruppe neun grauer Riesenkängurus. Mehrmals in der Woche stand ich früh um halb sechs auf, machte mir eilig mein Frühstück, fuhr mit der Strassenbahn nach Basel und lief zum Zoo, der für Besucher bereits ab sieben geöffnet war. Eine knappe halbe Stunde bei den Kängurus reichte mir, ehe ich den zwanzigminütigen Fussmarsch zur Berufsschule antrat. Stets hatte ich Seife und Handtuch in meiner Schulmappe, um mir noch rechtzeitig vor Schulbeginn die Hände waschen zu können. Ich wollte unbedingt verhindern, dass sich im Schulzimmer ein fremdartiger, „tierischer“ Geruch verbreitete. Doch nützte dies meist wenig, da meine Kleidung all die unterschiedlichen „Düfte“ aus dem Inneren des Antilopenhauses angenommen hatte, in dem neben den Kängurus auch Giraffen, Okapis, Gnus und natürlich Antilopen untergebracht waren. Im Winter, wenn der Zoo erst um acht Uhr geöffnet wurde, opferte ich meine schulfreien Stunden oder die Feiertage für diese Besuche.
Mit Glücki, der das gesamte Antilopenhaus betreute, verband mich bald ein freundschaftliches Verhältnis. Ich mochte den Blick seiner lieben, schalkhaften Augen und sein herzerwärmendes Lächeln. Wir diskutierten eifrig in Lautsprache oder schriftlich über Fragen der Känguruhaltung. Was ich dabei über diese Tiere lernte, schrieb ich in ein sorgsam gehütetes Oktavheft. Hier ein Ausschnitt, mitsamt den Fehlern des Originals:
„Ich ging zum Känguru und brachte dem Wärter Rübli. Ich habe zu Hause Rübli gewaschen, geschält und fein geschnitten, damit es dem Känguru auch gut schmeckt. Es soll kein Schmutz darin sein wegen Würmern in Darm. Ein Okapi war letztes Jahr gestorben wegen Würmern im Darm.“
Ich litt unter der Wahnvorstellung, aufgrund eigenen Verschuldens den Basler Zoo eines Tages ohne Kängurus vorzufinden…
Jedes Mal nahm Glücki meine Gaben freundlich, aber nicht ohne verstecktes Schmunzeln entgegen und verteilte sie an die Kängurus. Es war strikt verboten, die Tiere zu füttern. Doch wenn keine anderen Besucher zugegen waren, überliess mir Glücki Bananen- oder Apfelstücke und sogar Zwiebeln, die ich den Tieren geben durfte. Dass sie auch Zwiebeln mochten, fand ich mehr als erstaunlich. Fortan entnahm ich unserer Küche zu Hause jeweils ein paar Zwiebeln oder kaufte sie gleich pfundweise. Aber bald schon bemerkte ich, dass sich auch mit leeren Händen eine Beziehung zu den Kängurus aufbauen liess.
An einem Sonntag wollte ich meinem Papa die Zutraulichkeit „meiner“ Kängurus demonstrieren, indem ich meine Hand durchs Gitter streckte und sie rief. Sie kamen! Erwartungsvoll drehte ich mich zu meinem Vater um. Doch zu meiner grossen Enttäuschung krümmte er sich vor Lachen und meinte nur, keines der Tiere komme wirklich meinetwegen! Ja, er blieb noch lange skeptisch und vertrat die Ansicht, die Begegnungen zwischen mir und den Kängurus seien rein vom Zufall bestimmt, ganz anders als die zwischen Herrchen und Hund! Doch ich verteidigte mich und betonte immer wieder, zwischen mir und den Kängurus bestehe wirklich eine innere Beziehung. Schlussendlich musste auch mein Papa einsehen, dass ich Recht hatte.
Es war nach einem meiner Zoobesuche, als ich daheim beim Essen ganz beseelt von dem mir allerliebsten, noch namenlosen Weibchen erzählte, das ich als erstes hatte streicheln dürfen. Nun bat ich alle, mir bei der Suche nach einem passenden Namen zu helfen. „Doris“! rief Mama heiter. – Ein Känguru mit meinem Namen? – Nein, diese völlige Übereinstimmung gefiel mir nicht. Doch eine Nähe zwischen uns sollte der Name schon ausdrücken, und so taufte ich das Weibchen „Dora“.
Zwischen Dora und mir entwickelte sich bald eine festere Beziehung. Die körperlichen Kontakte wurden zahlreicher. Ich streichelte sie, und sie beschnupperte meine Hände. Manchmal betrachteten wir uns auch nur. Von allen Kängurus war Dora wohl das einzige, das im Laufe der Zeit sehr anhänglich wurde, wohingegen die andern sich mir gegenüber zumeist neutral verhielten. Doras auffällige Merkmale waren Kerben an beiden Ohrmuscheln. Glücki erklärte mir, dass dies aus ihrer Kindheit im Beutel herrühre, als ihre Ohren vermutlich von einem älteren Geschwister angeknabbert wurden, das seine Schnauze in den Beutel steckte um zu trinken.
Bald schon konnte ich alle Kängurus mühelos voneinander unterscheiden. Umgekehrt schien auch Dora mich nun gut zu kennen, denn fast immer kam sie direkt auf mich zu, sobald ich mich dem Gehege näherte.
Papa beharrte weiterhin auf seiner Meinung, dass Hunde leichter auf Zuruf oder Befehl folgten als Kängurus. Er blieb auch stur dabei, wenn ich stolz am Familientisch von meiner grossen Vertrautheit mit Dora berichtete. Wir hatten daheim einen grossen, schwarzen Schäferhund, den Papa vergeblich zu erziehen versucht hatte. Beim Essen bettelte er und war auch sonst recht undiszipliniert. Immer wieder musste ich ihn mit wilden Gesten und viel Geschrei zurechtweisen. Papa quittierte dies einmal, halb im Spass, halb im Ernst, mit der Bemerkung, er wolle mit mir in den Zoo gehen und genauso mit Dora verfahren wie ich mit seinem Hund. Zuerst erschrak ich ein wenig, stimmte dann aber in sein Lachen mit ein. Im Grunde aber war mir sehr wohl bewusst, welch gutes und treues Verhältnis sich zwischen Dora und mir angebahnt hatte.
Mitten unter Kängurus
Mein nächster sehnlicher Wunsch war, mich selber einmal unter den Kängurus zu bewegen. Von Professor Hediger, dem Direktor des Basler Zoos, erhielt ich die besondere Erlaubnis, die Innen- und Aussengehege zu betreten. Kaum hatte mich Tierpfleger Glücki zum ersten Mal hineingelassen, stand bereits meine liebe Dora vor mir und versuchte, mit ihren Vorderpfoten Halt an meiner Schulter zu finden!
Vor allem der Geruch von Stoff und Leder wirkte auf Dora sehr anziehend und animierend. Immer wieder beschnupperte sie meine Kleidung oder knabberte an ihr. Wenn wir, wie so oft, Bauch an Bauch geschmiegt beieinander standen, pflegte sie mich auf spielerisch-zärtliche Weise zu kratzen. Keines der andern Kängurus interessierte sich auch nur annähernd so für mich. Doch auch sie hatten ihre besonderen Vorlieben, was mein Äusseres betraf. So konnte es passieren, dass sie es alle plötzlich einzig auf meine Schuhe abgesehen hatten. Ohne mich weiter zu beachten, beknabberten sie dann das offenbar gut riechende Leder, so dass ich Mühe hatte, meine Füsse frei zu bewegen. Manchmal fasste ich eins der Kängurus unter den Achseln und hob es hoch, bis sein Kopf auf meiner Augenhöhe war. Doch meist half dies nicht. Der erhoffte Augenkontakt blieb aus, was mich stets aufs Neue enttäuschte, da mir so die Beziehung zwischen Mensch und Tier weniger echt und glaubwürdig erschien. Doch trug ich selber zur Ursache dieses von mir als Mangel empfundenen Umstandes bei, denn wie ich später bemerkte, hatte ich oft den Fehler gemacht, ganz aufgerichtet zu stehen oder umher zu gehen. Schliesslich bewegte ich mich leicht gebückt, um von der Grösse in etwa einem halbaufrecht stehenden Känguru zu entsprechen. Die gleiche Nasen-Schnauzenhöhe mit ihnen und damit den erwünschten Augenkontakt erreichte ich, indem ich meine Beine stark anwinkelte oder ein Knie auf den Boden setzte und mich so noch kleiner machte. Hatte ich meine Position dann inne, hielt ich mich zunächst meist zurück und streichelte keins der Tiere. Nach einer „Anstandspause“ liessen sich die Tiere aber gerne an den für sie selber unerreichbaren Stellen, wie Nacken und Hinterkopf, kraulen, da dies ihrer Körperpflege diente. Auch gelang es mir, meine normalen Laufschritte so ihrem Hüpfen anzupassen, dass sie schon bald von meiner Anwesenheit kaum noch Notiz nahmen, sondern in mir den „Artgenossen“ sahen. Das Leben in der Gruppe verlief nun völlig normal und ungestört, ganz so, als sei ich überhaupt nicht anwesend. Die Tiere frassen, kümmerten sich um ihre Körperpflege, ab und an trugen die Männchen ihre Kämpfe miteinander aus. Dies waren ideale Bedingungen für die Beobachtungen, die ich mir vorgenommen hatte.
Alles ging gut, bis mir unwissentlich ein gravierender Fehler unterlief, der sämtliche Kängurus in Aufruhr versetzte. Zu jener Zeit war ich im Umgang mit diesen Tieren noch zu unerfahren und hatte daher die Anzeichen der beginnenden Paarung nicht bemerkt.
So schritt ich eines Tages in leicht gebeugter Haltung um die Gruppe liegender Kängurus herum zu Dora. Da plötzlich sprangen alle wie vom Blitz getroffen auf! Ein junges, gerade ausgewachsenes Männchen kam auf mich zu und schlug mir mit beiden Vorderpfoten heftig ins Gesicht. Eiligst hob ich meine heruntergefallene Brille auf und rannte aus dem Gehege, noch ehe mir Glücki zu Hilfe eilen konnte.
Nach gut einem Jahr hatten meine regelmässigen Besuche im Gehege so ein jähes Ende gefunden. Wenige Wochen nach dem Vorfall wurden die Kängurumännchen wegen jahrelang ausgebliebener Zuchterfolge gegen andere ausgetauscht. Doch die neuen Böcke waren selbst für die erfahrenen Tierpfleger des Basler Zoos nicht ganz ungefählich.
Beutelwäsche
„…ob die Kängurumütter das Kind im Innern ihres Beutels sauber waschen können. Ich habe es noch nie zuvor gesehen und beobachte es heute, am 16. Februar 1950, zum ersten Mal. Ich werde es nie vergessn… Ich war sehr schweigsam und erzählte nicht gerne davon, wie die Kängurumütter ihr Kind im Beutel leckten.“
Tief berührt schrieb ich diese Sätze in mein Oktavheft. Es war das erste Erlebnis dieser Art, das mich fesselte und eine starke Emotion in mir auslöste, die erst nach weiteren Beobachtungen etwas nachliess. Es war das Gefühl, Zeuge eines elementaren Vorgangs geworden zu sein. Da ich schon zuvor auf dem Bauernhof oder in Filmen gesehen hatte, wie junge Katzen und Huftiere von ihren Müttern sauber geleckt wurden, beschäftigte mich stets die Frage, ob und wie die Kängurumütter sich ebenfalls um die Sauberhaltung des Beutels samt Winzling bis zu dessen Ausstieg bemühten.
Ich beginne diese Episode mit dem 16. Februar 1950, jenem oben beschriebenen bedeutungsvollen Datum, nur wenige Wochen, nachdem ich Doras erste Mutterschaft mit ihrem noch verborgenen Baby erlebt hatte. Es war an einem föhnig warmen Wintertag, an dem die Kängurus ausnahmsweise ins Freie gelassen werden konnten. Abseits der Gruppe, nahe am Gitter reinigte Dora ausgiebig ihren Beutel samt Baby. Der ungewohnte Anblick ihres stark nach vorn gekrümmten Rumpfes löste bei mir ein heftiges Zittern aus. Im selben Augenblick begriff ich intuitiv, dass die Beutelpflege für das Junge lebenswichtig war. Heute denke ich, dass ich ohne dieses Erlebnis mit Dora vielleicht nie den Durchbruch in meiner Känguruforschung geschafft hätte.
Einen Monat später, es war bereits frühlingshaft warm, und ich freute mich schon auf das bald aus Doras Beutel herausguckende Köpfchen, als ich zu meinem grossen Schrecken bemerkte, dass ihr Beutel ganz flach und offenbar leer war! Sofort erkundigte ich mich bei Glücki, der mir betrübt erklärte, dass das Baby aus Doras Beutel gefallen sei. Nach diesem Unglück fühlte ich mich ausserordentlich niedergeschlagen und reagierte sehr heftig, ja sogar zornig, wenn Mitmenschen meinten, sich über meinen Bericht lustig machen zu müssen. Ich konnte einfach nicht verstehen, dass jemand erleichtert lachte, sobald ihm klar wurde, dass hier nicht ein Mensch, sondern „nur“ ein Tier gestorben war. Ich nahm mir fest vor, Glücki nicht weiter zum Verschwinden von Doras Baby zu befragen und das ganze als eines der Geheimnisse der Natur zu betrachten.
Einige Jahre lang getraute ich mich kaum, über die Säuberung des Beutels zu sprechen, denn ich befürchtete, die zum Teil recht drastischen Umstände bei diesem Akt könnten als unappetitlich und abstossend empfunden werden. Und doch handelte es sich dabei um eine lebenswichtige Funktion der Mutter-Kind-Beziehung.
Es war mir unbegreiflich, dass in den zoologischen oder populärwissenschaftlichen Büchern, die sich mit Kängurus befassten, fast nichts über die Beutelreinigung zu finden war. Auch gab es in Illustrierten keine Fotos von Kängurus, die Beutelpflege betrieben, sondern immer nur prächtige Bilder possierlich aufrecht sitzender Kängurumütter mit drollig aus ihren Beuteln herausschauenden Jungen. Hier wurde einem wesentlichen Punkt offenbar keine Beachtung geschenkt. Ich dachte an Topfpflanzen und ihre wunderbar farbigen Blüten. Niemand würde auf die Idee kommen, sie könnten diese hervorbringen ohne Wasser und jegliche Pflege. Oder ein kleines Menschenkind – wie könnte es heranwachsen und gedeihen, wenn es nicht gewindelt würde? Es erschien mir wirklich sehr merkwürdig, dass von der Sauberhaltung des Beutels und des Jungen in den Publikationen überhaupt keine Notiz genommen wurde. Und plötzlich witterte ich meine Chance. Mich packte der Forschungsdrang.
Dank meiner ungeregelten beruflichen Tätigkeit stand mir genügend Freizeit zur Verfügung, so dass ich mit eingehenden Beobachtungen sofort beginnen konnte, da Dora – nun bereits mehrfache Kängurumutter – und einige andere Weibchen wieder Beuteljunge trugen. Das, was ich sah, dokumentierte ich durch fotografische Bildserien.
Heute rufen meine wissenschaftlichen Veröffentlichungen schöne und aufregende Erinnerungen wieder in mir wach. Besonders stolz bin ich auf meine Aufnahmen der Bewegungsrichtungen während der Beutelreinigung, deren genauen Ablauf ich festhalten konnte. Natürlich war es mir – wie jedem anderen auch – unmöglich zu erkennen, was sich im völlig verborgenen Beutelinnern abspielt. Hier ein Zitat aus meiner Arbeit:
„Erstens ist zu beachten, dass die Kängurumütter die Beutelreinigung im Zeitpunkt der Kotabgabe des Beuteljungen vornehmen. Zweitens ist wesentlich, dass dabei – gemäss Angaben von Herrn Dr. Sharman (Australien) Darmmassage erfolgt. Da die Reinigung im Beutelinneren niemals verfolgt werden kann, muss man sich auf die Beobachtung von aussen beschränken, um Einblick in die Jungenpflege zu erhalten. Von mir beobachtete Kieferbewegungen deuten auf wirkliches Saugen und Schlecken hin, wenn das Muttertier Exkremente direkt von After- und Genitalgegend des Beuteljungen aufsaugt. Während dieses Vorgangs des Reinigens bleibt die Schnauze meistens bis zur Hälfte im Beutel. Der Rücken des Junges liegt – entsprechend seiner Grösse – fest auf dem Beutelfundus. Beim Saugen, begleitet von deutlichen Kieferbewegungen, bleibt der Kopf des Muttertiers meist ganz ruhig im Beutel versenkt, während beim Auslecken verschiedenartige Bewegungen ausgeführt werden.“
Und an anderer Stelle: „Ich habe es Dora zu danken, dass sie mir gestattete, ihre äussere Beutelwand zu betasten, um die Lage des Jungen festzustellen.“
Später dann, im australischen Freiland, gelang es mir tatsächlich auf wunderbare Weise den gesamten äusseren Beutel zu betasten, während die halbwilde Kängurumutter sein Inneres reinigte. Dabei staunte ich sehr, dass das Junge im Beutel nicht einmal zappelte oder strampelte. Es verhielt sich viel ruhiger als ein Menschenbaby während des Windelns.
Gewöhnlich liegt das Junge mit dem Rücken auf dem Beutelgrund und mit Schwanz und Hinterbeinen der mütterlichen Bauchwand zugewandt. Will es herausschauen, muss es den Kopf samt Oberkörper um 180 Grad drehen.
Die Kängurumutter reinigt ihren Beutel samt Jungem etwa dreibis fünfmal pro Tag, und zwar zwei bis acht, selten mehr als zehn Minuten lang, Pausen mit eingeschlossen. Niemals streckt sie die Vorderpfoten in den Beutel hinein, um das Junge nicht mit den Krallen zu verletzen. Vor Beginn der Reinigung krümmt sie sich nach vorne, krallt sich mit beiden Pfoten am äusseren Beutelmund fest, zieht diesen auseinander und schiebt die Schnauze dann so tief hinein, dass ihre Augen oft den Beutelrand berühren. Wenn sie die oberen und unteren Teile des Beutelinnern reinigt, sind die Kopfbewegungen des Ausleckens von aussen deutlich zu erkennen. Während der Reinigung hält die Mutter mit einer oder beiden Pfoten die äussere Beutelöffnung fest oder stützt den unteren Teil des Beutels mit den Pfoten.
Während der Reinigungspausen streckt sich das Känguruweibchen wie eine Putzfrau, deren Rücken vom langen Bücken schmerzt. Dabei gähnt sie oder beleckt gründlich ihre Vorderpfoten. Sobald das Junge mit Köpfchen, Pfoten oder Hinterfüssen und Schwanzspitze herausschaut, leckt die Mutter ausgiebig die nun sichtbaren geschmeidigen Körperteile.
Bliebe die Beutelreinigung aus, würde dies ohne Intervention von aussen für das Junge unausweichlich zum Tode führen. Dies bestätigte mein eigenes Forschungsergebnis: Die mich faszinierende Beutelreinigung ist nichts anderes als eine Stoffwechselfunktion, nämlich die Beseitigung des vom Jungen abgegebenen Kots und Harns.
Zum Schluss noch eins meiner schönsten Erinnerungsbilder: Dora liegt in der wärmenden Sonne. Das Kleine schaut aus dem Beutel und streckt der Mutter die Schnauze entgegen, worauf diese sich leicht zu ihm hinabbeugt, mit ihm Mundkontakt aufnimmt und, es zärtlich berührend, mit ihm den Atem austauscht…
Überraschungen
Kann man ein Känguru beim Namen herbeirufen? Normalerweise nicht. Es ist ja kein Hund, hierin hatte mein Papa Recht. Ein Känguru reagiert auf andere akustische Signale. So gebrauchte ich bei Dora zum Beispiel den Ruf „Hallo, da bin ich!“ oder „Haha“ oder oft auch nur Summtöne. Dies genügte bereits, dass sich sowohl bei Dora als auch den anderen Kängurus die Ohrmuscheln deutlich nach vorn, in meine Richtung drehten. Doch blieb bei den übrigen Tieren eine Folgereaktion praktisch aus. Trudi zum Beispiel bewegte sich selbst auf mehrmaligen Anruf hin überhaupt nicht, obwohl sie nur wenige Meter vom Gitter des Aussengeheges und damit von meiner Position entfernt stand.
Dora dagegen verhielt sich völlig anders. Sie war zu jener Zeit eine kräftige, imposante Kängurufrau, die die Herrschaft über ihre Gruppe innehatte. Überraschenderweise war sie stets die einzige, die verblüffend prompt meinem Ruf folgte, sogar wenn dieser aus einer Entfernung von mehr als fünf Metern erfolgte. Häufig brauchte ich sie aber gar nicht erst zu rufen. Sobald sie meiner gewahr wurde, kam sie sofort auf mich zu, als erkenne sie mich.
Einmal ereignete sich etwas völlig Unerwartetes. Es war in einem kalten Winter, als ich das Antilopenhaus betrat. Vor dem Gitter hatte sich eine so dichte Menschentraube gebildet, dass mir nur eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Kängurus blieb. Doch bald schon hatte Dora ihren aufmerksamen Blick auf mich fixiert. Aufgeregt bat ich einige Leute, etwas beiseite zu treten, um ans Gitter zu gelangen. Wie überrascht und entzückt war ich, als Dora mir schnurstracks entgegen kam! Wie hatte sie mein Gesicht unter den vielen anderen so rasch identifiziert? Oder war es nicht nur das Gesicht, das ihr als Merkmal diente? Jedenfalls war keines der anderen Kängurus dazu willens oder in der Lage. Doras Fähigkeiten gingen aber noch weiter. So vermochte sie mich im Aussengehege selbst aus einer Entfernung von zehn bis zwanzig Metern unter den Zoobesuchern zu erkennen, um dann meine Bewegungen auf dem Besucherweg genau zu verfolgen!
Mir lag sehr viel daran mich zu vergewissern, dass Dora nicht nur wegen jener „Liebe, die durch den Magen geht“ so anhänglich war. Deshalb hatte ich selten Futter für sie dabei. Ich stellte fest, dass Dora kam, wenn sie wollte. Denn manchmal kam sie auch nicht, auch wenn sie in meinen Händen leckere Bananenstückchen entdeckte. Zweifellos war bei ihr ein echtes Bedürfnis nach einem persönlichen Kontakt mit mir vorhanden.
Während des Fressens oder der Körperpflege war es mir dagegen niemals möglich, Dora zu mir zu locken, desgleichen wenn sie ruhte oder sich der mütterlichen Fürsorge widmete. Doch war es völlig normal, dass sie sich bei ihren natürlichen Aktivitäten nicht stören liess. Dennoch schien Dora meine Anwesenheit genau zu registrieren, was sich daran zeigte, dass sie mich nach Beendigung ihrer „Pflichten“ aufsuchte. Auch machte sie stets eine „Extrakurve“, um bei mir vorbeizukommen, sobald sie sich vom Futtertrog zum Strohlager oder in umgekehrter Richtung bewegte. Lagen Hindernisse auf diesem Weg, etwa dicke Zweige, so kam sie um diese herum zu mir. Selbst die Anwesenheit vieler anderer Tiere zwischen uns hinderte Dora nicht, sich bis zu mir durch zu drängeln!
Mein allerschönstes Erlebnis mit ihr habe ich in einem Protokoll festgehalten:
„Einmal stand Dora im Stall gut vier Meter von mir entfernt, den Rücken mir zugewandt, putzte sich und schaute zwischendurch über ihre Schulter zu mir. Ich glaubte, es würde eine Weile dauern, bis sie zu mir käme. Also schaute ich in eine andere Richtung. Plötzlich spürte ich eine Berührung an meinem Rücken. Erschrocken fuhr ich zusammen und sah mich um. Da stand Dora, die sich mir unbemerkt genähert hatte und mich mit der Schnauzenspitze stupste!“
Es war für mich wunderbar zu erleben, wie Dora in den Jahren 1963/64 ihr letztgeborenes Junges aufzog: Fast jedes Mal nach der Beutelreinigung kam sie zu mir, ohne dass ich sie rief!
Meine „Unterhaltungen“ mit Dora dauerten im allgemeinen zwischen zehn und zwanzig Minuten. „Zeremonieller“ Höhepunkt unserer Begrüssung war der Nasenkontakt, bei dem wir eine Zeitlang unseren Atem austauschten. Dies entspricht genau dem känguruspezifischen Verhalten, nur dass bei ihnen die Geruchserkennung einer umfassenden informativen Vergewisserung dient, wie zum Beispiel bei der Bewältigung von Konflikten. Für mich dagegen bedeutete dieser intime und würdevolle Akt der Annäherung eine Bestätigung meiner starken seelischen Bindung an diese Wesen, die wir Kängurus nennen. Im übrigen erlaubte mir Dora nicht nur das Streicheln ihres Körpers, sondern auch das Befühlen des leeren Beutelinneren. So lernte ich dessen innere Form und Temperatur kennen.*
Was das Streicheln oder Kraulen betraf, so war Dora durchaus anspruchsvoll. Unterbrach ich es auch nur für Sekunden, suchte Dora meine Hände und stupste sie an, um mich zum Weitermachen zu animieren.
Nachdem ich wegen der Gefahren, die von den neuen angriffslustigen Männchen ausgingen, gut fünfzehn Jahre auf das Betreten des Kängurugeheges hatte verzichten müssen, wuchs in mir das brennende Verlangen, meine Beziehung zu Dora ohne ein trennendes Gitter zu erneuern. Nach Abklärungen mit Professor Lang, der nun Zoodirektor in Basel war, durfte ich es dann endlich wagen. Doch auf mich wartete eine gewaltige Enttäuschung! Dora verhielt sich mir gegenüber innerhalb des Geheges als kenne sie mich nicht mehr. Nicht einen einzigen Schritt tat sie in meine Richtung. Ich schien ihr fremd. Doch nachdem ich mich wieder vor das Gitter begeben hatte, kehrte etwas von unserer ursprünglichen Vertrautheit zurück. Ich hatte den Eindruck, als fühle sich Dora mir nur dann nahe, wenn uns die Absperrung voneinander trennte. Es ist möglich, dass sie unsere früheren „gitterlosen“ Begegnungen einfach vergessen hatte.
Eine wohltuende Abkühlung
Einmal erlebte ich etwas sehr Seltsames, ausgelöst durch das Bedürfnis der Kängurus nach Abkühlung. Es ist eine Eigenart dieser Tiere, sich die Vorderarme und Unterschenkel, manchmal auch die untere Bauchseite, einzuspeicheln. Dies dient der Abkühlung bei grosser Hitze, starker Erregung zur Paarungszeit und bei Konflikten. Es ist klar zu unterscheiden zwischen Körperpflege und Abkühlung. Bei ersterer wird das Fell mit den Zähnen „gekämmt“, beziehungsweise beknabbert, im zweiten Fall werden die Gliedmassen mit oder ohne Zungenbewegungen bei starkem Speichelfluss tüchtig befeuchtet.**
Es war an einem sehr heissen und schwülen Juni-Nachmittag, als etliche Tiere, von ihren Paarungsspielen erhitzt, mit dem Einspeicheln begannen. Diejenigen, die im Schatten der Bäume lagerten, beteiligten sich nicht daran. Gut eine halbe Stunde später, nachdem alle wieder im Stall waren, kam Dora zu mir und trank Wasser aus einem Kübel, der am Ende des Gitters stand. Danach begrüssten wir uns per Nasenkontakt… ja, und dann fing sie an, meine rechte Hand solange zu belecken und mit Speichel zu bedecken, bis diese völlig nass war!
Beim Abendessen erzählte ich voller Stolz von diesem erstaunlichen Vertrauensbeweis, worauf mein Papa mich fröhlich fragte, ob ich nicht lieber meine Arme in der Badewanne unter den Wasserhahn halten wolle…
Noch heute geht mir die Frage nach, wieso Dora mich damals „abkühlte.“ War es ein Akt der Freundschaft? Oder vielleicht sogar eine Art Gegenleistung für das Streicheln und Kraulen ihres Felles?
Bei der üblichen Körperpflege der Kängurus, hauptsächlich der zwischen Müttern und ihren halbgrossen Jungen, ist oft zu beobachten, wie sie einander das Fell beknabbern oder belecken, eine Prozedur, die zwischen erwachsenen Tieren dagegen höchst selten stattfindet. Bei all meinen Beobachtungen konnte ich aber nicht ein einziges Mal feststellen, dass ein Känguru die Gliedmassen eines Artgenossen einspeichelte.
Was Dora damals mit mir tat, war also gewiss etwas Einmaliges, und ich bin mir sicher, dass es sich dabei nicht nur um das Ablecken meines salzigen Schweisses handelte.
Abschied
Ein sommerlich warmer Tag im Jahre 1971. Strahlender Sonnenschein liess den Zoo in herrlichen Farben aufleben. Eine fröhliche Stimmung lag über allem.
Diese allgemeine Heiterkeit stand in starkem Kontrast zu meiner eigenen Stimmung. Ich war tief traurig. Vor kurzem war ich von meinem ersten Australien-Aufenthalt zurückgekehrt und hatte Dora einen Besuch abgestattet. Die Kängurus befanden sich zu der Zeit zusammen mit den Sumpfantilopen im Freien. Dora hoppelte langsam und beschwerlich direkt zu mir ans Gitter, richtete sich halb auf und betrachtete mich. Voller Sorge und Kummer bemerkte ich ihren altersbedingt schlechten Zustand. Ich streichelte sie und spürte erschreckend deutlich die Knochen unter ihrem Fell. Darauf blieben wir sehr lange beieinander stehen und blickten uns an. In jenem Augenblick spürte ich, dass dies unsere allerletzte Begegnung sein würde. Während ich sie stumm betrachtete, führte ich einen inneren Kampf gegen meine aufkeimende Furcht, nicht zu wissen, wie ich ohne sie leben sollte. Dora blieb noch lange reglos stehen, als ob sie mir sagen wollte: „Ich möchte unser langes, glückliches Verhältnis bezeugen. Dies wird unser endgültiger Abschied sein!“
Am übernächsten Tag sass Mama mit rotem Gesicht und tränenden Augen bei Tisch. Ich traute mich nicht nach dem Grund ihrer Traurigkeit zu fragen, denn ich spürte, dass sich tags zuvor etwas Entscheidendes ereignet hatte. Mama teilte mir mit, dass Dora verstorben sei. Sie war sichtlich besorgt um mich, war ihr doch klar, dass dies für mich einen schweren Verlust bedeutete. Doch ich war tapfer und versuchte meine Gedanken und Vorstellungen ein wenig damit aufzuhellen, dass Doras mit ihren 23 Jahren und 5 Monaten das Alter eines Methusalems unter den Kängurus erreicht hatte, und dass dies genügte, um ganz gewiss erlöst zu werden.
*Mehr als 30 Jahre danach modellierte ich aus dem Gedächtnis einen grossen Beutel aus Ton als Tastfigur für Blinde.
**Ist Wasser in der Nähe, bedienen sich die Tiere nicht selten auch dieser Möglichkeit.