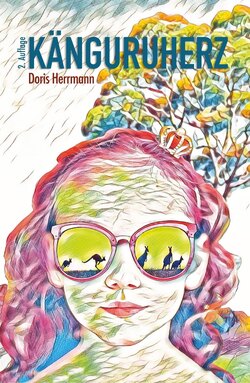Читать книгу Känguruherz - Doris Herrmann - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEin fester Entschluss
Selbststudium
Unser Garten grenzte an ein noch wildes Stück Natur mit hoch aufragenden Bäumen und efeubedecktem Boden. Mitunter liess sich ein Reh blicken. Die Vögel, ob gross oder klein, machten sich oft die Nistplätze streitig. Igel bewegten sich aus ihrem Versteck unterm Holunderstrauch über unseren Rasen. An dessen Rand floss ein Bächlein, reich und wild bewachsen von vielerlei Waldpflanzen, die ich so sehr liebte, dass ich meinen Eltern mit Erfolg verbot, ihn zu „ verschönern“. Für mich war es ein wahres Paradies, ein Ort für fesselnde Tierbeobachtungen, die ich fast jeden Tag, mal im Garten, mal vom Bett aus, mit dem Feldstecher anstellte. So schuf ich mir eine gute Basis für spätere intensive Feldbeobachtungen, zum Beispiel die der Murmeltierkolonien im Engadin oder der Gämsen beim Aletschgletscher.
Es war an einem warmen Sommertag – ich sass mit Tante beim Tee auf unserem herrlichen Sitzplatz – als sie meinte, zum Glück hätte ich nicht nur Interesse an Kängurus, sondern auch an all den anderen Tieren, die im Garten und im Wald lebten. Damit hatte sie Recht. Mein Interesse und meine Zuneigung galten der Natur in ihrer ganzen Vielfalt und beschränkten sich nicht nur auf die Kängurus, eine „Spezialisierung“, die mir allzu leicht als Spleen hätte ausgelegt werden können.
Einmal nach Feierabend kam Papa in bester Laune zu mir, um zu berichten, er habe von Onkel Fritz im Tessin erfahren, dass ein deutscher Student Kängurus im Zürcher Zoo beobachte und darüber schreibe. Endlich ein Gleichgesinnter! Genau das war es, was ich mir immer gewünscht hatte! Er hiess Karl H. Winkelsträter, kam aus dem Saarland und wurde schon wenige Jahre später Direktor des Zoologischen Gartens in Saarbrücken. Einige Monate danach begannen wir miteinander zu korrespondieren und über Kängurus zu fachsimpeln. Ausführlich berichtete er über seine fehlgeschlagenen Beobachtungen einer Kängurugeburt und über die merkwürdige Angewohnheit der Tiere, sich mitunter die Gliedmassen so ausgiebig zu lecken, bis sie völlig nass waren.
So wurde ich von einem Experten in eine Menge wichtiger Fakten, Fragestellungen und Probleme eingeweiht, was meine Wissbegier weckte. Dies führte schliesslich dazu, dass Mama mir vorwarf, ich solle mich mehr auf die Büroarbeit konzentrieren, statt stundenlang vor dem Kängurugehege im Zoo zu sitzen. Doch ich blieb hart und fest entschlossen. Erneut kam es zu Auseinandersetzungen, in denen sie mir klarzumachen versuchte, dass ich ohne ein Universitätsstudium mit meinen Bemühungen nichts würde erreichen können. Ich war ausser mir vor Wut und Verzweiflung und eilte zu Papa, der mich in seiner heiteren und humorvollen Art tröstete. Doch auch er gab mir die Mahnung mit auf den Weg, mich nicht die ganze Zeit nur mit Kängurus zu beschäftigen.
Für eine Gehörlose gab es damals keine Möglichkeit eines akademischen Studiums, ein sehr bedauerlicher, aber nicht zu beseitigender Umstand. Doch gerade dies gab meinem Willen die erforderliche Festigkeit, nach alternativen Lösungen zu suchen. Es war nicht zuletzt dem starken Ansporn Dr. Winkelsträters zu danken, dass ich den Weg eines Selbststudiums beschritt.
In meiner beruflichen Arbeit war ich keinen strengen Regeln unterworfen. Die mitunter nur stundenweise Tätigkeit als Büroangestellte im Geschäft meines Vaters liess mir ausreichend Zeit für meine Studien. Zudem erhielt ich regelmässig Unterricht von Zoologiestudenten, die von meinen Eltern honoriert wurden. Doch dieser Unterricht befriedigte mich nicht lange, und ich strebte nach einem höheren Lehrniveau.
Ich will auch nicht verhehlen, dass ich manchmal den Eindruck hatte, als Sinnesbehinderte von den Studenten bezüglich meines Lernvermögens nicht immer ganz ernst genommen zu werden.
Schon bald erreichte mich die nächste gute Nachricht von Onkel Fritz aus dem Tessin. Eine junge Zoologin hatte ihn besucht, um sich seine Wollaffenkolonie anzuschauen. Er hatte sie gebeten, mich so schnell wie möglich zu kontaktieren und zu besuchen, damit sie mit mir über die mich besonders interessierenden Gebiete der Zoologie sprechen und mich darin einführen könne. Und so kam es. Sie besuchte mich oft, und wir kommunizierten mühelos. Mit einigen Büchern über die Grundlagen der Tierpsychologie, die sie mir auslieh, spornte sie mich weiter an. Wie besessen las ich die geschenkten, erworbenen oder aus der Universitätsbibliothek entliehenen Bücher und Fachzeitschriften, wobei sich meine Lektüre keineswegs nur auf Känguru-Themen beschränkte. Mich faszinierte vor allem die Verhaltensforschung mit ihren Studien der Tierwelt, von den Einzellern über die Fische und Vögel bis hin zu den höheren Säugetieren. Hierzu las ich Arbeiten von Forschern wie dem späteren Nobelpreisträger Konrad Lorenz, N. Tinbergen, H. Hediger, A. Portmann, I. Eibl-Eibesfeldt und anderen. So schaffte ich es, nicht zuletzt dank der Hilfe von Dr. Lilly Schönholzer, so hiess die Zoologin, mir ein breit gefächertes zoologisches und ethologisches Wissen anzueignen.
Bei den wilden Rindern am Mittelmeer
Stolz über mein erweitertes Wissen, bemühten sich meine Eltern, ein geeignetes Praktikum für mich zu finden. Bald darauf erhielt ich einen Brief von Professor Lucas Hofmann, einem Basler Zoologen, der eine Forschungsstation in der Camargue nahe der Küste leitete. Er lud mich ein, dort als Volontärin zu arbeiten. So reiste ich im Juli 1958 zusammen mit Tante, die zufällig ihre Ferien in der Nähe verbringen wollte, dorthin.
Anfangs war dort vieles fremd für mich, doch ich fand mich bald zurecht, zumal es etliche deutsch- und englischsprachige Wissenschaftler und Studenten gab. Voller Begeisterung schaute ich beim Vogelberingen zu oder half selbst dabei mit, ging mit hinaus in die bezaubernde Seenlandschaft, um die eingefangenen Vögel aus den Netzen zu holen oder sie nach dem Beringen und den Untersuchungen wieder freizulassen. In derselben Forschungsstation arbeitete auch der Schweizer Zoologe Dr. R. Schloeth. Er studierte das Kampfverhalten und die Rangordnung der in riesigen eingezäunten Revieren lebenden Camargue-Rinder. Rasch fühlte ich mich von seinen interessanten Feldbeobachtungen angezogen, und bald schon kommunizierten wir in langen Gesprächen miteinander. In seinem Studierzimmer zeigte er mir Schreibblöcke voll unleserlicher Bleistiftnotizen über jedes „seiner“ Rinder, die er sehr gut auseinanderhalten konnte und von denen jedes eine Nummer hatte. Ich durfte mir verschiedene seiner Tabellen genauer ansehen. Er war es auch, der mich bei ersten praktischen Übungsarbeiten anleitete und mich „hoch zu Ross“ mitnahm, was ich als ungeübte Reiterin auch tapfer und klaglos einige Stunden ertrug. Von der erhöhten Warte eines Pferderückens aus beobachtete ich die Rinder und machte mir Notizen. Vor den imposanten Rindern hatte ich überhaupt keine Angst, auch nicht, wenn ich – was oft geschah – ganz allein im Gras sass. Eher schon fürchtete ich die Schwärme stechender Bremsen!
Über zwei Wochen lang bis zu meiner Heimreise absolvierte ich jeden Tag meine drei- bis sechsstündigen Rinderbeobachtungen. Die Zeit in der Camargue insgesamt war viel zu kurz. In meinem grossen Eifer verfasste ich ein langes Resümé, das ich an Dr. Schloeth schickte.
Bald darauf kam seine kritische Antwort. Ich müsse mehr lesen und mehr denken. Er machte mir an einem Beispiel klar, woran es meiner Arbeit mangelte. Was ich bei den Rindern bis dato für ein spielerisches Aufbocken gehalten hatte, bezog sich allein auf den Geschlechtsakt, der mir nicht hinreichend bekannt war. Ich hatte schlichtweg Aufklärungsdefizite! Folglich riet mir Dr. Schloeth, in dieser Angelegenheit eine vertrauenswürdige Person ganz offen zu fragen. Bis heute bin ich ihm dafür dankbar, denn er wies mir nicht nur bei meinen Studien den richtigen Weg, sondern machte mir auch Mut, mich mit dem Sexualverhaltens beim Tier wie auch beim Menschen ausführlich zu beschäftigen.
Australien rückt näher
Mit meinen nun erweiterten Kenntnissen, die ich zu einem Teil auch aus englischsprachigen Texten bezogen hatte, machte ich mich voller Enthusiasmus auf die Suche nach Menschen, die in Australien lebten, möglichst mit Kängurus zu tun hatten und denen die lokale Fauna und Flora vertraut war. Ich bat den Schweizerischen Bund für Naturschutz (heute Pro Natura Suisse) um Adressen entsprechender Organisationen in Australien. Spät erhielt ich ein Antwortschreiben, dem einige Zeitschriften beigefügt waren. Bei der Lektüre dieser Zeitschriften stiess ich zu meiner nicht geringen Überraschung auf die Zeile: „Doris Herrmann from Switzerland, who is very interested in kangaroos, wants to have contact with some people in Australia.“ Lachend schlug ich mit der Faust auf den Tisch. Die Eltern erschraken, doch blitzschnell schob ich ihnen die Zeitschrift zu und deutete mit dem Finger auf das Gelesene. Als sie auf meinen Namen stiessen, zeigten sie sich hocherfreut und staunten nicht schlecht, dass ich es fertig gebracht hatte, jenem so unendlich fernen Land auf diese Weise ein Stück näher zu kommen. Sie wünschten mir viel Erfolg, mahnten mich aber auch zur Geduld, falls die Antworten meiner Briefpartner länger auf sich warten liessen.
Januar 1959 in den winterlichen Bergen. Gerade war ich bei strahlendem Sonnenschein auf Skiern einen Steilhang hinab gesaust und stieg nun zu Fuss wieder nach oben, als meine Eltern mir fröhlich lachend entgegenkamen. Papa schwenkte einen Luftpostbrief. Aufgeregt nahm ich das Kuvert entgegen und las den Absender. Dann jauchzte ich auf vor Freude: Der Brief war von Geoff Giles, einem Schullehrer aus Morisset in New South Wales, dessen Namen ich jener Zeitschrift entnommen hatte, in der auch mein Name stand. Mein Gefühl sagte mir, dass er die richtige Person für den ersehnten Briefaustausch war. Unweit von Geoffs Haus, so erfuhr ich aus dem Brief, befand sich eine Psychiatrische Klinik, deren zahlreiche kleine oder grössere Pavillons über ein weites, dicht bewachsenes Gelände verstreut lagen. Die Kängurus aus dem nahen Busch betrachteten das Gelände als ihr natürliches Futterreservoir. Zudem wurden sie von den Patienten gefüttert, für die dies eine willkommene Abwechslung war. Doch diese harmonische „Symbiose“ hatte auch eine Kehrseite, da die Tiere so zu leichten Zielscheiben für Sportjäger wurden.
Durch unseren regelmässigen Briefwechsel erfuhr ich bald Näheres über Geoff und seine Familie, Tiere und Pflanzen sowie über Geoffs abenteuerliche Reisen quer durch den australischen Busch. All das ging des Nachts in meine Träume ein, und das Fernweh plagte mich mehr und mehr. So sagte ich oft zu Mama, ich wolle bald mit dem Schiff hinreisen, doch sie meinte nur, Träume seien immer schöner als die Wirklichkeit, von der ich nur enttäuscht werden könne. Aber meine Antwort war klar: „Ich reise trotzdem!“
Nach einem längeren, lebhaften Austausch von Briefen und Zeitschriften ebbte die Korrespondenz mit Geoff leider ab, da er sich aus gesundheitlichen Gründen zunehmend einschränken musste. Zwischendurch hatten sich bereits weitere Korrespondenzen angebahnt, so mit Molly O’Neill, einer aktiven Naturschützerin, die sich leidenschaftlich mit Spinnen befasste und Mrs. Beryl Graham aus Sydney. Von Jahr zu Jahr füllten sich meine Mappen mit Luftpost – so wuchs hier ein Stück Australien, das mit jedem neuen Brief für mich anschaulicher und lebendiger wurde!
Das Eis ist gebrochen!
Seit langem hatte mich ein elementarer und bei den Kängurus besonders beeindruckender Aspekt in der Mutter-Kind-Beziehung beschäftigt: das Sauberhalten des Beutels und des Beuteljungen. Ich durchsuchte die Literatur über Beuteltiere nach diesem Thema und stellte fest, dass hier eine grosse Lücke in der gesamten Känguruforschung klaffte. So begann ich 1961 mit intensiven und systematischen Beobachtungen im Basler Zoo. Nachdem ich eine hinreichende Anzahl von Protokollen erstellt hatte, fasste ich die Resultate in einem zunächst provisorischen Aufsatz zusammen, den ich an Professor Hediger, den damaligen Direktor des Zoologischen Gartens in Zürich, sandte. Meine Absicht war, diese Studie später auszuarbeiten, um sie anschliessend zu veröffentlichen. Doch das monatelange Ausbleiben einer Antwort dämpfte meine anfänglich so hochgespannten Erwartungen.
Hatte ich in der ersten Begeisterung einer Jungforscherin mir vielleicht nur eingebildet, den richtigen Einstieg gefunden zu haben? Musste ich jetzt schweren Herzens und in aller Bescheidenheit den Weg zurück in meinen Alltag antreten? Waren am Ende gar all meine Entdeckungen, die ich glaubte gemacht zu haben, bereits gemacht worden? In meinem Selbstzweifel begann ich, meine Studien für wertlos zu halten. Entmutigt liess ich einfach alles liegen, was ich an Arbeit noch vor mir hatte. Ich wusste nicht mehr ein noch aus.
Eines Abends jedoch, als ich aus dem Büro heimkam, traute ich meinen Augen kaum. Unter den vielen Kuverts war eines mit dem Signet des Zürcher Zoos! Zitternd öffnete ich es und las. In heller Aufregung rannte ich in die Küche und gab Mama den Brief. Augenblicke wurden zu Ewigkeiten – so unfassbar erschien mir dies alles, selbst dann noch, als Mama mir voller Freude und Bewunderung zurief, dass ich doch jetzt eine wertvolle Mitarbeiterin sei!
Nun endlich war das Eis bei meinen Eltern gebrochen, auch wenn ich mich hatte gedulden müssen, bis ich von professioneller Seite Anerkennung und Wertschätzung erfuhr. Ich durfte mich nun zu Recht als im Kreis der Känguruforscher aufgenommen betrachten!
Wenige Tage später fuhr ich mit Mama nach Zürich. Das sonnige Maiwetter und die frisch-grüne Landschaft entsprachen meinen aufgewühlten, gärigen, vorwärts drängenden Gefühlen. Ich sollte den Kängurubestand des Zoos selber in Augenschein nehmen und anschliessend – wie abgemacht – Professor Hediger aufsuchen. Er machte mir Mut zur Weiterführung meiner Studien. So fuhr ich mit meiner Arbeit fort, vervollständigte das Manuskript, und es gelang mir, dank der Unterstützung von Professor Lang, dem damaligen Direktor des Basler Zoos, es in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift zu veröffentlichen.
Bereits während meiner ersten regelmässigen Zoobesuche war mir bei den Kängurus ein häufiges Auftreten aussergewöhnlicher, rhythmischer Kontraktionen des Rumpfes mit anschliessenden Kaubewegungen aufgefallen. Als mir klar wurde, worum es sich handelte, eilte ich zu Professor Lang ins Büro und erklärte ihm, unter Zuhilfenahme von Papier und Bleistift, dass dieser Vorgang nichts anderes als ein unechtes Wiederkäuen darstelle! Dies war auch für ihn so erstaunlich und neu, dass er die Sache zunächst kaum glauben wollte. Doch dann forderte er mich auf, ein Manuskript zu diesem Thema abzufassen. Beide Veröffentlichungen (siehe Anhang) wurden in wissenschaftlichen Publikationen der Schweiz, Deutschlands, Australiens und anderen Ländern zitiert. Auch in „Grzimeks Tierleben“ wurde diese Art des Wiederkäuens bei Kängurus aufgenommen. Auf solch schöne Anerkennung meiner Feldstudien war ich natürlich sehr stolz!
So hatten sich die Worte meiner Mama „Forschen heisst Neues entdecken!“, die ich mir sehr zu Herzen genommen hatte, letztendlich bewahrheitet.
Über all dies berichtete ich Molly O’Neill, die mich mit einem Schreiben Professor G.B. Sharman, einem der bekanntesten Känguruforscher der CSIRO (Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation), Wildlife Division Canberra, empfahl. Ihm schickte ich meine Forschungsarbeiten. Nach einem kurzen Schriftwechsel traf ein Telegramm ein, worin es hiess, dass er nach Basel kommen werde. Für mich war es kaum zu fassen, dass dieser auf seinem Gebiet weltberühmte Mann seine allererste Europareise mit einem Abstecher nach Basel verbinden wollte!
Dann war es soweit. In der Halle seines Basler Hotels wartete ich auf ihn. Nach einer Weile kam ein einfach gekleideter Mann mit einem wettergegerbten, freundlichen Gesicht leichten Schrittes die Treppe herunter. In der Hand trug er ein Aktenköfferchen. Wir begrüssten einander und verständigten uns dann angeregt schriftlich auf Englisch. Prof. Sharman liess sich durch meine Behinderung in der mündlichen Kommunikation nicht schrecken, sondern teilte mir seine Ergebnisse der Kängurubeobachtungen geduldig und einfühlsam mit. Dann entnahm er seinem Köfferchen eine grosse Filmrolle. Beim Lesen der Aufschrift schlug mein Puls schneller: Es war der erste Film über eine Kängurugeburt. Er selber hatte ihn gedreht. (Diese Filmaufnahmen wurden einige Jahre später auf der ganzen Welt vor Fachpublikum und zuletzt auch im Fernsehen gezeigt.) Meine Vorfreude stimulierte auch meine Intuition und liess mich eine rasche Antwort auf die Frage finden, wie denn in aller Eile ein Projektor zu beschaffen sei. Wir begaben uns einfach in den Zoo, wo ich Prof. Sharman die Kängurus zeigen wollte. Bei dieser Gelegenheit suchten wir auch Prof. Lang auf, der sofort alle Hebel in Bewegung setzte und ausser meinen Eltern ein paar Professoren vom Chemischen und Zoologischen Institut zur Filmvorführung einlud.
Ich war atemlos vor Spannung. Zuerst war ein Geschlechtsakt Roter Riesenkängurus zu sehen, danach die Geburt. In seiner Grösse und Form an ein „Würmchens“ erinnernd, kam das winzige Känguru aus der Geburtsöffnung hervor, befreite sich selbst von der Nabelschnur und schlängelte sich mit Hilfe seiner vorderen Gliedmassen wie eine Eidechse am Bauch der Mutter aufwärts in den Beutel! All dies vollzog sich ohne ein Eingreifen des Muttertieres! Man konnte sehen, dass die vorderen Gliedmassen des Jungen bereits voll ausgebildet waren und kräftig bekrallte Pfötchen aufwiesen, während Hinterbeine und Schwanz noch sehr unentwickelt waren. Wie ich hinterher erfuhr, hatte Prof. Sharman die Kängurumutter ein wenig narkotisiert, um die Aufnahmen besser machen zu können.
Diese einmalige Dokumentation widerlegte auf einen Schlag alle bisherigen Annahmen einer Beförderung des Neugeborenen mittels Lippen oder Vorderpfoten der Mutter. Hier wurde für jedermann offenkundig, dass das Junge ohne jede mütterliche Hilfe, auch ohne vorbereitete Speichelbahn zwischen Geburtsöffnung und Beuteleingang, allein dank seines vollentwickelten Geruchssinnes, in den Beutel gelangt und zu den Zitzen findet. Als Papa an diesem Abend zu mir ans Bett kam und mich mit väterlichem Stolz nach meinem Befinden fragte, konnte ich nur erwidern: „Es ist so enorm viel davon in meinem Kopf.“ – „Aber Du bist nun berühmt“, sagte er. „Prof. Sharman wird auf seiner Weiterreise in die USA bestimmt über Deine neuesten Beobachtungen bei der Beutelreinigung berichten.“
An Schlaf war in dieser Nacht natürlich nicht zu denken, zu sehr ging mir dieses Filmereignis nach.
Doch mein Papa sorgte in seiner ganz persönlichen Weise dafür, dass mir das Ganze nicht zu sehr zu Kopf stieg. So bemerkte er in darauf folgenden Zeit ein paar Mal herzlich-freundschaftlich spöttelnd, ich sei nun auf der Jagd nach dem Titel „Dr. h.c. Känguru.“ – Und in der Tat, die Jagd hatte schon begonnen!
Fünf Känguruköpfe für Doris
Professor Sharman und ich korrespondierten weiterhin über unsere jeweiligen Forschungen. Ich befragte ihn zum Thema Sekretdrüsen und Markierungsverhalten der Kängurus, denn ich glaubte, diese Drüsen müssten unterhalb der Augen zu finden sein. Sharman wandte sich mit dieser Frage an Dr. Roman Mykytowycz, der sich mit den Sekretdrüsen bei Kaninchen und verschiedenen Beuteltieren befasste. Dieser hatte eine zündende Idee und offerierte mir fünf Känguruköpfe mit dem Hinweis, ich möge doch selber nach den Sekretdrüsen forschen! Zunächst erschrak ich nicht wenig, ging dann aber auf seinen Vorschlag ein. Mein Gewissen beruhigte ich damit, dass die übergrossen Kängurubestände ohnehin reduziert werden müssten, um Schäden in der Landwirtschaft zu verhüten. Auch meine Eltern und Freunde sprachen mir Mut zu. Dennoch fühlte ich mich furchtbar bedrückt. Ausgerechnet bei der Feier an Yom Kippur, dem Tag der Versöhnung (auch mit den Tieren), fragte mich Mama in der Synagoge, wann denn nun die Känguruköpfe einträfen! Ich fiel aus allen Wolken. Sofort unterband ich jedes weitere Gespräch über dieses Thema.
Aufgrund bestehender Einfuhrbestimmungen war eine Reihe von Hindernissen zu überwinden. Doch dann, nach gut zwei Monaten Schiffsreise von Australien über Bremen den Rhein hinauf, traf eine Holzkiste im Rheinhafen ein, bestimmt für das Zoologische Institut Basel „zu Händen Doris Herrmann.“ (Da es nicht erlaubt war, Sendungen mit wissenschaftlichen Materialien an eine Privatadresse zu schicken, war Prof. Adolf Portmann (1897–1982), Leiter des Instituts und bekannter Publizist, mit dieser Adresse hilfreich eingesprungen.)
Vorsichtig hob ich die Gefässe mit den in Formalin konservierten Känguruköpfen – sämtlich ohne Hälse, mit halb geöffneten Augen – eines nach dem anderen aus der Kiste. Dieser Anblick ergriff mich zutiefst. Mir war, als schauten mich alle diese Köpfe mahnend an…
Jedes Gefäss hatte ein Etikett, auf dem die Daten des zu dem Kopf gehörenden Tieres vermerkt worden waren. Ich riss mich zusammen, bemühte mich tapfer zu sein und übertrug die Angaben in eine von mir vorbereitete Tabelle: Herkunftsgebiet, Geschlecht, Körpergewicht des Tieres und anderes mehr. Spontan und bereitwillig halfen mir die Zoologen und Studenten beim Präparieren der Hautgewebe für die mikroskopischen Untersuchungen. Doch all unsere Bemühungen förderten keine Sekretdrüsen zutage! Meine Enttäuschung über das negative Ergebnis hielt sich in Grenzen, hatte ich es doch dieser irrigen Vermutung zu verdanken, dass ich von nun an in festem Kontakt mit Dr. Mykytowycz blieb, den ich von nun an vertraulich „Myky“ nannte.
Noch immer kein grünes Licht für das grosse Abenteuer
Monate später kündigte Myky ganz unerwartet an, mit seiner Frau anlässlich einer Europareise in Basel vorbeizukommen! Ich fühlte mich ausserordentlich geehrt. Beim gemeinsamen Mittagessen mit den Mykytowyczs eröffnete ich meinen Eltern und Verwandten meine Absicht, nach Australien zu gehen, um mir irgendwo im Busch oder an der CSIRO-Forschungsstation eine Arbeit in der Känguruforschung zu suchen. Bei meinen Worten wurde Myky nachdenklich. Dann aber hellte sich sein Gesicht auf, und er versuchte mir klar zu machen, dass es nirgends so schön sei wie in „Switzerland“. Scherzhaft meinte er, es wäre sicher weniger risikoreich und kostspielig, wenn ich hier bliebe und das Leben der Flöhe unter dem Mikroskop erforschte.
Doch dann begann er, von einem einsamen Ferienort an der australischen Ostküste zu schwärmen, wo man sich ungehindert zwischen halbzahmen, frei lebenden Kängurus bewegen könne. Der Name dieses Ortes war Pebbly Beach. „Wäre das nicht eine Möglichkeit für mich?“ rief ich begeistert. „Du solltest Dir nicht zu viele Dinge in den Kopf setzen lassen!“ wies Mama mich ab. Aufmerksam schaute ich mir die Gesichter der Anwesenden an, in der Hoffnung, aus deren Mimik etwas ablesen zu können, was meinen Wünschen günstig gewesen wäre. Stattdessen – Mama übersetzte mir alles genau – versuchte uns Myky mit allerlei Warnungen bezüglich der Gefahren der Känguruforschung abzuschrecken. So müsse beim Betreten der Gehege wegen der Angriffslust der Böcke mit Unfällen gerechnet werden. Und im Busch sehe man diese Tiere überhaupt nur höchst selten. Doch nur um sie in den lokalen Zoos zu beobachten, lohne sich eine solche Reise wohl kaum.
Die Ausführungen Mykys und sein Bestreben, meine Australienträume in Luft aufzulösen, deprimierten mich über viele Wochen. Würde ich diesen Kontinent in meinem ganzen Leben denn niemals betreten? Doch trotz meiner Niedergeschlagenheit ging mir der Name Pebbly Beach nicht aus dem Sinn.
Obwohl ich intensiv studierte und meine Beobachtungen im Zoo, aber auch die Büroarbeiten im Geschäft meines Vaters fortführte, vernachlässigte ich meine kunstgewerbliche Tätigkeit keineswegs. Schon 1957 hatte ich mir einen alten, soliden schwedischen Webstuhl beschafft, den ich selber zusammensetzte. Auf diesem webte ich anfangs Leinenstoffe. Später, beim Weben oder Wirken, Flechten und Knüpfen, verfertigte ich Wandteppiche nach eigens mit Wasserfarben oder Kreide entworfenen Vorlagen. Wegen ihrer feurigen Farben zählten abendliche Dämmerungen für mich zu den allerschönsten Motiven. 1964 gewann ich zu meiner Überraschung den dritten Preis beim Basler Kunstkredit-Wettbewerb und zwar mit einem Entwurf einer zwei mal drei Meter grossen Collage aus vielen bunten Seidenpapieren, die einen Sonnenuntergang am Meer darstellte, wie ich ihn auf einer Israelreise erlebt hatte. Auch der Entwurf eines neuen Wandteppichs für ein Basler Spital stammte von mir.
Am liebsten jedoch fertigte ich im Garten Mosaikbilder aus gesammelten und behauenen Steinen. Eines dieser Bilder stellte die Erschaffung der Erde dar, ein anderes die Zellteilung und ein drittes die Spaltung des Atoms. Gelben Bernstein, den ich im Tessin gefunden hatte, verwandelte ich in Sonnenblumen, ein weiteres Mosaik zeigte ein Känguru vor abendrotem Hintergrund.
Im Jahre 1962 trat ich nebenberuflich die Stelle einer Assistentin für Beschäftigungstherapie im jüdischen Altersheim La Charmille an. Dort arbeitete ich zwei Tage in der Woche mit Hochbetagten. Diese Menschen waren – trotz ihrer altersbedingt eingeschränkten sprachlichen Verständigung – mit grossem Eifer dabei, noch einige kunstgewerbliche Fertigkeiten zu erlernen, was ihnen auch mit Malen, Weben und Flechten mehr oder weniger gut gelang. Da meine Chefin beim Weben nicht so viele Kenntnisse besass wie ich, war ich nur allzu gern bereit, ihr zu helfen.
Doch ich webte nicht nur, sondern zeichnete und malte auch an einem Kinderbuch. Den Text dazu lieferte mir eine Tiergeschichte der Aboriginals. Sie hiess „Das lachende Wasser.“
Eines Tages kam ich von der Arbeit heim und begegnete Papa an der Haustür. Er war sehr blass. Seine vor etwa einem Jahr diagnostizierte Leukämie machte ihm schwer zu schaffen. Ich sah Tränen in seinen Augen. Aber er lächelte, und es war ein glückliches Lächeln. Ich ahnte, dass es die Vorfreude über die Verwirklichung meiner Projekte war, die er hoffte noch erleben zu dürfen.
„Heute habe ich eine wichtige Nachricht für Dich. Rate mal, was es ist“, sagte er. Und dann berichtete er von einem langen Telefonat mit Prof. Lang, dem es zu danken war, dass mein Kinderbuch vom „lachenden Wasser“ bald auch gedruckt werden sollte.
Unerwartetes Zusammentreffen
Während meiner Kängurubeobachtungen im Basler Zoo hatte ich eines Tages ein beglückendes Erlebnis, das meine noch immer anhaltende Niedergeschlagenheit ein wenig milderte. Als ich auf meinem Schemel am Rande des Besucherweges sass, die schussbereite Kamera samt Teleobjektiv vor mir auf dem Stativ, erblickte ich einen Tierpfleger, gefolgt von einer jungen, blonden Frau. Er zeigte ihr die von mir erstellten Listen über den Kängurubestand und wies auf die einzelnen Tiere, die er natürlich ebenso gut kannte wie ich. Zunächst glaubte ich, es handle sich um eine Berufsfotografin. Dann blickten die beiden zu mir herüber, und meine Anspannung wuchs so stark, dass meine Konzentration nachliess. Nach einer Weile kamen sie zu mir, und ich begrüsste die junge Frau. Es stellte sich heraus, dass sie Vreni Meyer hiess, Zoologiestudentin war und gerade begonnen hatte, an ihrer Dissertation über das Verhalten der Kängurus zu arbeiten. Wie ich später erfuhr, hatte Prof. A. Portmann von Zoologischen Institut Basel sie bereits auf mich aufmerksam gemacht, was ich sehr rührend fand. Bei den folgenden regelmässigen Treffen gelang uns sehr bald eine mühelose Verständigung. Dieser Gedankenaustausch sollte für uns beide sehr wertvoll werden.
Oft beobachteten wir gemeinsam und diskutierten anschliessend das Gesehene. Es waren wunderbare Stunden, und Vreni und ich wurden enge Freundinnen! Sie erteilte mir Unterricht in Physiologie, Evolutionslehre und anderen Teilbereichen der Biologie. Ausserdem half sie mir bei meinen Vorbereitungen für vergleichende Studien wildlebender und gefangener Kängurus, die ich selbstständig in Australien vornehmen wollte. Ohne eine vorherige sorgfältige Vorbereitung im Zoo war dies kaum möglich. Ich war zuversichtlich, in wenigen Jahren die grosse Reise mit Mama antreten zu können, so wie Papa es sich immer gewünscht hatte. Doch dessen Gesundheitszustand verschlimmerte sich, die Schmerzen quälten ihn zusehends. Er wurde bettlägerig. Für mich waren es die innigsten Augenblicke, wenn ich abends allein bei ihm am Bett sass. Vieles vorübergehend Vergessene aus seiner Vergangenheit lebte nun wieder in ihm, und ich nahm alles in mich auf. Papa erzählte heitere Jugendgeschichten aus Schwabach bei Nürnberg, wo er mit seinen Eltern und drei Brüdern in einem grossen, alten Hause aus dem Jahre 1561 gelebt hatte. Wir sprachen auch über unsere Israelreisen. Ich versank in wehmütige Erinnerungen. Es war auf einer Busfahrt entlang des Toten Meeres bei Sonnenuntergang. Ich sass angeschmiegt an Papa und fühlte mich Gott nahe. Da erlebte er wie in einer Vision den befreiten Zugang zur Klagemauer in Jerusalem! (Der 6-Tage-Krieg sollte ihm Recht geben.)
Es war eine grosse und tiefe Nähe zwischen uns.
Bald schon versiegten unsere Gespräche, da man Papa wegen seiner starken Schmerzen Morphium verschrieb, was seine Präsenz erheblich minderte. Trotzdem blieb eine elementare Kommunikation zwischen uns bis zu seinem Tod erhalten. Ab und zu korrigierte Papa sogar noch humorvoll meine undeutliche Aussprache der Silben und zog dabei seine langen, buschigen Augenbrauen hoch, so dass ich eiligst verschwand, um heimlich zu weinen. Eines Abends half ich der Gemeindeschwester Papa aufzusetzen. Dabei betrachtete ich sein abgemagertes Gesicht, strich über die dicken Augenbrauen und sagte ihm, diese seien so hübsch. Freundlich lächelte er mich an. In der folgenden Nacht verschied er, beinahe siebzigjährig, friedlich daheim. Das war im Juni des Jahres 1967. Die Gesellschaft Papas fehlte mir sehr. Nur in meinen Träumen konnte ich sie wiederfinden.
Meine Mutter und ich führten die Geschäfte Papas – den Handel und die Reparatur von Büromaschinen – nun alleine weiter. Ich war stolz darauf, von ihm so viel gelernt zu haben, um zusammen mit Mama auf die Übernahme des Geschäftes gut vorbereitet zu sein. Während Mama für den Telefondienst verantwortlich war und meine Geschäftsbriefe korrigierte, wachte ich über die Preiskalkulation und das Erstellen der Rechnungen. Elektronische Hilfsmittel, wie Fax, Email oder Schreibtelefon gab es damals noch nicht, so dass ich immer wieder auf die Hilfe Mamas angewiesen war. Dennoch ging alles besser als wir geglaubt hatten. Und schliesslich, so betonte meine Mama immer wieder, durften wir froh sein, dass wir uns auf diese Weise unsere grosse Reise nach Australien finanzieren konnten!