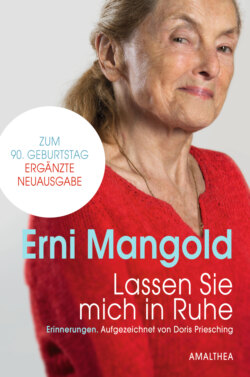Читать книгу Lassen Sie mich in Ruhe - Doris Priesching - Страница 12
»Mit Kriegsgut wirft man nicht!«
ОглавлениеMit der Hitlerzeit kam ich nicht zurecht. Ich war zwölf, als er kam. Es war für mich ein ziemlicher Schlag. Ich konnte das alles gar nicht begreifen und war entsetzt, als ich sah, wie die Massen aufmarschierten. Ich war fassungslos, als meine Eltern plötzlich »Heil Hitler!« riefen. Ich war völlig verwirrt, als ich sah, wie man mich für die Hitlerjugend vereinnahmen wollte. Zwei Tage hielt ich es in einer dieser Gruppen aus. Eine der BDM-Anführerinnen sagte: »Du musst singen und eins, zwei marschieren.« Ich haute ihr eine runter und lief davon. Meinen Eltern erklärte ich, dass ich dort nie wieder hingehen würde. Basta, das war’s.
Mit dem Namen Goldmann stürzten sich die Nazis natürlich sofort auf meinen Vater. Er hatte aber lange vor dem Einmarsch einen Ahnenpass machen lassen, weil er wissen wollte, welche Krankheiten es in seiner Familie gab und welche in der Familie seiner Frau aufgetreten waren. Er stand damals schon auf dem Standpunkt, Krebs sei vererbbar und wollte seine Risiken abtesten. Jüdische Ahnen zu haben, war schon vor Hitler kein Vorteil, so ließ er sich für den Ahnenpass eine gute Geschichte einfallen. Er sagte, seine Familie hieße eigentlich Goltermann, aber sein Großvater sei immer entsetzt gewesen, weil der Name ständig falsch geschrieben wurde, einmal mit dt, dann mit th und so fort. So sei aus dem nichtjüdischen Goltermann das jüdische Goldmann geworden, ohne dass jemals jüdisches Blut in dieser Familie geflossen sei. Ich kaufte ihm die Geschichte nie ab.
Mit seinem Ausweis war der gute Severin jedenfalls vor den Nazis »sauber«. Mit 50 merkte er immerhin, welches Arschloch Hitler war und ging in Frühpension. Vor 1942 war das noch anders. Mein Vater hatte eine Landkarte an der Wand aufgehängt, die er mit kleinen, bunten Stecknadeln kennzeichnete, Stecknadeln mit Köpfchen drauf, blaue, grüne, rote. Daran konnte man erkennen, wie weit die Truppen schon vorgerückt waren. 1942 begannen die Niederlagen. Ich freute mich und hoffte, dass es bald aus ist. »Hoppla, die sind am absteigenden Ast«, bemerkte mein Vater – und ging fortan auf Distanz. Den Nazis erzählte er, der Name Goldmann mache ihm als Lehrer bei den Eltern und den Schülern große Schwierigkeiten. Eine Lüge, aber die Nazis sagten: »Das können wir ja verstehen, Herr Goldmann.« So konnte er aus der Partei austreten. In Frühpension war er ohnehin schon.
Das war sein großes Glück, weil er so nach dem Krieg wieder unterrichten durfte. Er bekam sofort Arbeit, obwohl er schon alt war. Die Pointe an dem Ganzen: Nach dem Krieg war er sehr bald wieder Antisemit.
Als 1956 die Ungarn nach Österreich flüchteten, sagte er: »Da sitzen sie schon wieder in den Restaurants mit ihrem ganzen Schmuck, und es geht ihnen schon wieder gut.« Ich sah ihn an und sagte: »Du spinnst, Papa.« Ich konnte das nie verstehen. Ich verabscheute die Nazis in einer Weise, dass ich mich heute wundere, wie ich so gut durchkommen konnte. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich ein hübsches Mädchen war, mich aber gleichzeitig saudumm stellen und grenzdebil dreinschauen konnte. Dadurch sahen sie in mir ein »süßes, kleines Mäderl« und scherten sich nicht weiter um mich. Ich nützte das aus und glaubte irgendwann sogar selbst daran.
Süß war ich natürlich überhaupt nicht. Ich trug nie Uniform, sagte nie »Heil Hitler!«, immer »Guten Tag«. Deshalb war ich unbeliebt und wurde verachtet, vor allem von den Lehrern.
Während dieser ganzen Zeit war ich sehr unglücklich und hatte nur eine einzige Freundin. Ich glaube, es war 1942, da ging ich mit dem Judenstern in Wien, wegen ihr. Sie war etwas jünger und kam wie ich aus Großweikersdorf. Ihre Eltern hatten dort einen Gemischtwarenladen gehabt, Textilien verkauft und ihren Kunden Kredite gegeben. Dadurch hatten sie natürlich eine schlechte Nachrede, denn damit verdienten sie viel Geld.
Die ganze Familie wurde nach Wien gebracht, und sie bekamen ein kleines Zimmer in einer Villa in der Böcklinstraße. Mein Vater sagte früh zum Vater meiner Freundin: »Ich bitte dich, geh weg, sonst überstehst du das nicht.« Er antwortete: »Was kann mir schon passieren? Ich habe ja nichts getan.«
Als Papa kapierte, was läuft, half er vielen. Irgendwie ahnte er offenbar etwas, und das ging ihm dann doch gegen den Strich. Leute stellten Koffer mit ihren Habseligkeiten bei uns ab. Er wusste etwas, ich wusste dadurch auch, dass Schreckliches vor sich ging. Nicht das gesamte Ausmaß des Wahnsinns, aber die Juden, die bei uns die Koffer abstellten, erzählten furchtbare Sachen von Arbeitslagern, aus denen keiner zurückkam. Ich ahnte nichts von der Vernichtung, aber mir war klar, dass die Juden dort nicht nur arbeiten mussten, sondern auch ermordet wurden. Nach dem Krieg blieben bei uns ein, zwei Koffer stehen. Sie wurden nie abgeholt.
Ich besuchte meine Freundin und ging mit ihr spazieren – alles nicht ungefährlich, aber es war mir egal. Sie musste den Judenstern tragen, hätte ich keinen gehabt, wäre ich garantiert angepflaumt worden. Sich mit einer Jüdin in der Öffentlichkeit zu zeigen, das ging nicht und konnte sehr unangenehm werden. Mit Judenstern wurden wir soweit in Ruhe gelassen. »Nur für Arier« stand auf den Parkbänken. Ich fand das entsetzlich und sagte sofort: »Komm, setzen wir uns.« Aber sie war panisch und lehnte voller Furcht ab: »Nein, das dürfen wir nicht!« Wir saßen trotzdem.
Manches blendete ich einfach aus. An die Novemberpogrome 1938 habe ich zum Beispiel keine bewusste Erinnerung. Ich durfte in dieser Zeit nicht ausgehen und hörte nur davon. Verdrängung war Normalität. Man wurde sehr dumm gehalten, wir erfuhren nichts, oft nicht einmal, was um die nächste Ecke geschah. Das Ausmaß der ganzen Schrecklichkeit wurde mir erst nach dem Krieg bewusst.
Ich entfloh den Massenaufmärschen, wo ich konnte. Ein gutes Mittel, sich von allem fernzuhalten, war in die Oper zu gehen. Dadurch eignete ich mir eine Musikalität an, zwar eine andere, als sich meine Mutter gewünscht hatte, aber das Ganze wuchs sich zu einer Leidenschaft aus, die zur Folge hatte, dass ich stundenlang am Stehplatz stand. Natürlich hörte man damals vor allem Wagner, es störte mich nicht. Ich war nicht allein, junge Leute drängten sich auf den billigsten Plätzen. Daraus entstand eine Gemeinschaft, die sehr angenehm war, weil sie weit weg war von dem ganzen System. Ich ging fast jeden zweiten Tag in die Oper, sah den Ring zwei-, dreimal, Salome sechs-, siebenmal, Othello ebenso oft und eigenartigerweise Carmina Burana. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Nazis Carl Orff auf Linie gebracht haben. Ich erinnere mich an viele Frauen auf der Bühne, die mit Besen kehrten, irgendeine perverse Show zogen sie ab.
Nach dem Krieg interessierten mich Konzerte, Oper nicht mehr. Sonntags ging ich in den Musikverein, die Karten bekam ich umsonst, weil ich ein paar Leute kannte. Im Theater war ich kaum, ein- oder zweimal in der »Josefstadt«, es gefiel mir. Aber die Musik begeisterte mich.
Nach dem Krieg lernte ich Herbert von Karajan und Karl Böhm persönlich kennen. Böhm brachte mir Mozart nahe, denn damals stand ich mehr auf Beethoven. Beethoven war aufwühlender, entsprach mehr meinem pubertären Gemüt. Mozart fand ich uninteressant, bissl Geklimper, bis Böhm mir zeigte, dass da viel mehr dahinter ist.
Karajan wiederum interessierte sich weniger für meinen Musikgeschmack, mehr für mich persönlich. Ich gefiel ihm.
Ich muss 22 gewesen sein, als Karajan eines Tages vor dem Theater stand und mich abholte. Keine Ahnung, ob er im Stück war, ich nehme es an. Zu der Zeit war er noch mit Anita Gütermann verheiratet. Sie half ihm sehr und führte ihn in die Wiener Gesellschaft ein. Bis dahin war er ja in Berlin, hier kannte ihn fast niemand. Wir plauderten, er erzählte viel von seiner Musik. Er war zurückhaltend, drängte mich zu nichts. Ich fand ihn als Künstler spannend, als Mann leider nicht. War halt so.
Das Ende unserer Treffen war eher ernüchternd. Er wollte mir irgendwann sein neues Auto zeigen, ich lag aber im Bett mit einem Riesenkater, weil ich wahrscheinlich am Vortag wieder einmal betrunken war – eine Art Dauerzustand in jener Zeit.
Meine Mutter stand völlig entgeistert im Zimmer: »Du, der Karajan steht vor der Tür«, flüsterte sie. Ich fuhr auf: »Jössas, mit dem habe ich mich verabredet! Sag ihm, ich kann nicht.«
Da war er beleidigt, und ich traf ihn nie wieder.
Jahre später saß ich einmal in einem seiner Konzerte, Bruckner. Karajan dirigierte Bruckner unglaublich gut. Ich saß in der ersten Reihe, zum Schluss verbeugte er sich – und zwinkerte mir zu. Immerhin.
Wien im Krieg? Die Bomben waren mir völlig gleichgültig. Ich fürchtete mich überhaupt nicht, sondern fand das alles irgendwie abenteuerlich. Nur ein einziges Mal war ich in einem Bunker, es war unerträglich, grausig, absurd und scheußlich. Man ging hinein und war wie in einem Zementkasten, ich hatte das Gefühl, lebendig begraben zu sein. Meine Eltern hatten Angst und wollten es sicherer haben, aber in den Bunker brachten sie mich nicht mehr hinein.
Also gingen wir in die Katakomben. Die waren zwar nicht sicher, denn die Bomben konnten durchfallen und große Zerstörungen anrichten. Aber dort gefiel es mir besser. Es war aufregend, denn man konnte da zwischen zwei Stockwerken wechseln und sogar in Wohnungen schlüpfen. Da saßen dann junge Leute, die sagten – wie ich –, sie pfeifen auf den Keller und tranken Sekt. Ich setzte mich dazu, trank mit ihnen und fand das ungeheuer toll.
In der Rembrandtstraße lebte eine Bekannte, sie wurde später Kostümbildnerin beim ORF. Sie war so alt wie ich, und ich bat sie eines Abends aus einem Gefühl heraus: »Geh bitte, schlaf bei uns, damit dir nichts passiert.« Die Nazis waren seit Tagen unterwegs und suchten die ganze Zeit. Sie übernachtete bei uns, und das rettete ihr wahrscheinlich das Leben, denn am nächsten Morgen war in der Mauer ihres Wohnhauses ein Granattrichter, und dahinter lagen fünf Leichen. Nur eine einzige Frau ließen sie am Leben. Sie hatte gesagt, dass ihr Sohn eingerückt sei. Verraten wurden sie von einer Hausmeisterin. Die stand auf der Straße und zeigte den SS-lern, wo sie suchen mussten. Sie sagte kein Wort, deutete nur mit dem Finger in Richtung der Fenster. Das war üblich und hieß: Dort wohnen noch Juden.
Ich wollte diese Hausmeisterin nach dem Krieg umbringen. Über die Jahre vergaß ich sie, und als ich wieder in Wien war, wohnte sie nicht mehr dort. Wir fanden sie nicht. Vielleicht war es gut, so blieben wir von einer bösen Tat verschont – und sie auch.
Ein Schlüsselerlebnis in dieser Zeit war die Sache mit der Straßenbahn. Man konnte ja in den offenen Zügen auf- und abspringen, eine ganz feine Sache, die wir wie einen Sport betrieben. Ich stand schon an der Rampe, als ein junger Mann mit einem verletzten Bein versuchte aufzuhüpfen. Er humpelte nebenher, stolperte schließlich, und ich fing ihn in letzter Sekunde auf, zog ihn herein, sonst wäre er garantiert unter die Straßenbahn gekommen.
»Bist du verrückt? Du kannst doch nicht mit dem wehen Haxen da reinspringen!«
Nach dem Krieg erzählte mir dieser Mann, dass er das kaputte Bein nur vorgetäuscht hatte, um nicht in den Krieg zu müssen. Ich war fassungslos: »Aber du hättest doch bei diesem Sprung draufgehen können? Wieso hast du das riskiert?« – »Nein«, sagte er. Die Tarnung hätte er selbst dafür nicht aufgegeben: »Nicht für einen einzigen Sprung. Das musste man durchhalten.«
So war diese Scheißzeit.
Ich erlebte den Krieg in keiner Weise so, dass es mir je an etwas fehlte. Überhaupt nicht. Ich aß so gut wie überhaupt nichts. Nach dem Krieg stopfte ich am Tag fünf Grahamweckerl hinein, vier Wassereis, und als es das gab, täglich ein Mayonnaiseei. Das war wunderbar, mehr brauchte ich nicht. Irgendwann bekam ich eine Eiweißallergie und musste die Eier bleiben lassen. Mit meiner ersten großen Filmgage ging ich in ein Restaurant und bestellte mir ein Beefsteak. Das Geld verfraß ich samt und sonders.
Im Krieg war ich nie hungrig. Essen war mir nicht wichtig, ich kümmerte mich nicht darum. Wenn du jung bist, leidest du nicht. Meine Mutter litt sehr. Mein Vater? Ich weiß es nicht mehr.
Ich war mit mir beschäftigt und damit, Menschen kennenzulernen. Damit verbunden war meist der Konsum von Unmengen von Alkohol. Dass ich so viel vertrug, war später ein Glück, denn man konnte mich nicht betrunken machen. Also gut, ein Russe mit viel Wodka vielleicht. Aber an und für sich hatte ich einen gewissen Schutz, wenn man so will.
Mein Glück war, dass ich nicht vergewaltigt wurde. Ich war mit 19 noch Jungfrau, was nicht weiter ungewöhnlich war. Daran war natürlich vor allem die katholische Kirche schuld, weil meine Mutter sehr gläubig war. Nach dem Krieg war sie bei den Zeugen Jehovas, aber das nur nebenbei.
Ich würde heute so sagen: Weil ich in einer gewissen Sorglosigkeit lebte, ging alles gut. Ich konnte mit den schwierigen Umständen besser umgehen. Bis heute sage ich mir: Weg ist weg, da kann man nichts machen.
In gewisser Weise war ich leichtsinnig. Daraus ergaben sich gefährliche Situationen, die mich leicht Kopf und Kragen kosten hätten können.
1944 erklärte Goebbels den »Totalen Krieg«, und junge Menschen, die nicht mehr zur Schule gingen, wurden als Flakhelferinnen oder in Fabriken eingezogen. Flakhelferin – das hätte ich in tausend Jahren nicht gemacht. Ich bemühte mich also, in die Fabrik zu kommen. So landete ich bei Siemens & Halske an den Maschinen für die Rüstung.
Mit mir arbeiteten Jugoslawinnen. Wir wussten nicht einmal genau, was wir da taten, denn die Waffenproduktion war streng geheim. Während der Arbeit war es uns streng verboten, miteinander zu sprechen. Es gab Tag- und Nachtdienste. Ich plauderte trotzdem mit einer der Arbeiterinnen – die ich ohnehin nicht verstand –, und zum Spaß warf ich ihr eines der Trümmer, die zusammengeschraubt werden mussten, zu. Der Vorgesetzte war empört: »Mit Kriegsgut wirft man nicht!«, brüllte er. Köstlich, dieser Irre sprach von Rüstungsmaterial wie von Lebensmitteln und redete mit uns wie mit Kleinkindern. Jedenfalls war so endgültig klar, wofür wir produzierten.
Siemens & Halske half mir indirekt bei meiner Ausbildung. In der riesigen Halle war es so laut, dass ich Monologe hielt. Während ich an den Maschinen »Kriegsgut« herstellte, brüllte ich Dramen von Goethe und Schiller. Das gefiel allen und brachte eine willkommene Abwechslung.