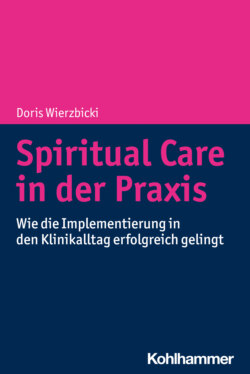Читать книгу Spiritual Care in der Praxis - Doris Wierzbicki - Страница 11
Оглавление
Einleitung
Die Wahrnehmung von spirituellen Bedürfnissen wird in der heutigen Gesellschaft zunehmend wichtiger. Obwohl einerseits ein deutlicher Rückgang von Personen zu verzeichnen ist, die sich traditionellen religiösen Institutionen zugehörig fühlen, gewinnt andererseits das Phänomen individueller Religiosität und Spiritualität an Bedeutung.
Als Seelsorgerin der Klinik-Diakonissen Linz erlebe ich, dass viele Mitarbeitende sich wünschen, Patienten und Patientinnen »Heilsames« zukommen zu lassen. Dies betrifft die Ärzteschaft, Beschäftigte in der Pflege, im Service, sogar in der Verwaltung. Immer mehr schärft sich bei mir das Bewusstsein, dass dies nicht allein auf den medizinischen Bereich reduzierbar ist.
Dabei denke ich nicht an Dienstleistungen, sondern an ein Beziehungsgeschehen, welches über das rein Funktionale, Somatische und Materielle hinausgeht. Das sind Begegnungen, die im Inneren berühren und den Heilungsprozess, wie auch immer dieser aussehen mag, unterstützen. Diese Art von Kontakten ist nicht machbar, weil Spiritualität einen für den Menschen unverfügbaren, transzendentalen und geschenkhaften Aspekt beinhaltet. Allerdings müsste es möglich sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die solche Begegnungen erleichtern.
Meiner Beobachtung nach fehlt Mitarbeitenden im Umgang mit spirituellen Bedürfnissen oft die nötige Kompetenz. Dies äußert sich dadurch, dass sie einerseits schwierigen spirituellen Fragestellungen ausweichen, oder andererseits so tun, als hätten sie die Anfrage nicht gehört.
Ursachen können dabei eine fehlende Selbstwahrnehmung und eine nicht ausreichende Patientenwahrnehmung sein. Ein weiterer Grund ist die Angst, das Falsche zu sagen. Dahinter kann die Unsicherheit stecken, auf Ohnmachtssituationen zu reagieren. Ein Aspekt ist dabei eventuell die Sorge, sich nicht ausreichend gegen belastende Situationen abgrenzen zu können.
Demzufolge fühlen sich zu behandelnde Personen nicht ernst genommen. So bleiben sie mit ihren Bedürfnissen allein zurück und wertvolle, vielleicht sogar das »Heilwerden« unterstützende Prozesse, werden durch Schlaf- sowie Beruhigungsmittel zugedeckt. Daher beschäftigten mich die Fragen: Welche Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen Mitarbeitende, um spirituelle Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen wahrnehmen und darauf heilsam eingehen zu können? Sind solche Kompetenzen schulbar?
In der Bangkok Charta für Gesundheitsförderung (2005) wird von der WHO ausdrücklich gefordert, neben dem physischen, psychischen und sozialen Wohlbefinden, auch spirituelles Wohlbefinden gleichermaßen als ein fundamentales Grundrecht eines jeden Menschen anzusehen. (World Health Organisation 2005)
Dieses Bewusstsein setzt sich immer mehr im medizinischen Bereich durch. Dennoch ist es für Geschäftsführer einer Klinik – in Zeiten knapper werdender zeitlicher und finanzieller Ressourcen – schwierig, sich auch für das spirituelle Wohlbefinden der Patienten und Patientinnen verantwortlich zu fühlen und sich damit für die Einführung von Spiritual Care zu entscheiden.
Die Frage dabei ist, wie kann man Angebote für Mitarbeitende schaffen, die sowohl deren spirituelle Kompetenz erweitern als auch in einen effektiven Klinikalltag passen.
Mit diesem Buch soll daher vorgestellt werden, welche Kompetenzen Mitarbeitende brauchen, um spirituelle Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen wahrnehmen und darauf heilsam eingehen zu können. Darüber hinaus soll veranschaulicht werden, wie sich diese Kompetenzen im Kontext einer Klinik schulen lassen und welche positiven Auswirkungen dadurch entstehen.
Für Spiritual Care gibt es verschiedenste Ausbildungsangebote, nicht nur in den USA, England, den Niederlanden, sondern auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Angebote reichen von einfachen Kursmodulen bis hin zu einer Ausbildung mit Bachelor- oder gar Masterabschluss. Auch sind konkrete Überlegungen dazu in der Fachliteratur zu finden. Hemma Prenner beschäftigt sich z. B. mit der spirituellen Dimension in der Pflegeausbildung (Prenner 2014). Uneinigkeit besteht nach Meinung von der Theologin und Medizinerin Doris Nauer darin, von wem, wie und wo die jeweils als notwendig erachteten Kompetenzen für Spiritual Care erworben werden sollen. Ihrer Meinung nach reicht da die Angebotspalette von Wochenendseminaren und Online-Kursen bis hin zu Zusatzqualifikationskursen und äußerst anspruchsvollen Intensiv-Lehrgängen im Rahmen beruflicher Aus-, Weiter- und Fortbildung (Nauer 2015). Spirituelle Begleitende fühlen sich überfordert, wenn keine kontinuierlichen Weiterbildungsmaßnahmen implementiert werden. Dies konnte von Michael Balbonie und nachfolgend auch von anderen nachgewiesen werden (Balboni et al. 2013).
Jochen Dutzmann verweist in seinem Artikel auf eine Studie von Piret Paal, Traugott Roser und Eckhard Frick, die unter den Mitgliedern der IGGS (Internationale Gesellschaft für Gesundheit und Spiritualität) eine Umfrage zum Thema »Developments in spiritual care education in German – speaking countries« starteten (Paal 2014). Die Autoren der Umfrage unterscheiden in der Lehre von Spiritual Care folgende drei Lehrebenen: »Haltung, Wissen und Fertigkeiten« (Dutzmann 2016, S. 30). An Hand von vier ausgewiesenen Spezialisten und deren einschlägigen Publikationen möchte ich in diesem Buch aufzeigen, welche Kompetenzen in erster Linie dafür notwendig sind, um diesen drei genannten Ebenen gerecht zu werden.
Das darauf basierende Fortbildungsprogramm hat beeindruckende Ergebnisse erzielt, die diesen Ansatz für das Diakoniewerk als Ganzes interessant machen. Unter dem Titel »Leitprozess Spiritual Care« im Weiterbildungsprogramm 2020 der Diakonieakademie ist zu lesen: »Mit dem Linzer Modell unserer Klinik Diakonissen Linz ist für den deutschsprachigen Raum ein innovatives Ankerbeispiel zur Umsetzung von Spiritual Care in Organisationen (SCO) entstanden – vor dem kostbaren Hintergrund unserer Diakonissentradition« (Wettreck 2019, S. 15). Dies trug dazu bei, sich mit dieser Thematik »Spiritual Care als Lernprozess in unserem Kulturprozess« intensiver zu beschäftigen und sich für die Gründung eines Innovationscenters Spiritual Care in Organisationen zu entscheiden. So formulierte der Diakonisch-theologische Vorstand des Diakoniewerkes anlässlich der Einladung zum Innovationsdialog im Zuge der Gründung von ISCO (wissenschaftlicher Beirat und geladene Gäste): »Der Bedarf an Ganzheitlichkeit und Achtsamkeit im Sozial- und Gesundheitswesen, aber auch in der Wirtschaft, steigt. Spiritualität zeigt sich als ein möglicher wichtiger Schlüsselfaktor und missing link für die Sinnsuche, die Selbstsorge und die Beziehungs- und Gemeinschaftsdimension – gerade auch vor dem Hintergrund von erschwerten Bedingungen in Care Berufen. Das Diakoniewerk wagt mit dem Ansatz Spiritual Care in Organisationen (SCO) den spirituellen Schritt in eine neue Zeit – mit dem Schatz seiner Tradition und auf Basis des international als beispielhaft wahrgenommenen Ankerbeispiels Klinik Diakonissen Linz.«