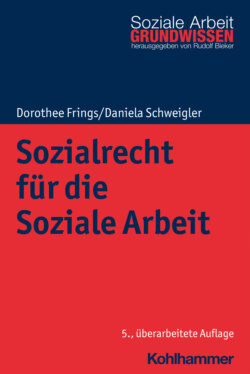Читать книгу Sozialrecht für die Soziale Arbeit - Dorothee Frings - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Beispiele
ОглавлениеDer Ausschluss von nicht erwerbstätigen Ausländerinnen (mit humanitären Aufenthaltstiteln) vom Elterngeld verstößt gegen den Gleichheitssatz, weil ihre Lebensbedingungen mit denen deutscher Familien vergleichbar sind und Frauen durch diesen Ausschluss mittelbar wegen ihrer Mutterschaft benachteiligt werden (BVerfG v. 10.7.2012 – 1 BvL 2/10).
Die Festsetzung des Beitragssatzes in der Pflegeversicherung in gleicher Höhe für Versicherte mit und ohne Kinder erklärte das BVerfG für verfassungswidrig. Der Gleichheitssatz gebiete hier eine Ungleichbehandlung, weil die Erziehung von Kindern einen Beitrag zum Generationenvertrag darstelle (BVerfG v. 3.4.2001 – 1 BvR 1629/94).
Es bestehen weitere Regelungen im Sozialrecht, bei denen die Unterscheidungskriterien verfassungsrechtlich zweifelhaft sind, z. B.:
• die Anrechnung des Elterngeldes für nicht Erwerbstätige auf die Leistungsansprüche nach SGB II, SGB XII und Kinderzuschlag, nicht aber auf BAföG und andere Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts;
• härtere Sanktionen im SGB II für Leistungsberechtigte unter 25 Jahren als für solche ab 25 Jahren (Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Regierungsentwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Rechtsvereinfachung, BR-Drs. 66/16, vom 16. März 2016, NDV 2016, 193 ff.; Janda, SGb 2015, 301 ff.; in seiner sog. Hartz-IV-Sanktionen-Entscheidung BVerfG v. 5.11.2019 – 1 BvL 7/16 – hat sich das BVerfG dazu ausdrücklich nicht geäußert).
Aus dem Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG leitet sich die Verpflichtung des Staates und der individuelle Anspruch des Bürgers auf eine gerechte Gestaltung des Sozialrechts ab (soziale Gerechtigkeit).
Auch aus dem Zusammenspiel des Sozialstaatsprinzips mit der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) und dem Recht aus Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) können sich mittelbar Leistungsansprüche ergeben.
»Es ist mit den Grundrechten aus Art. 2 Abs 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip und aus Art. 2 Abs 2 Satz 1 GG nicht vereinbar, einen gesetzlich Krankenversicherten, für dessen lebensbedrohliche oder regelmäßig tödliche Erkrankung eine allgemein anerkannte, medizinischem Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung steht, von der Leistung einer von ihm gewählten, ärztlich angewandten Behandlungsmethode auszuschließen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht« (BVerfG v. 6.12.2005 – 1 BvR 347/98).
Da die Verfassung keine expliziten sozialen Grundrechte enthält, bleiben dem Gesetzgeber bei der Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme weitgehende Freiheiten, solange ein menschenwürdiges Dasein für alle gewährleistet ist. Allerdings muss sich der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Sozialrechts am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen. Danach muss bei Eingriffen in die Rechte des Bürgers unter verschiedenen Maßnahmen, mit denen ein bestimmtes staatliches Ziel erreicht werden kann, immer der mildeste Eingriff gewählt werden; es besteht ein Übermaßverbot. Geht es aber um die Gestaltung von Leistungen, so wird der Gesetzgeber auf ein Mindestmaß an sozialem Schutz verpflichtet; es besteht ein Untermaßverbot (BVerfG v. 28.5.1993 – 2 BvF 2/90). Nur in seltenen Fällen kann aber unmittelbar aus der Verfassung ein Anspruch auf eine bestimmte Leistung abgeleitet werden.
Während die sozialen Grundrechte in Deutschland nur auf Umwegen (insbesondere über den Schutz der Menschenwürde, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und das Sozialstaatsprinzip) eine begrenzte Geltung beanspruchen können, wurden sie auf internationaler Ebene zum festen Menschenrechtsbestand. Der Einstieg erfolgte durch die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« der Vereinten Nationen von 1948, in deren Art. 25 es heißt:
»Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.«
Eine weitere Ausgestaltung und Konkretisierung erhielten die sozialen Grundrechte im »Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte« der Vereinten Nationen von 1966, der in Deutschland als Gesetz gilt (Bundesgesetzblatt 1973 II, S. 1569). Der Pakt enthält ein Recht auf Arbeit, auf Arbeitsschutz, auf einen angemessenen Lebensstandard, Wohnen, Gesundheit und Bildung. In Art. 7 wird z. B. das Recht auf ein Arbeitsentgelt anerkannt, welches Arbeitnehmerinnen einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien sichert. Soziale Rechte mit dem Fokus auf Kinder enthalten auch die Art. 26, 27 des »Übereinkommens über die Rechte des Kindes« (UN-Kinderrechtskonvention, KRK), das seit 1992 für Deutschland verbindlich ist (Bundesgesetzblatt 1992 II, S. 990).
In Deutschland gab es im Jahresdurchschnitt 2019 rund 120.000 Menschen, die durch die Ausweitung von Niedriglohn- und Leiharbeit zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung Leistungen nach dem SGB II in Anspruch nehmen mussten. Insgesamt ist rund ein Viertel aller erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger erwerbstätig (BA Statistik, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Monats- und Jahreszahlen): im Jahresdurchschnitt 2019: 26 %). Sie können ihre Rechte aus dem Pakt aber nicht vor einem deutschen Gericht einklagen, weil in ihm nur die Verpflichtungen der Staaten festgehalten sind, nicht aber Rechtsansprüche der einzelnen Bürgerin.
Bereits 1946 wurde die International Labour Organisation (ILO), die 1919 zum Schutz der sozialen Rechte der Arbeiter gegründet worden war, als erste Sonderorganisation der Vereinten Nationen anerkannt. Deutschland ist Mitglied dieser Organisation und hat alle sog. Kernarbeitsnormen ratifiziert, die sich u. a. auf das Diskriminierungsverbot, die Vereinigungsfreiheit und das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit beziehen.
Ende 2009 ist auch die Grundrechte-Charta der Europäischen Union (GRC) in Kraft getreten und gilt für die Bereiche, in denen die EU die Kompetenz zur Rechtsetzung hat. Im Unterschied zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) werden in der Charta auch soziale Grundrechte gewährleistet (Art. 27–38 GRC). Viele der Rechte auf Sozialleistungen sind jedoch sehr allgemein gehalten und oft auch mit dem Zusatz versehen: »nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten«. Trotz dieser Einschränkungen entnimmt der EuGH diesen Regelungen verbindliche Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten, so etwa den Anspruch auf einen bezahlten Jahresurlaub aus Art. 31 Abs. 2 GRC (EuGH v. 30.6.2016 – C-178/15 »Sobczyszyn«).