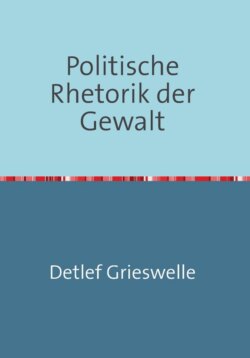Читать книгу Politische Rhetorik der Gewalt - Dr. Detlef Grieswelle - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Hostilisierung, Feindbild
ОглавлениеAnders verhält es sich in einer Demokratie mit Demokraten, die den Minimalkonsens der Verfassung akzeptieren und verteidigen; hier darf es keine Feinde aus politischen Gründen geben, sondern nur Andersdenkende oder auch politische Gegner. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Gegner und Feind ist zu wahren, also zwischen gegnerischer Partei und dem Feind der Demokratie überhaupt. Es kann zwar Gegensätze und Konflikte geben, ja sie sind essenzielle Gegebenheiten und Notwendigkeiten in der Politik, aber Feindschaften und Feindbilder passen nicht zu einer angemessenen Umgangskultur im demokratischen Gemeinwesen, wo gefordert ist, auf andere zuzugehen, ihnen zuzuhören, Rücksicht zu nehmen und Respekt zu zeigen, Verständnisbereitschaft an den Tag zu legen, Informationen und Wertungen der gegnerischen Partei zu prüfen, sein Bewusstsein zu bilden und kompromissbereit zu sein. Erziehung zur Demokratie bedeutet nicht Erziehung zu Hass, Verachtung, Selbstgefälligkeit, sondern zu Würde, Selbstachtung und Achtung des anderen als ebenbürtiger Person, zu Friede und Gewaltlosigkeit. Feindschaft zerstört Verbindungen, Anderssein darf nicht als Mindersein begriffen werden, Anerkennung von Verschiedenheiten ist geboten, statt Uniformität zu fordern. Man kann innerhalb der gemeinsamen Fundamentaloption, deren Negation den Feind macht, zu verschiedenen Programmen und erst recht Methodiken gelangen, „ohne das für einen selbst Verpflichtende in jedem Fall auch anderen als sie verpflichtend ansinnen zu müssen, vielleicht dies nicht einmal immer zu dürfen. Und dies nicht bloß wegen eines möglichen Gewissensirrtums (stets des anderen?), sondern weil man oft nicht ausschließen kann, es gebe mehrere sittlich richtige Lösungen des Problems“56.
Zumeist sind nur Mehrheitsentscheidungen erreichbar, die respektiert werden müssen, weil sonst überhaupt kein Handeln und keine Ordnung zustande kämen. „Dabei wird weder von den Respektierenden (der Minderheit) verlangt, das Ergebnis für richtig zu halten (dies wäre ja selbst bei Einstimmigkeit keineswegs garantiert), noch dürfen diese beanspruchen, nur richtigen (d. h. konkret: den eigenen) Lösungen dürfe zugestimmt werden“57. Einen politischen Gegner als Feind zu behandeln, bedeutet, ihm die Teilnahme an der Gemeinschaft der Demokraten streitig zu machen; wer dies tut, zerstört die Grundlagen für eine fruchtbare Diskussion und Zusammenarbeit.
Mit Feind gemeint ist primär nicht der persönliche Feind – lateinisch: inimicus, sondern der kollektive Feind – lateinisch: hostis, der Machtansprüche stellt und sie durchzusetzen sucht. Auch der Feindbildbegriff bezieht sich auf Vorstellungen von anderen Kollektiven in Form grob verallgemeinernder, stark voreingenommener, schwer korrigierbarer und affektgeladener Ansichten über Fremdgruppen, denen extrem negative Eigenschaften zugeschrieben werden, die in der Regel mit der Wirklichkeit wenig übereinstimmen: „Das Feindbild stellt eine mehr oder weniger strukturierte Ganzheit von Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gefühlen dar, die unter dem Aspekt der Feindschaft vereinheitlicht einer Gruppe von Menschen oder Völkern und Staaten entgegengebracht werden“58. Es handelt sich um stereotype Muster mit realitätsverzerrenden Vereinfachungen der Wirklichkeit, mit ideologischem Dogmatismus und mit von starker Aggression getragener Ausgrenzung des Gegners; das gemeinsame Feindbild entlastet von der Notwendigkeit eigener Information und Orientierung sowie differenzierenden Denkens, erlaubt eine eindeutige Unterscheidung zwischen falsch und richtig, gut und böse, vereinfacht das politische Handlungs- und Konfliktfeld, stärkt den inneren Zusammenhalt von Gruppen, gestattet die Abreaktion von Aggressionen nach außen.
Die von Feindbildern beherrschten Gruppen zeichnen sich zumeist aus durch Klischees gegenüber der wirklichen Welt und eine beachtliche Wirklichkeitsverweigerung, durch ein überzogenes Selbstwert-, ja Überlegenheitsgefühl und eine radikale Abwertung des Feindes, durch Absolutheitsansprüche und Unfehlbarkeitsideen, durch entsprechend schroffe und hasserfüllte Ablehnung des Antipoden und dessen moralische Verurteilung als grundlegend böse, durch eine Tabuisierung einer Diskussion mit dem andersdenkenden Feind, der angeblich wesentliche Werte und Bedürfnisse der Eigengruppe bedroht oder sich ihr entgegenstellt. Die Beschreibung des Feindbildes verdeutlicht, dass man unter Feindbild nicht den Kontrahenten selbst, sondern etwas Drittes, das sich zwischen ihn und einen selbst schiebt, versteht: „Ein Bild, das sich wie alle Bilder aus einer ganzen Anzahl von Komponenten zusammensetzt, die mit dem eigentlichen Objekt oft sehr wenig oder kaum etwas zu tun haben“59.
Kurt und Kati Spillmann haben im Anschluss an Daniel Frei sieben typische Merkmale, die zum Syndrom des Feindbildes gehören, entwickelt. Diese Kennzeichen seien abschließend in der Zusammenfassung von Wagenlehner60 genannt:
Misstrauen: Alles, was vom Feind kommt, ist entweder schlecht oder, wenn es vernünftig aussieht, aus unredlichen Motiven entstanden.
Schuldzuschiebung: Der Feind ist schuld an der existierenden Spannung bzw. an dem, was an den herrschenden Umständen für uns negativ ist.
Negative Antizipation: Was immer der Feind unternimmt, er will uns schaden.
Identifikation mit dem Bösen: Der Feind verkörpert in allem das Gegenteil dessen, was wir sind und anstreben, er will unsere höchsten Werte vernichten und muss deshalb selbst vernichtet werden.
Nullsummendenken: Was dem Feind nützt, schadet uns – und umgekehrt.
De-Individualisierung: Jeder, der zur Gruppe der N. N. gehört, ist eo ipso unser Feind.
Empathieverweigerung: Mit unserem Feind verbindet uns keine Gemeinsamkeit; es gibt keine Information, die uns von unserer Feind-Auffassung abbringen könnte; den Feinden gegenüber sind menschliche Gefühle und ethische Kriterien gefährlich und fehl am Platz.
Feindbilder sind ein wesentlicher Bestandteil der Politik vor allem in totalitären Ideologien, Bewegungen und Regimen. Über die verhängnisvolle Rolle der Feindbilder liefern die letzten Jahre der Weimarer Republik, wo die extreme Rechte und die extreme Linke, insbesondere Nationalsozialismus und Kommunismus, in der politischen Auseinandersetzung, ihrer Ideologie entsprechend, permanent Feindbilder verwandten, wobei sie sich auf die Vertreter demokratischer Parteien und das demokratische System insgesamt konzentrierten. Die Nationalsozialisten prägten vor allem das Feindbild des Rassenfeindes, des „ewigen Juden“ und der „jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung“, während sich der Kommunismus an der Weltanschauung der Klassengegensätze orientierte und eine Bekämpfung des „Klassenfeindes“ forderte. Eine innerweltliche Religion mit ihrer Verachtung einer angeblich total verdorbenen Gegenwart, ihren Absolutheitsansprüchen, ihrem unerschütterlichen Glauben an die eigene Perfektion, ihren apodiktischen Zukunfts- und Erlösungsvorstellungen, impliziert Hass und fanatische Feindbilder.
Feindbilder kennzeichneten in der Folge der deutschen Geschichte die nationalsozialistische Herrschaft und den „realen Sozialismus“ in der ehemaligen DDR. Hier wurde von Staats wegen der Hass geschürt und der Kampf mit Feindbildern zu einer wichtigen Aufgabe. Aber auch in Westdeutschland gab es seit den 50er Jahren extremistische Gruppierungen, deren Denken und Handeln von Feindbildern bestimmt waren. Zu denken ist hier an frühe rechtsradikale Bewegungen, an Ende der 60er Jahre im akademischen Bereich aufkommende Neo-Marxismen mit ihren neuen Klassenkampfforderungen, an den Versuch rechtsextremer Gruppen, mit nationalistischen und antidemokratischen Feindbildern wieder Fuß zu fassen, an extreme Gewalt im Terrorismus der 70er und 80er Jahre, aber auch an extremistische Angehörige in sog. autonomen Protestbewegungen wie denen der Hausbesetzer und in fundamentalistischen Gruppen wie beispielsweise ausländischen Widerstandsbewegungen, wo nicht selten Formen demokratischer Willensbildung und des demokratischen Pluralismus verhöhnt, einfache Welterklärungen gegeben und politische Lösungen in diktatorischen Führungen gesehen wurden.
Feindschaft gegenüber dem politischen Gegner ist aber nun nicht nur ein Konfliktverhalten extremistischer Personen und Gruppen, sondern auch häufig Wirklichkeit im Streit zwischen Demokraten. Eine vielfach angewandte Strategie ist es, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die bürgerlichen Freiheitsrechte exklusiv für sich in Anspruch zu nehmen und den politischen Gegner aus dem demokratischen Grundkonsens auszugrenzen. Nicht selten kommt es vor, den politischen Antipoden in Nähe totalitärer Ideologien und Systeme bzw. des Rechts- und Linksextremismus zu rücken, und das vielfach in einer subtilen Manier, die auf negative Assoziationen der Begriffe abstellt. Die Kampagne „Freiheit oder Sozialismus“ der CDU, Geißlers Attacken, der SPD mit Bezug auf Pazifismustendenzen gegenüber dem Nationalsozialismus mangelhaftes Eintreten für die Verteidigung der Demokratie vorzuwerfen, CDU-Angriffe, SPD und NSDAP hätten als Gemeinsamkeiten sozialistisches Denken, aber auch Behauptungen der SPD, CDU/CSU stünden radikalem Nationalismus und Rechtsextremismus nahe und würden sich nicht hinreichend davon distanzieren, sind hierfür Beispiele. Es ist zwar zulässig, dem politischen Gegner Interessenbindungen, falsche Wertorientierungen, Fehler und Fehleinschätzungen vorzuwerfen, aber nicht Verfassungsfeindlichkeit, so hierfür keine tatsächlichen Gründe vorliegen: „Legt man es darauf an, den Andersdenkenden aus dem Grundkonsens herauszudrängen, ihn über den Rand der Verfassung hinabzustoßen, wird aus der konkurrenzdemokratischen, legitimen und notwendigen Konfliktsituation allemal ein Notstand, ein Ausnahmezustand, in dem die Hemmschwellen politischer Kultur nicht mehr zählen. Der Andersdenkende wird zum Feind, er wird zum Feind gemacht, nichts ist dann gefährlicher als die Destabilisierung des Feindbildes: Die demokratische Auseinandersetzung pervertiert zum Überlebens- und Vernichtungskampf, zum geistigen Bürgerkrieg, in dem der Zweck jedes Mittel heiligt61.“
Feindbilder zur Herabsetzung politischer Gegner sind auch keineswegs selten in den Massenmedien, man denke nur an Feinderklärungen an Adenauer, Brandt, Strauß und Kohl oder an Parteien bzw. ganze Regierungen, in „Bild“, „Stern“, „Spiegel“, wobei politische und wirtschaftliche Ziele sich vermischen. Insbesondere die Partei-, Gewerkschafts- und Verbandspresse zeigt häufig Merkmale, die den sieben Kategorien unseres Feindbildes in hohem Maße entsprechen, auch politische Magazine im Fernsehen, auf dem rechten und linken Spektrum, arbeiten mit Freund-Feind-Stereotypen und Schwarz-Weiß-Malerei von Gut und Böse. Immer mehr Rechts- und Sozialwissenschaftler äußern ihre Sorge über eine Vergiftung der Streitkultur durch zügelloswerdende Diffamierungskampagnen der Massenmedien und warnen, dass solche Tendenzen zu einer Negativauslese in der Politik führen könnten. Dabei wird häufig das Bundesverfassungsgericht mitverantwortlich für den Verfall der Streitkultur gemacht, weil „Karlsruhe“ die Meinungsfreiheit bis zur äußersten Grenze ausgeweitet und den Schutz der persönlichen Ehre auf einen minimalen Rest habe schrumpfen lassen62.
Zeitweise grassierten solche Feindstiftungen auch bei den sog. Widerstands- und Protestbewegungen mit ihren bisweilen radikalen Weltanschauungen im Friedens- und Umweltbereich. Sie beanspruchten vielfach, unantastbares Wissen in einzelnen Handlungsfeldern oder in breiten Bereichen der Politik zu besitzen, und legten entsprechend Selbstgerechtigkeit und Selbstüberheblichkeit an den Tag; dem Bewusstsein des Auserwähltseins entsprach die Verdammung der anderen: Herr, ich danke Dir, dass wir nicht so sind wie die Parteipolitiker63. Der Staat und die Politik der großen Parteien wurden hier vielfach verteufelt, geradezu kriminalisiert, weil sie gegen fundamentale Werte des Lebens- und Naturschutzes, der Bewahrung des Friedens, der Verantwortung für sozial Schwache etc. verstießen. Behutsamkeit, Toleranz, Kompromissfähigkeit, Affektregulierung, Realismus, Fehlbarkeit, all dies sind dann keine Orientierungen mehr für die politische Auseinandersetzung. Der politische Gegner wird als schuldiger Feind ausgemacht, gegen den sich kollektive politische Aggression zu richten hat und der fanatisch zu bekämpfen ist. Im Wörterbuch „Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland“ werden von Conze und Reinhart64 wesentliche Strukturen eines Feindbildes unter der Fragestellung des Fanatismus herausgearbeitet: Fanatismus meint die Beanspruchung der Ausschließlichkeit der eigenen Auffassung und Feindseligkeit gegen alles, was nicht der eigenen Position entspricht; die Anmaßung absoluter Wahrheitsgewissheit; die Blindheit gegenüber anderen Weltsichten; den Eifer für oder gegen eine Sache; überspitzten Enthusiasmus, Schwärmerei, ja Besessenheit. Bereits 1855 hieß es in einem Lexikon65: „Fanatismus ist blind, einseitig und ausschließend. Charakterisierend ist demnach für den Fanatiker 1), dass er sich der Klarheit des Verstandes verschließt, sich dem Spiele der Fantasie … hinzugeben liebt, wobei 2) gerne eine Idee die fixe in ihm wird. … Es fehlt ihm gleichmäßig an der Ausweitung des Kopfes durch die Bildung wie an der Aufgeschlossenheit des Herzens durch die Liebe, so dass es ihm rein unmöglich ist, sich auf einen anderen Standpunkt zu versetzen. … Darum behandelt er alles nach einer, nämlich nach seiner Schablone und ist 3) ausschließend, feindselig, verfolgungssüchtig gegen alles, was er nicht selbst ist“. Auch wenn der Fanatismus sich häufig nur auf politische Teilbereiche erstreckt, birgt er doch die Gefahr, in antidemokratischen Extremismus und nackte Gewalt umzuschlagen, dafür gibt es auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hinreichend Beispiele. Für einzelne Personen und Gruppen der Protestbewegungen blieb es nicht bei Forderungen eines sog. kleinen Widerstandsrechts und eines Anspruchs auf Gewalt ausschließlich gegen Sachen.
Wenn heute zunehmend über eine unzulängliche politische Streitkultur unter Demokraten geklagt wird, dann stellt sich nicht ohne Grund die Frage, ob hier zuvörderst die Methoden und Techniken politischer Auseinandersetzung gemeint sind oder nicht vielmehr die politischen Konflikte selbst, die in hohem Maße für falsch und überflüssig gehalten werden. Wie zahlreiche empirische Untersuchungen, speziell aus der Politologie, zeigen, ist die politische Kultur der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland durch beachtliche Vorbehalte gegenüber streitiger Auseinandersetzung geprägt, und Polemik wird entsprechend dieser konsensuellen Einstellungen eher als Gefahr denn als produktive Notwendigkeit gesehen. Und dies gilt umso mehr, wenn heftig gestritten wird, was dann zumeist als Sittenverfall, zumindest als Stillosigkeit registriert und als Verletzung gewünschter Harmonie abgestraft wird66.
In der Diskussion über Streitkultur ist also zunächst einmal Partei zu ergreifen für die Legitimität und Notwendigkeit des politischen Streits67. „Er ist der Normalfall in einer offenen und pluralistischen Demokratie, in der Parteien nicht 'das Ganze', sondern Profile und Kontraste vertreten und Parlamente geradezu das Gemeinwesen in seinen Auseinandersetzungen.“ Pluralistische Ordnung impliziert, dass der Weg zum Kompromiss und zum Konsens sowie zur Mehrheitsentscheidung über streitige Alternativen führt: „Die freiheitlich-demokratische Grundordnung beruht auf dieser Voraussetzung. Ihr Institutionengefüge und ihre Verfahrensweisen politischer Willensbildung dienen der Leitidee, diese Voraussetzung praktisch umzusetzen und politischem Handeln und Reden einen möglichst weiten streitigen Sektor zu öffnen“68.
Die hohe Bedeutung des Streites für die moderne Demokratie findet ihre Begründung in der Pluralismustheorie, die von der Unterschiedlichkeit von Interessen und Meinungen ausgeht und eine Staatskonstruktion zugrunde legt, die deren Artikulation und Konkurrenz ermöglicht: Durch Akzeptanz und Schutz der offenen politischen Willensbildung der Parteienkonkurrenz und der Oppositionsfreiheit sowie durch die Existenz von parlamentarischen Institutionen und Verfahrensstrukturen für die politische Willensbildung. Streit entspreche demnach den normativen Prämissen des demokratischen Staates, meint Oberreuter ganz richtig. Integration entstehe aus Konflikten, Diskussionen und Kompromissen – also aus Streit offener Kommunikation69. „Das größte Defizit an Streitkultur ist die Perhorreszierung des Streits, sodann das Missverständnis seiner potenziellen Reichweite und seiner Grenzen. Von Streitkultur lässt sich sprechen, wenn Vielfalt und ihre öffentliche Artikulation legitim sind, die Grundlagen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unstreitig und wenn Würde und Rechte der Konfliktparteien unangegriffen bleiben“. Die hohe Zustimmung der Bevölkerung in der früheren Bundesrepublik Deutschland zu grundlegenden Prinzipien pluraler Demokratie begründete noch lange nicht ein angemessenes Verständnis politischer Willensbildung: So stimmten 70% dem Statement zu, Auseinandersetzungen der Interessengruppen schadeten dem Gemeinwohl; 92% meinten, die Interessen des ganzen Volkes sollten immer über den Sonderinteressen der Einzelnen stehen, was ein unsäglich formuliertes Statement mit ebenso unsäglicher Zustimmung darstelle, wie Oberreuter formuliert; 65% meinten, die Opposition sollte die Regierung in ihrer Arbeit unterstützen, nicht kritisieren; abstrakt hielten 93% Opposition für eine Voraussetzung lebensfähiger Demokratie, aber konkret beraubten 61% sie ihrer Funktion als Widerpart der Regierung70. Allerdings ist zu beachten, wie Leggewie71 betont, dass hinsichtlich der Harmoniesehnsucht und Streitunfähigkeit der Westdeutschen im Vergleich zu anderen westlichen Demokratien in den 70er und 80er Jahren eine Normalisierung eingetreten ist.
Des Weiteren darf die Forderung nach einer Streitkultur im Sinne eines angemessenen Umgangs mit dem Gegner nicht dazu führen, dass der notwendige Streit mit Stilfragen allzu sehr eingeengt wird, Politik in pluraler Demokratie ist vor allem auch Kampf: Kampf um Mehrheiten, damit für richtig und zuträglich gehaltene Problemlösungen Gültigkeit erlangen. Konkurrenz muss auch schmerzen können. Wichtige Themen verdienen herausfordernde Deutlichkeit, Stilargumente dürfen nicht von der Sache selbst ablenken und Alternativen delegitimieren; Oberreuter72 fasst diese Gedanken zusammen: „Wo substanzielle Differenzen zu Kontroversen führen, widerspräche der Versuch, sie durch Stil- und Kulturforderungen einzuebnen und zu harmonisieren, den Prinzipien der Konkurrenzdemokratie.“ Diese gebe dem Dissens normativen Raum, sodass Unterschiede artikuliert werden könnten – nötigenfalls auch hart, deutlich und schonungslos.
Es ist also nach den Chancen für die Artikulation von Konflikten zu fragen. Die deutsche politische Tradition mit ihren dominanten Werten der Harmonie und Geschlossenheit sowie der Ablehnung der offenen Gesellschaft und Konkurrenzdemokratie legen dies nahe; aber auch heutige Tendenzen, die klare und polemische Artikulation von Meinungen in streitiger Auseinandersetzung als negativ für Parteien, Parlament, Koalitionen und Regierungen zu interpretieren. Antiparteienaffekte und Oppositionsskepsis schöpfen aus solch mangelndem Verständnis für parlamentarische Demokratie und ihre Diskussions- und Willensbildungsprozesse. Grenzen für den Streit werden also neben institutionellen Vorkehrungen und Regelungen der Demokratie in Deutschland in beträchtlichem Maße durch Sanktionierung von Streit und Polemik durch eine kritische Öffentlichkeit gezogen.
Nichtsdestotrotz ist es nützlich, für Theorie wie praktisches Handeln, Kriterien für eine angemessene Kultur des Streitens zu entwickeln, und das gerade nicht, um Kooperation und Harmonieverständnisse und -bestrebungen zu befördern, sondern um Pluralismus, Konflikte, streitige Auseinandersetzung und auch Polemik zu stärken. Die Kriterien für einen solchen kultivierten Streit können aus dem Fundus der institutionellen Erfahrungen mit Demokratien und aus Geist und Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates gewonnen werden. Zu einer solchen demokratischen Streitkultur gehören folgende fundamentalen Voraussetzungen, die wir in Anlehnung an eine wegweisende Typisierung von Sutor auf den Punkt bringen73:
1. Es müssen gute grundlegende kulturelle Bedingungen für die Möglichkeit friedlicher Austragung politischer Konflikte vorliegen (Anerkennung fundamentaler Gleichheit aller Gesellschaftsmitglieder, prinzipieller Wertkonsens, Loyalität gegenüber der gemeinsamen Ordnung, Verurteilung von Gewalt etc.);
2. Politik ist wesentlich Praxis – also weder Theorie noch Technik, d. h. nicht Vollzug erkannter Wahrheiten und auch nicht sozialtechnisch geleitete Herstellung der Gesellschaftsordnung (Absage an absolute Wahrheitsansprüche, Bereitschaft zur Infragestellung im öffentlichen Diskurs, keine Determinierung von Entscheidungen, aber auch kein Dezisionismus);
3. unverzichtbar sind Konfliktregelungsmechanismen und institutionelle Vorkehrungen – über die grundlegenden Spielregeln der Demokratie hinaus (Apriori für produktive Austragung von Konflikten und Konsensbildung, die häufig in Form von Kompromissen erfolgt);
4. der politische Streit darf nicht reduziert werden auf bloßen Interessen-Machtkampf, sondern hat sich vor allem auch am Gemeinwohl auszurichten (das Gemeinwohl ist der eigentliche Sinn politischer Ordnung; es darf nicht missverstanden werden als Summe partikularer Interessen, auch nicht als vorgegebene feste Größe, die Interessen übergestülpt wird, sondern als ein im demokratischen Diskurs zu suchendes Regulativ);
5. es müssen bei den Bürgern Dispositionen in Form von Tugenden vorhanden sein, damit eine demokratische Streitkultur gelingt (Klugheit im Sinne praktischer Vernunft – Verbindung der Erkenntnis mit dem Wollen, des Wissens mit dem Handeln, des Denkens mit dem Tun; Kombination von Situationsanalyse, Sinn für das Mögliche im Licht des Wünschbaren, Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit; Gerechtigkeitswille – Verkehrsgerechtigkeit, zuteilende Gerechtigkeit, gesetzliche Gerechtigkeit; Zivilcourage – Mut zu eigener Meinung, Konfliktbereitschaft zur Findung guter Lösungen, Kampf für eine als recht erkannte Sache; Mäßigung – in Form von Zurücknahme der eigenen Person und Position, Verträglichkeit im Umgang).
Im Rahmen der Diskussion über das rechte Maß wird nicht selten auf die Zügelung und Disziplinierung von Aggressivität abgestellt. Gegensätze und Kampf bedeuten geradezu zwangsläufig auch Aggressivität gegenüber dem politischen Gegner im Sinne einer Beschädigung oder Verletzung, wobei diese häufig auch instrumentell eingesetzt werden, um Vorteile zu erzielen. Das moralische Postulat kann nur beinhalten, massive Aggressionen in Form verletzender Malediktion zu vermeiden bzw. einzugrenzen: Gemeint sind Hetze, Häme, Verleumdung, Verfluchung und Beschimpfung, Schmähung und Verunglimpfung, Drohung. Allerdings gibt es öffentlich konkurrierende gesellschaftliche Anschauungen darüber, inwieweit solche Schädigungen nicht akzeptiert werden können; obwohl aggressive Aussagen und Handlungen je nach politischem Standort zum Teil verschieden bewertet werden, existieren doch auch bezüglich der Aggression74 recht einheitliche Bewertungen der Legitimität und Illegitimität von Handlungen durch die Bevölkerung. Will ein Redner bei einem Publikum mit seinen Aussagen Erfolg haben, dann bedarf es also in der Regel einer gewissen Kontrolle seiner Aggressivität gegenüber dem politischen Gegner. Das kann geschehen durch sparsame Benutzung aggressionsfördernder Begriffe, Signale und Symbole, insbesondere von Parolen und Reizwörtern; durch Vermeidung falscher Attribution, also unangemessener Ursachen- und Schuldzuschreibung bei unerfreulichem Verhalten anderer Menschen; durch die Bereitschaft, Ziele wie Durchsetzung und Gewinn, Beachtung und Anerkennung, Abwehr und Schutz zu erreichen ohne Schädigung und Schadenszufügung, also ohne Aggression als Mittel zum Zweck; durch Verminderung von Abwertung und Herabsetzung; durch mehr verhaltensbezogene Kritik anstelle pauschaler Personabwertung, die in der Regel als stärkere Provokation empfunden wird und heftigere emotionale Abwehr oder Kränkung hervorruft; zu guter Letzt durch Vermeidung aggressiver Modelle, indem also, z. B. in Versammlungen, Diskussionsleiter, Moderatoren, Diskussionsteilnehmer etc. in ruhiger, konstruktiver Weise die Stimmung zu prägen versuchen.
Wenn um das Gemeinwohl gestritten wird und es um das soziale und politische Zusammenleben geht, dann muss wohl ein Mindeststandard an rationaler Auseinandersetzung dem politischen Diskurs als Maßstab angelegt werden. Denn dann sind nicht nur Propaganda und symbolische Kritik gefordert. Bei aller scharfen Gegenüberstellung von Standpunkten und deutlich artikulierter Infragestellung von Positionen, also bei aller dissonanten, konfliktorischen Auseinandersetzung, ist doch zu beachten, dass die Kontroversen zivilisiert ausgetragen werden. Entgleisungen wie Lüge, Verunglimpfung, bewusst grobe Unterstellung etc., wie sie besonders in Wahlkampfzeiten auftreten, dürfen nicht die Signatur des politischen Kampfes werden. Gefragt ist polemologische Kompetenz, gerade auch dann, wenn in Massenmedien eine publizitätsträchtige Auseinandersetzung erwartet wird, die die Aufmerksamkeit der Menschen findet und für das Publikum einen großen Unterhaltungswert besitzt. Den Gegner durch den Schmutz zu ziehen, ihn zu schmähen, zu denunzieren, das alles ist allerdings nicht erst seit Existenz moderner Massenmedien Realität, politischer Unflat hat vielmehr eine lange Tradition, man denke nur an die „Pasquinaden“ und an die „Mazarinaden“ im 16. und 17. Jahrhundert, wo die Beleidigung in der Politik einen gewissen Höhepunkt erreichte und zu einer hohen Kunst entwickelt wurde.
Da in der Bundesrepublik Deutschland eine aggressive Polarisierung von der Bevölkerung eher abgelehnt wird, ist hiermit eine Grenze gezogen gegen sprachliche Konfliktverschärfungsformen und erst recht gegen gezielte Angriffe auf die Würde des politischen Gegners. Empirische Forschungen haben denn auch bestätigt, dass im internationalen Vergleich die politische Auseinandersetzung sowohl im Parlament als auch außerhalb nicht von außergewöhnlicher Schärfe gekennzeichnet ist. Britische Sprachwissenschaftler konstatierten hierzulande eher Scheu vor rhetorischer Akzentuierung und eine Ablehnung konfrontativer Umgangsformen, das zeige sich besonders in den Bundestagsdebatten im Gegensatz zum britischen Unterhaus. Vielleicht ist eine mittlere Lösung die beste: Leidenschaftliche Kontroversen mit voller Hingabe und scharfen Meinungsverschiedenheiten einerseits, aber auch Vermeidung von stillosem Streit, geistlosem Machtinteresse, sklavischer Parteilichkeit und phraseologischer Propaganda andererseits; angewandt auf das Parlament, muss man sich abgrenzen von bloßem Schlagabtausch, bezüglich der Wahlkämpfe von Schlammschlachten und Verunglimpfungen75. Allerdings ist die parlamentarische Debatte keineswegs normativ zu überfrachten76, indem man sie vor allem als Veranstaltung zur Suche vernünftiger Lösungen betrachtet: Die Debatte hat längst keine sachliche Überzeugungsfunktion mehr, wie sie in Ausschüssen und Fraktionen von großer Bedeutung ist; das Plenum steht vor allem für deklaratorische Debatten zur Verfügung, die der Veröffentlichung und Rechtfertigung von im Wesentlichen parteipolitisch geprägten Positionen dienen. Debatten haben primär nicht die Funktion der Suche nach Entscheidungen, sondern die ihrer Legitimierung.
Die weitgehende Einhaltung der Normen eines maßvollen Umgangs miteinander erlaubt eine fruchtbare Nutzung der Gegensätze. Die Gemeinwesen bedürfen immer auch des sozialen Wandels und der Innovation, und nur über soziale Konflikte und ihren produktiven Austrag sind wesentliche Probleme zu lösen. Der Gegner im politischen Kampf fordert durch Widerspruch heraus, zwingt, fremde Überlegungen einzubeziehen, verlangt Beweglichkeit und schöpferische Kraft: Was Antoine des Saint-Exupéry77 als anthropologische Grundkonstante formuliert, gilt auch für den politischen Kampf: Wachsen durch den Gegner, der einem alles abverlangt, um überlegen zu werden, d. h. – in unserem Fall – um Mehrheiten zu gewinnen.
Entscheidungen in der parlamentarischen Demokratie gründen ihren Verbindlichkeits-anspruch letztlich auf Verfahren, nicht auf inhaltliche Richtigkeit; ansonsten gäbe es für eine unterlegene Minderheit keinen Grund, sich zu fügen. Dieser Grundkonsens kann in Gefahr geraten, wenn soziale Bewegungen, Protestgruppen etc. Misstrauen gegen etablierte Parteien und vor allem gegen Institutionen und Verfahren der parlamentarischen Demokratie hegen und für ihre Alternativprogrammatik die Möglichkeit plausibler Infragestellung durch den politischen Gegner bestreiten. Gefahren für eine vernünftige Konfliktaustragung drohen nicht durch den Typus der Volkspartei, der sowohl innerparteilich zur Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit zwingt, um die diversen Meinungen und Interessen zu bündeln, als auch nach außerhalb den Diskurs offenhalten muss, z. B. um Koalitionen zu bilden, in staatlichen Organen Mehrheiten zu finden und auf die politische Öffentlichkeit in aller Breite erfolgreich einzuwirken. Hingegen stellen kleinere Gruppierungen wie Alternativ- und Protestbewegungen gesonderte Provinzen politischer Sinnstiftung und Kommunikation dar, und solche Segmente verfolgen eher geschlossene, ideologisierte Politikangebote und sind nach außen viel weniger kommunikations- oder gar kompromissfähig. Es entwickeln sich hier milieuspezifische Selbstverständlichkeiten, Denk- und Sprechweisen, und es entfalten sich häufig Strukturen mit beträchtlichem Exklusivitätsanspruch. Nicht selten kommt es zu elitären Anmaßungen, das höhere Bewusstsein zu haben, das leidenschaftlichere Engagement zu zeigen, allein im Besitz der richtigen politischen Agenden und der richtigen Diagnosen und Problemlösungen zu sein. Bei derartigem Wahrheitsanspruch wird konsequenterweise nach Freund und Feind geschieden. Es entstehen im Selbstverständnis dieser Minoritäten Grundkonflikte, die kaum befriedbar, Wertkonflikte, die nur schwer kompromissfähig sind. Wenn es angeblich um Existenzbedrohungen geht wie in Bereichen von Friede und Umwelt und die Situation als Not- und Ausnahmezustand empfunden wird, verlieren – zumindest für einzelne Mitglieder solcher radikalen Gruppierungen – fundamentale Bindungen ihre Kraft; politisch für allgemeingültig erklärte Wahrheitsansprüche sprengen dann den politischen Grundkonsens, die Spielregeln der Demokratie und den Friedensrahmen der Gesetze. Allerdings wird zumeist nur ziviler Ungehorsam in Form eines kleinen Widerstandsrechts und einer begrenzten Rechtsverletzung eingefordert. Schwärmerisches Moralisieren, namentlich bei Kontroversen über Friede und Ökologie, birgt immer die Gefahr in sich, umzuschlagen von scharfem Meinungskampf und aggressivem Protest sowie begrenzter Regelverletzung in eine grundlegende Legitimitätsaufkündigung durch die Tat, letztlich in Gewalt und Terror.