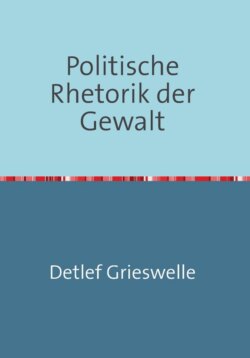Читать книгу Politische Rhetorik der Gewalt - Dr. Detlef Grieswelle - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Einführung in die Thematik 1. Begriffe und Konzepte der Gewalt
ОглавлениеDie Etymologie des Wortes Gewalt verweist auf ein breites Bedeutungsfeld wie Starksein, Machtausübung, Beherrschung, Durchsetzung, Druck, Zwang, Schädigung, Verletzung. Der Begriff der Gewalt bezieht sich heute in seiner engeren, dominanten Verwendung auf körperlichen Einfluss, um einem anderen seinen Willen aufzuzwingen, gemeint ist also die zielgerichtete physische Durchsetzung von Ansprüchen und Erwartungen durch den Angriff auf Leib und Leben1. Gewalt stellt mit ihrer intendierten Verletzung physischer Integrität eine spezifische Form der Machtausübung dar, wobei diese mit ihren destruktiven Intentionen häufig eher als ultimatives Mittel und Grenzphänomen unter dem Machthandeln gesehen und der repressive Einfluss häufig nur als Potenzialität, z. B. in Gestalt der Drohung, wahrgenommen wird. Diese Konzeption von Gewalt beschränkt sich auf manifesten körperlichen Zwang, wobei hier an recht verschiedene Formen der Gewalt gedacht wird, so vor allem an Krieg, Bürgerkrieg, Revolution, Aufruhr, Guerilla, Terror, Gewaltkriminalität, sexuelle Gewalt, repressive Praktiken der Polizei und sonstiger staatlicher Strafverfolgungsbehörden.
In der Wissenschaft, speziell in den Sozialwissenschaften, haben sich in der Diskussion des Gewaltbegriffs weitgehend anerkannte Unterscheidungen herauskristallisiert: personelle, kollektive und institutionelle Gewalt; rationale und irrationale, instrumentelle und kommunikative, legitime und illegitime, strukturelle Gewalt, Gewalt vonseiten der Herrschenden bzw. der Beherrschten2.
Von personeller Gewalt spricht man, wenn Gewalt von Einzelnen vorliegt, also die violente Beeinflussung von einem handelnden Subjekt ausgeht, so insbesondere in Primärgruppen, d. h. in engeren sozialen Beziehungen, aber auch in anderen Gewalthandlungen wie z. B. dem räuberischen Diebstahl. Die kollektive Gewalt bezieht sich auf kollektive körperliche Repressionen, die institutionelle auf dauerhafte Unterwerfungsverhältnisse und durch physische Sanktionen abgestützte Verfügungsmacht, die Positionsinhabern über andere Personen eingeräumt wird, legitime auf als zulässig anerkannte und innerhalb eines bestimmten rechtlichen Rahmens angewandte Gewalt (Verrechtlichung, Gewaltenteilung, demokratische Legitimation), rationale und irrationale Gewalt auf aktiv-planenden Einsatz physischen Zwangs bzw. reaktiv-affektgeladene Kausalität. Instrumentelle Gewalt hat die Bedeutung eines Mittels zur Verfolgung bestimmter Ziele, so vor allem eines Mediums sozialer Kontrolle, kommunikative Gewalt ist dagegen nicht Mittel zum Zweck, sondern dient der Vermittlung von Botschaften, um z. B. auf Benachteiligungen aufmerksam zu machen und gesellschaftliche Missstände anzuprangern: Die kommunikative Wirkung der Gewalt beruht vor allem auf dem Kontrast zu den üblichen Verständigungsmitteln. Die Differenz zwischen Gewalt der Herrschenden und der Beherrschten zielt auf den Unterschied zwischen staatlich-institutioneller Gewalt einerseits und Gegengewalt andererseits, z. B. durch unterdrückte und überwältigte Minderheiten, soziale und politische Protest- und Widerstandsaktionen.
Das Konzept der strukturellen Gewalt, so bei Galtung, fasst ungerechte Lebensweisen ins Auge: Gewalt liege dann vor, wenn Menschen so beeinflusst würden, dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer sei als ihre potenzielle Verwirklichung. Die Möglichkeit der Verwirklichung hängt also vom Vorhandensein von Mitteln ab, die in einer Gesellschaft zur Verfügung stehen. Fragen der sozialen Gerechtigkeit werden durch die Perspektive der strukturellen Gewalt ersetzt, das Konzept entbehrt eines präzisen Gehalts, ist unbegrenzt verwendbar und bringt keineswegs einen Erkenntniszugewinn.
Die Möglichkeit der Übertragung des Gewaltbegriffs auf Formen aggressiven und schädigenden geistigen und psychischen Einflusses wird zwar in der sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit Gewalt in der Regel nicht ganz ausgeschlossen, aber wenig in die Analysepraxis umgesetzt. Das gilt auch für jene Themen, die hier zu erörtern sind, wie die verbale Gewalt und insbesondere eine politische Rhetorik der Gewalt. Wenn von Sprachgewalt gesprochen wird, ist in der Regel nur an sprachlich-rhetorische Begabungen und Fähigkeiten gedacht, um Menschen für sich und seine Vorstellungen zu gewinnen, aber nicht an die Ausübung von Gewalt durch verbale Einflussnahme.
Gewalt in dem weiteren Sinne findet ansatzweise Aufmerksamkeit in psychologischen und sozialpsychologischen Betrachtungen3 der Gewalt in zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Entwicklung von Handlungsstrategien zur Eindämmung und Vermeidung von Gewaltphänomenen: Genannt seien das sog. Mobbing, gewaltbestimmte Kommunikation, so in Familien, Schulen etc., Formen der geschlechtlichen Diskriminierung, Missachtung von Minderheiten und marginalen Gruppen, aggressive Rhetorik in den Massenmedien, Beleidigungen im Kommunikationsrepertoire von Jugendlichen und Ansätze zur Lösung der Probleme, beispielsweise durch Aggressionsmanagement, Erlernen gewaltfreier Kommunikation, mehr Achtung des anderen und stärkere Empathie, verbesserte Kooperation und Entfaltung von Eigenschaften wie Ehrlichkeit, Klarheit, Offenheit. Der weiter gefasste Gewaltbegriff schließt zusätzlich zur körperlichen Gewalt die psychische ein, etwa in Form emotionaler Gewalt, vor allem durch verbalen Einfluss, der sich auszeichnet durch den maßlosen Einsatz von Aggression und psychischer Schädigung anderer Menschen und Gruppen, der auffällig abhebt von „normalen“ Interaktionsprozessen und ihren ethisch-moralisch bestimmten Wertfundamenten.
Als Massenphänomen findet vor allem das sog. Shitstorming im Internet Aufmerksamkeit, sowohl im privaten Bereich unter Freunden, Bekannten, Klassenkameraden etc. als auch gegenüber Prominenten und Stars, die nicht selten tausendfach aufs Bösartigste attackiert werden; zumeist ist großer Hass im Spiel in beleidigender Sprache und Geringschätzung auf Facebook-Seiten, wobei der Anlass bisweilen äußerst nichtig ist. Obwohl der Hass in der öffentlichen Auseinandersetzung, gerade auch in der Politik, weitgehend inkriminiert ist, bricht er sich hier Bahn, von der römischen Virtus mit dem Vierklang von Besonnenheit, Gerechtigkeit, Selbstkontrolle und Mut bleibt nichts mehr übrig; es gilt authentisch zu sein bis zum Erbrechen. Die Thesen Richard Sennetts vom Terror der Intimität bewahrheiten sich hier in vollem Maße.
Zwar schaffen das Internet und speziell die sog. sozialen Netzwerke neue Möglichkeiten für die Beteiligung breiter Bevölkerungskreise am öffentlichen Disput in der Politik und die Motivation zu mehr sonstiger Beteiligung, aber auch eine bedrohliche Tendenz zu brutalen Auseinandersetzungen mit scharfen, feindlichen Dissensen, zu Schmähungen und verletzendem Grobianismus, zu diffamierender Personalisierung und Zerstörung von Privatsphäre, zu maßloser Intoleranz, zu Skandalisierung, alles im Schutze eines anonymen Shitstorms, von „Menschenschwärmen“ ohne wirksame Kontrollen verbaler Gewalt, mit beachtlicher Verachtung ansonsten gültiger Regeln.
In einem umfassenden Gewaltbegriff4 richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf destruktive Affekte, psychosoziale Attitüden und soziale Verhaltensweisen. Gemeint sind zunächst einmal Affekte wie Aggression, Hass, Wut, Groll, Empörung, Zorn, Rache, dann soziale Einstellungen und Verhaltensweisen wie Friedlosigkeit, Animosität, radikale Abwertung von Menschen, Entwürdigung, Herabsetzung, Verachtung, Beleidigung, Diffamierung, Erniedrigung, Bedrohung, zu guter Letzt Strategien wie Druck, Unterdrückung, Domestizierung, Ausgrenzung (Exklusion), Stigmatisierung als auch repressive Eigenschaften von Aussagen wie Intoleranz, Apodiktik, Fanatismus, Tabuisierung von Inhalten, Extremismus, politische Religion, totalitäre Ideologie.
Sprache kann nicht nur der Vorbereitung, Ankündigung, Androhung und Rechtfertigung von Gewalt dienen, sondern sie vermag selbst zu verletzen, beispielsweise durch mokante Ironie, plumpe Beleidigung, indiskrete Taktlosigkeit, sarkastischen Spott, herablassende Demütigung, provokante Feinderklärung, moralische Diskreditierung etc. Sagen ist dann durchaus eine Form des Tuns. Der Gewalt durch Sprechen liegen häufig soziale Machtverhältnisse zugrunde durch Unterschiede in Rasse, Ethnie, Klasse, Geschlecht, Glaube, Ideologie usf., die Chancen für sprachliche Verletzungen bieten. Sprache wird zu einem Mittel zur Erzeugung von Verachtung und Ausgrenzung. Gewalt verfolgt das Ziel, die persönliche Integrität des Opfers in Frage zu stellen, dessen „Selbst“ zu verletzen, es sozial auszuschließen. Bei symbolischer Gewalt handelt es sich allerdings nicht zwangsläufig um Violenz, weil ja das potenziell Verletzende als solches aufgefasst werden muss. Sie ist also deutungsabhängig. Außerdem ist symbolische Gewalt zudem gefühlsabhängig, das auserkorene Opfer muss „mitspielen“, sich angesprochen und betroffen fühlen. Sybille Krämer fasst die Besonderheiten der „humanen Dimension“ symbolischer Gewalt wie folgt zusammen: „Anders als in der körperlichen Gewalt, welcher immer ein Zug zur Entmenschlichung des Opfers, zu seiner ‚Dingwerdung‘ eigen ist, spricht die symbolische Gewalt den Menschen notwendigerweise in seiner Eigenschaft an, nicht nur ein sprechendes und verstehendes, sondern ein interpretierendes und fühlendes Wesen zu sein.“
Bei der von uns gestellten Frage geht es nicht um das Thematisieren der physischen Gewalt in der Sprache, z. B. durch Beschreibung und Analyse, diskursive Konstruktion, vorgängige Sprechakte wie die Drohung, nicht um die Gewalt der Sprache, die dieser unvermeidbar mit ihren Strukturen, Normen und Konventionen immer schon innewohnt, auch nicht um Gewalt im Kampf um eigene National- und Muttersprachen, sondern um die Gewalt durch Sprache, also den Vollzug der Gewalt durch Akte des Sprechens; Sprache verletzt, weil jemand auf gewaltsame Weise mit der Sprache handelt.
Ausgangspunkte solcher Reflexionen über Sprache und Gewalt sind vor allem grundlegende Reflexionen zur Sprach- und Sprechtheorie, wie vor allem bei John L. Austin, Emile Benveniste, John R. Searle, aber auch zur soziologisch-ideologiekritischen Diskursanalyse, insbesondere bei Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-Francois Lyotard.