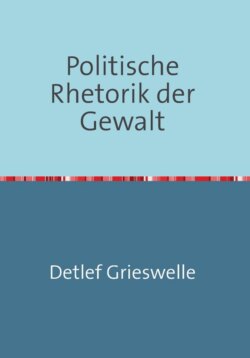Читать книгу Politische Rhetorik der Gewalt - Dr. Detlef Grieswelle - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Gewaltfreie Streitkultur
ОглавлениеDer Ausschluss gewaltbesetzter politischer Kommunikation in freiheitlicher Ordnung und demokratischer Gesellschaft ist eine zentrale Aufgabe, entsprechend gilt es eine angemessene Streitkultur zu bewahren bzw. herzustellen33.
Dabei sind grundlegende Gesichtspunkte zu beachten. Die Diskussion von Meinungen, auch in Form der Polemik, des Streitens, gehört zu einem Staat, in dem Freiheit herrscht. Zahlreiche staatsphilosophisch-politologische Denker von Aristoteles über Montesquieu und Tocqueville bis hin zu Popper haben auf die Unverzichtbarkeit des Streitens in offener Gesellschaft hingewiesen. Es gehöre geradezu zum Wesen eines freiheitlichen Staates, Pluralität und Heterogenität zuzulassen und konsequenterweise auch Meinungsvielfalt und Konflikte. Konkurrenz von Meinungen in demokratischer Ordnung verhindert, dass eine Idee verabsolutiert wird; sie trägt dazu bei, dass der Kampf um Ideen und die beste Gestaltung der Politik zu einem lebendigen wie gedeihlichen Austrag kommt und infolge zu einem guten Zusammenleben in einer Gesellschaft führt.
Allerdings bedarf es zur Umsetzung dieser fundamentalen Anforderung vor allem institutioneller Vorkehrungen zur Gewährleistung einer der freiheitlich-demokratischen Grundordnung adäquaten Konfliktaustragung, weiterhin aber auch eines darüber hinausgehenden Konsenses, welche Formen der Auseinandersetzung legitim und wo Grenzen für Polemik zu ziehen sind. Es stellt sich die Frage nach einer demokratischen Streitkultur für unser Gemeinwesen.
Für den Zusammenhalt einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft sind von großer Wichtigkeit gemeinsame, verbindliche Institutionen und Ordnungen sowie gesamtgesellschaftlich anerkannte Verfahrens- und Spielregeln, denen die praktizierten Verhaltensweisen entsprechen sollten, die man als politischen Stil und in einem umfassenderen Sinn als politische Kultur bezeichnet. „Als besonders konsensgefährdend müssen angesehen werden Intoleranz und falsche Polarisierung, d. h. die Umdeutung von Gegnerschaft in Feindschaft; ferner der Missbrauch von Regeln und Institutionen des Zusammenlebens gegen ihren gemeinten Sinn; schließlich aber auch zu hohe Konsenserwartungen und die Neigung, Interessenkonflikte unnötigerweise zu Ordnungs- und Wertkonflikten zu steigern. Konsens muss bis zu einem gewissen Grad auch als Ergebnis freiheitlicher Politik betrachtet werden, als Ergebnis eines politischen Umgangs miteinander und mit den Institutionen nach Maßstäben wie Toleranz, Gerechtigkeitssinn, Einsicht in die Relativität politischer ‚Wahrheiten‘ “34. Hier sind Maßstäbe gesetzt für eine politische Kultur angemessenen Umgangs und der Austragung von Konflikten, insbesondere für die Findung von Kompromissen; Politik ist ja vor allem Kompromisshandeln. Eine offene Gesellschaft basiert auf einem verpflichtenden Minimalkonsens über demokratische Grundordnung, aber darüber hinaus auch auf einem möglichst breiten Konsens über praktische Verfahren streitiger Auseinandersetzung. Unter den Motiven für einen zivilisierten Meinungsstreit sind folgende besonders wichtig35:
Ethikmotiv: Einhaltung ethischer Prinzipien und Mindeststandards. Politik soll verantwortungsvolles Miteinander beinhalten: Gemeint sind vor allem grundlegende gegenseitige Achtung der Streitpartner, „Eingehen“ auf den politischen Gegner, Zuhörenkönnen, Einhalten von Spielregeln, Fairness, Vermeidung von Formen persönlicher Herabsetzung und Demütigung; viele dieser Qualitäten sind auch Voraussetzung für die Zielerreichung der folgenden Kategorie;
Effizienzmotiv: Vermeidung von Reibungsverlusten durch kultivierte Formen des Streitaustrags; Ziel sind rationale Debatte und bessere Entscheidungsfindung; gefordert sind Sachlichkeit, gute Begründungen, sprachliche Ausdrucksfähigkeit, begriffliche Klarheit, Trennung von Information und Wertung;
Partizipationsmotiv: Wecken von politischem Interesse und Mitwirkungsbereitschaft, Vermeidung sog. Politikverdrossenheit, Verbesserung der Beteiligungschancen an politischer Willensbildung;
Bildungsmotiv: Erfüllung kultureller Ansprüche der Hörer bezüglich Logik, Empirik, Ästhetik; Wunsch der Auditorien nach historischem, literarischem, naturwissenschaftlichem und sonstigem Wissen und nach der Vermittlung von Zeitdiagnose und politischem Orientierungswissen; Befriedigung der Ansprüche an sprachliche Form und gesamtrhetorische Darbietung;
Persuasionsmotiv: Erreichen von Akzeptanz des Publikums durch Einsatz der breiten Palette glaubenerweckender Überzeugungsmittel; es geht hier um das eigentliche Redeziel, nämlich die Zustimmung des Publikums zu gewinnen;
Identifikationsmotiv: Schaffung von mehr Gemeinsamkeit und sozialer Identität; Stiftung von Bindungen durch Ausschöpfen von Konsensressourcen, auch durch Anerkennung des politischen Pluralismus und eines hierfür notwendigen Minimalkonsenses für den Streitaustrag.
Eine Erörterung der demokratischer Ordnung angemessenen Streitkultur wird sich zunächst einmal auf die Einhaltung des Regelkonsenses richten, der den demokratischen Verfassungsstaat trägt; es gibt und gab ja durchaus die Infragestellung des Mehrheitsprinzips und der Legitimität von rechtmäßig zustande gekommenen Entscheidungen aus angeblich übergeordneten Gründen, z. B. wegen eines notwendigen Schutzes der Menschen vor Folgen der Kernenergie, der „Nachrüstung“, der Gentechnologie usf., aber auch Reaktionen auf extremistische und insbesondere terroristische Aktivitäten mit der Forderung, liberale Freiheitsrechte und Konfliktregelungsmechanismen außer Kraft zu setzen. Zur Grundlage demokratischer Ordnung gehört immer ein fundamentales Misstrauen gegen alles Absolute, im Gegensatz zum totalen, transzendenten Anspruch des Glaubens: Politik ist immer unvollkommen, unzulänglich, entsprechend vorläufig, zielt auf Verbesserungen, aber nicht auf eine vollkommene Welt im Sinne von absoluten Heilswahrheiten; es gibt keine perfekten Lösungen, keine todsicheren Rezepte; die Ansprüche der Politik sind zeitlich und inhaltlich begrenzt. Die weit verbreitete Neigung von Vertretern aus Politik, Verbänden, Medien etc., ihren politischen Vorschlägen durch doktrinäre Ableitung aus der Verfassung den Charakter des Apodiktischen, Unbestreitbaren zu verleihen, ist zu bekämpfen, indem sorgfältig unterschieden wird zwischen einigen wenigen Wert- und Ordnungsfragen und Verfahrensprinzipien, die dem politischen Streit entzogen bleiben sollen, und politischen Gestaltungsvorschlägen, die, auf der Basis dieser Prinzipien entwickelt, der streitigen Betrachtung nicht entzogen sein dürfen. Die vorschnelle, wenig begründete Hochstilisierung von politischen Konflikten zu Verfassungs- und Rechtskonflikten gehört zur politischen Malaise, den politischen Gegner zu stigmatisieren und eigene Meinungen zu tabuisieren.
Eine wesentliche Frage ist, inwieweit sich bei uns ein demokratischer Kultur angemessener Argumentations- und Diskutierstil und insbesondere eine gewaltfreie Konfliktaustragung herausgebildet haben. Demokratische Ordnung als rationale Form der Politik erfordert ja in gewissem Maße wechselseitige Toleranz, Gesprächsbereitschaft und Verstehenwollen, rationale Urteilsfindung und verständigungsorientiertes Handeln, schließt damit übertriebene Gegnerschaft, Wirklichkeitsverweigerung, Radikalisierung aus; zu denken ist hier an Beschimpfungen, Diffamierungen, Politik als Boxkampf, Schwarz-Weiß-Malerei, unzulässige Vereinfachungen und apodiktischen Behauptungsstil, Katastrophen- und Verschwörungsrhetorik, Sendungsbewusstsein und messianisches Denken, Sensationslust. Wesentliche Defizite politischer Kommunikationskultur lassen sich beschreiben mit den Begriffen der Extremisierung, Hostilisierung, Moralisierung, Tabuisierung, Skandalisierung und Katastrophierung; solche Phänomene gewaltbesetzten Streits gefährden die Herausbildung von Gemeinsamkeiten und Konsensressourcen.
Die in der Diskussion über politische Rhetorik meistverbreiteten Begriffe wie Public Relations, politische Werbung, Propaganda, die sich ja auf alle Versuche beziehen, durch Kommunikation die Meinungen, Attitüden, Verhaltensweisen von Zielgruppen zu beeinflussen, tragen wenig zur Bestimmung der Gewaltrhetorik bei, am ehesten lässt sich diese als spezifische Form der Demagogie verstehen mit ihren Appellen an Instinkte und Vorurteile, ihren Tendenzen zu Hetze und Lüge, der groben Vereinfachung der Sachverhalte, der Darstellung der Problemlösungen als Meinung aller Gutgesinnten. Auch wäre der Schopenhauer’sche Begriff der eristischen Dialektik einigermaßen zutreffend; hier handelt es sich um eine Kunstlehre, um in einem Disput „per fas et nefas“, d. h. mit erlaubten und unerlaubten Mitteln, als derjenige zu erscheinen, der sich im Recht befindet. Hierfür steht ein Arsenal von rhetorischen Strategemen zur Verfügung, die nicht der Wahrheitsfindung dienen, sondern dem Erfolg im Meinungsstreit. Allerdings handelt es sich bei der Gewaltrhetorik um eine spezielle Strategie oder besser: um einen besonderen Typus von Strategie.
Auch der Begriff der Manipulation führt im Rahmen unserer Fragestellung nicht viel weiter, weil ein „konsumentenfreundlicher Verkauf“ der „Ware Politik“ eine zentrale Funktion jeder politischen Rhetorik darstellt und bestimmte manipulative Techniken erfordert, wie sie schon der Begriff nahelegt: auf andere zu seinem eigenen Vorteil einwirken; bewusster und gezielter Einfluss auf Menschen ohne deren Wissen und oft gegen deren Willen; absichtliche Verfälschung von Informationen; undurchsichtige Kniffe; Anpassung der Politik an Verständnisse und Bedürfnisse der Zuhörer; unauffällige Beeinflussung der Handlungsmotivationen von Individuen, die frei und im eigenen Interesse zu handeln meinen; Konditionierung durch moderne Werbetechniken; Bedürfnisse und Wertmaßstäbe der Einzelnen dem Ziel der Manipulation gefügig machen. An Strategien sind hier vor allem zu nennen: Trivialisierung; Stereotypisierung, Klischierung; Standardisierung; Formalisierung; Bipolarisierung; Personalisierung; als wesentliches Merkmal der Manipulation wird häufig genannt die Anwendung von Begriffen mit beträchtlicher Variationsbreite und einem hohen Maß an Elastizität, die vielfältige positiv besetzte Konnotationen erlauben, wie Glück, Liebe, Natur, Wohlfahrt etc., also an emotionale Identifikationen appellieren und so Zustimmungsbereitschaft fördern. Aber das ist geradezu die Kernaufgabe politischer Rhetorik, nämlich Glauben zu finden mit diesen Praktiken der Gewaltlosigkeit, die also die von uns entwickelten Formen gewaltbesetzten Sprechens vermeiden.
Auch kann es im Rahmen unserer Fragestellung nicht um weit verbreitete Verstöße gegen Sprach- und Sprechnormen gehen wie z. B. Unverständlichkeit, Unklarheit, Vieldeutigkeit, Formelhaftigkeit, Polarisierung; Veränderung zentraler politischer Begriffe durch Ausweitung, Verengung, Festlegung, Dynamisierung, Schablonisierung etc.; mangelhafte Wahrhaftigkeit durch Auswahl, Weglassen, Pointierung, unzureichenden Wirklichkeitsbezug; Auf- bzw. Abwertung der eigenen und der gegnerischen Sprache; stilistische Mängel wie Modewörter, Schwulst usf.; gemeint ist auch nicht die Tendenz, politische Schlüsselbegriffe zu besetzen und sie zu gruppenhaften, z. B. parteipolitischen Bedeutungsnetzen zu verknüpfen; die Einflussnahme auf die Bedeutung politischer Begriffe und der Kampf um die Dominanz von Begriffen im Rahmen der Werbeauseinandersetzungen gehören zum Streit in demokratischer Ordnung. Erfolge in der Sachauseinandersetzung sind zwar zumeist Voraussetzung für sprachliche Erfolge, aber die geistige und politische Führung durch Besetzung von Begriffen ist unabdingbar, um politisch zu reüssieren. Maßstab der Sprachkritik darf auch nicht einfach der Wahrheitswert der Aussagen sein, geht es doch in der politischen Rhetorik nicht primär um Daseinserhellung im Lichte der Wahrheit, wie in der Wissenschaft, sondern Sprache ist als Transportmittel von Ideen und Werten ihrer Handlungsfunktion, also dem Ziel, Glaubwürdigkeit zu stiften, untergeordnet. Rhetorik zielt also nicht auf neutrale Information, sondern bedient sich vor allem der verschiedenen Formen appellativen Sprachgebrauchs.
Der Gewaltbegriff sollte in einer Betrachtung rhetorischer Auseinandersetzung nicht so extensiv gefasst werden, dass hierunter im Streit mit Kontrahenten verbreitete, ständig benutzte Strategien, um sich gegenüber Antipoden durchzusetzen und bei einem Publikum auf Zustimmung zu stoßen, als verbale Gewalt interpretiert werden. Dies geschieht z. B. in der Untersuchung von Martin Luginbühl, „Gewalt im Gespräch. Verbale Gewalt in politischen Fernsehdiskussionen am Beispiel der ‚Arena‘ “, wo Praktiken wie die Unterstellung von Inkompetenz und Unaufrichtigkeit, die Zuschreibung von negativen Wesens- und Verhaltenszügen, die Taktik der Unterbrechung von Gesprächspartnern, um zu widersprechen, das An-sich-Reißen der Sprecherrolle und die Einflussnahme auf thematische Schwerpunktsetzung unter verbale Gewalt subsumiert werden. So wird ohne große Differenzierung jede Streitrhetorik, die nicht vor allem auf Argumentation und gute Begründung abstellt, einem radikalen Verdikt des politisch Unangemessenen ausgesetzt. Um von Gewaltrhetorik zu sprechen, bedarf es der Herausarbeitung eines engeren Gewaltbegriffs, also eines spezifischen Typus radikaler Violenzrhetorik.
Die Kritik sprachlicher Handlungen in Demokratien kann sich im Kontext der Problematik gewaltbezogener Rhetorik nur auf moralische Bewertungen besonders verwerflichen Sprachgebrauchs beziehen wie: Sprache als Mittel der Freund-Feind-Erklärung, Verteufelung des Gegners, Dogmatisierung politischer Inhalte, aggressive Unterdrückung anderen Denkens, Beanspruchung eines Interpretationsmonopols, oft in Gestalt von Wortverboten und politischer Sprachverfolgung, der eschatologischen Aufladung von Begriffen und Appelle an Heils- und Erlösungssehnsüchte. Den Extremfall solcher Rhetorik stellt der absolute Sprach- und Herrschaftsanspruch dar in Form der Systemüberwindung, der Zerstörung rechtsstaatlicher und parlamentarischer Demokratie. Aber auch das Stellen des demokratischen Gegners außerhalb der Demokratie, z. B. durch assoziative Zuordnung zu Faschismus oder Kommunismus, gehört in diesen Bereich extremer Grenzüberschreitung. Solche Vorgehensweisen, den politischen Gegner in die Nähe des Faschismus bzw. des Kommunismus/DDR-Sozialismus zu rücken, waren ja in den ausgehenden 60er- und in den 70er Jahren sehr verbreitet in der Bundesrepublik Deutschland. Solche Verzerrungen der Position des Gegners im sprachpolitischen Stellungskrieg kann der Wähler in demokratischen Ordnungen mit der Vielfalt der Medien zwar erkennen, es existiert also nicht quasi die Unentrinnbarkeit eines sprachlichen Gefängnisses, Sprache verfügt nicht einfach über das Denken, aber die meinungsfordernde Macht der ideologischen Sprache ist nicht als zu vernachlässigend zu qualifizieren, insbesondere wenn die politische Wirklichkeit gute Ansatzpunkte und eine reale Basis für solche Übergriffe bietet.
Reden oder Gewalt: Das ist kein diametraler Gegensatz; Sprechen kann einerseits der Vorbereitung von Gewalt dienen und aggressives Sprachhandeln zu physischer Gewalt führen, andererseits vermag Sprechen auch ohne solchen angedrohten bzw. realisierten Übergang verbaler zu physischer Aggressivität gewaltsam zu sein. Wer Frieden will als Hauptziel in freiheitlich-demokratischer Ordnung, muss auch friedliches Kommunikations-verhalten wollen. Politik ist hier weitgehend ein kommunikatives Projekt und damit an Sprache und ihre gewaltfreie Verwendung gebunden, um Streitfragen zu klären, sich zu verständigen, Kompromisse und Lösungen zu finden, Wähler zu überzeugen.
Rhetorik gilt als eine Kunst, einen Konsens in Fragen herbeizuführen, die nicht mit zwingender Beweisführung entschieden werden können; das Merkmal der „Wahrscheinlichkeit“ kennzeichnet einen Geltungsanspruch von Aussagen, deren Gültigkeit allein durch andere verbürgt ist, d. h. durch die Intersubjektivität ihrer konsensuellen Akzeptabilität. Es geht also nicht um apodiktisches Schließen aus wahren und ersten Sätzen, sondern – wie in der Dialektik – aus wahrscheinlichen Prämissen, wobei die Rhetorik nicht nur auf eine rationale Zustimmung zielt, sondern auch auf eine emotionale, um den Hörer zu gewinnen. Die Redesituation ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Redner vermittels eines breiten Repertoires von überzeugungskräftigen Argumenten die Zustimmungsbereitschaft seines Publikums zu erreichen sucht. Dabei gibt es in der persuasiven Rede verschiedene Grade vernünftigen Redens, die vom stichhaltigen, plausiblen Begründen und ehrlichen und vorsichtigen Überzeugen bis zu Überredung als Täuschung und fanatischer und intoleranter Propaganda reichen36.
Im Rahmen der Reflexion über politischen Einfluss und politische Macht in unserer Demokratie haben insbesondere Medienwissenschaften die große und immer noch wachsende Bedeutung der Massenmedien, vor allem des Fernsehens, betont. Thomas Meyer37 z. B. konstatiert die Entwicklung der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie, europäische Demokratien würden heute ähnlich wie in Nordamerika nach dem Regelsystem der Mediendemokratie funktionieren, nicht unterschätzt werden dürfe die Macht der Medien auf die Prägung der politischen Kultur; die Betrachtung der politischen Wirklichkeit durch Politik, Medienvertreter und Bevölkerung erfolge vor allem durch Massenmedien und ihre politischen Perspektiven. Meyer nennt u. a. die Dominanz des Visuellen und die Ästhetisierung der Wirklichkeit durch eine Kultur der Bildlichkeit, die Selektions- und Präsentationsregeln der Medien in der Politikdarstellung, die Konzentration auf spektakuläre Ereignisse, die Theatralisierung als Inszenierung visueller Eindrücke (Body-Politik, Eventpolitik, Imagepolitik, symbolische Scheinhandlungen), die Mediokrität und den Infantilismus, die Oberflächlichkeit der Aussagen und das Fehlen eines befriedigenden Maßes an Informativität und Argumentativität.
Dabei wird durchaus bezüglich der Medienmacht auch von Zwängen gesprochen, so vom Inszenierungsdruck auf die Politik und vom Meinungsdruck auf die politische Öffentlichkeit: „Ihre Zwänge und Möglichkeiten bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Masseninklusion und Entpolitisierung des Politischen auf der einen Seite und neuen Möglichkeiten attraktiver Präsentation von Politik und individueller Teilhabe an politischer Öffentlichkeit auf der anderen“38. Der Zwang zeigt sich insbesondere darin, „dass auf den Bühnen und für die Bühnen der Massenmedien zunehmend nur noch das in Betracht kommt, was sich mit dem politischen und kulturellen Geschmack der nach unten offenen breitestmöglichen Schnittmenge der Gesellschaft verträgt, der wiederum durch seine triumphierende mediale Spiegelung bestätigt, bestärkt und durch die nötige Erhöhung der Dosis enthemmt wird“39. Meyer spricht vom Druck der Mediokrität im Sinne eines Drucks der Durchschnittsmeinungen und des durchschnittlichen Geschmacks. Er meint allerdings, dass die medialen Selektions- und Präsentationsregeln keinen determinierten Zusammenhang herstellten, so, dass sie die Aufnahme anderer Logiken und Gesichtspunkte prinzipiell ausschlössen. Die von Meyer angebotenen Möglichkeiten, den Zwängen der Medien zu entgehen, sind aber doch äußerst utopisch, mit wenig Chancen auf Umsetzung: intellektuell-aufklärerische Bürgerforen der Zivilgesellschaft (im Anschluss an Habermas); Veränderung des Mediensystems unter dem Zielwert der Angemessenheit im Hinblick auf Rhetorik und Theatralität; Stärkung der Verhandlung in wichtigen Institutionen wie Parteien, Regierungen, Ministerien etc. mit Schwerpunkt des Diskurses, der Argumentation, der Verständigung. Wie sollen mit solchen Ansätzen die vor allem auch ökonomisch bedingten Tendenzen wie Apodiktik, Dualismus der Aussagen, Freund-Feind-Verhältnisse, Konfliktdominanz, aggressive Moralisierung, Unterhaltung und Spektakel, Skandalisierung und Katastrophierung, Tabuisierung usf. in der medialen Welt begrenzt werden?
Grundsätzlich ist Folgendes zu bemerken: Der Maßstab für die Bewertung der Deformierung der Politik – jedenfalls in Gestalt politischer Werbung – ist augenscheinlich viel zu streng: diskursive Erfahrung der sozialen Welt, rationale Verständigung, argumentative Präsentation von Politik, dialogisches Verständnis, Deliberation, Trennung der Ebenen der Herstellung von Politik und des Darstellungshandelns. Auch wenn es zumeist nur um ein angemessenes Mehr geht, so sind doch viele der von Meyer aufgeführten Erscheinungen wie Stereotypisierung, Inszenierung, Personalisierung, Ästhetisierung seit der klassischen Rhetorik integrale Bestandteile politischen Handelns und nicht erst Erscheinungen der modernen Mediengesellschaft, jedenfalls soweit es um politische Rhetorik in Demokratien vor einem Massenpublikum geht; persuasive Rhetorik bedient sich grundsätzlich solcher Mittel, allerdings verdienen die spezifischen Ausprägungen und Funktionen in der modernen Mediengesellschaft durchaus Beachtung. Die Rhetorik ist jedenfalls seit Aristoteles ein ganzheitlicher Ansatz, der alle wesentlichen Dimensionen zur Gewinnung von Glauben bei einem Publikum einschließt und auch für die Analyse neuerer Entwicklungen taugt.
Auch das sog. Politainment40, also die Politik als Mischung von Information und Unterhaltung in den Medien, ist nicht völlig einseitig – wie so mancher intellektueller Kulturkritiker es tat – als Verfall zu deuten, im Sinne eines „großen Verblendungszusammenhangs“, als Vernachlässigung politischer Information, als Entpolitisierung durch Verlust der Deliberation, was in der Perspektive geschichtsphilosophischer und kulturkritischer Dekadenzbetrachtung als große Zerstörung, ja kollektive Gewalt wahrgenommen wird. Die politische Unterhaltungskultur zeichnet sich zwar vor allem aus durch Simplizität, Trivialität, Pointilisierung, Visualisierung, Personalisierung, Konflikthaftigkeit der Menschen und Vorstellungen, Erzeugung von Spaß und Spannung, spricht also zuvörderst emotionale Dimensionen an, aber sie hat zweifelsohne neben den negativen Auswirkungen speziell auf überzeugende Argumentation und Erläuterung komplizierter Sachverhalte auch positive: Gewinnung breiter Schichten der Bevölkerung für Politik und Reduzierung von Politikverdrossenheit, indem Politik sichtbar und sinnlich erfahrbar wird, Erzielung öffentlicher Aufmerksamkeit für politische Themen und Konstruktion politischer Vorstellungs- und Deutungsmuster, Vermittlung wichtiger Werte und Sinnverständnisse, die zur Konsensbildung und Integration der politischen Kultur beitragen, so vor allem im Bereich politischer Grundwerte und der Abgrenzung zu totalitären Ideologien.
Andererseits ist insbesondere als negativ zu vermerken, dass Tendenzen verbreiteter politischer Korrektheit auf die Ausblendung von Normen, Werten und Einstellungen drängen, indem vor allem dominante Mehrheitsmeinungen im Medienangebot sind, eine große Unentschiedenheit bei der Vielfalt von Angeboten und das Prinzip der Beliebigkeit, des „Anything goes“, herrschen, nicht selten eine fast grenzenlose Toleranz gegenüber Mainstream-Meinungen bzw. der großen Vielfalt von Lebensstilen und Interessen, Werten etc. eingefordert wird, unter Ausblendung konterkarierender Kritik; schon allein die ökonomische Orientierung der Medien an Einschaltquoten, Verkaufszahlen, Werbeeinnahmen legt ein solches Verhalten nahe, neben der die Meinungsvielfalt bedrohenden Unterhaltungskultur. Die kritischen Schlagworte lauten: Zerstörung des Politischen durch Vermeidung überzeugender Argumentation und der Erläuterung komplizierter Sachverhalte, Zwang durch politische Korrektheit und Verschweigen von Meinungen, „Terror“ der auferlegten Vielfalt und Offenheit für alles, Rezeption im Modus des Konsums in der Erlebnisgesellschaft. Hier treffen sich linksintellektuelle und konservative Kulturkritik, die Bewusstseinsindustrie entfalte durchaus destruktive Wirkungen mit ihrer Unterhaltungskultur, der „Interpenetration von Show- und Polit-Business“ (Dörner)41, der Symbiose zwischen Politikern, Medienmachern und Publikum, dem emotionalen Zugang zur politischen Welt.
Bei der Reflexion über politische Kultur und ihre Deformation wählt Erhard Eppler42 einen grundsätzlicheren, nämlich sprachkritischen Ansatz, indem er die Frage stellt, ob Sprache dem entgegenkommt, was den Erfordernissen und Aufgaben entspricht, vor allem in einer global ausgerichteten Risikogesellschaft, die sich nicht mehr so stark wie bisher von traditionellen Fortschrittsideen, Verwaltungsansätzen und dem Handeln in Stückwerksarbeit leiten lassen dürfe. Er beklagt insbesondere Mängel der Sprache an Präzision, Bildschärfe, Konkretheit, Differenzierung, Wirklichkeitsnähe, Verbindlichkeit, Ausdrucksstärke. Neue Handlungsnotwendigkeiten erforderten auch eine veränderte Sprache. Wandel der Herausforderungen und Wandel der Sprache bedingten sich wechselseitig. Eine Dominanz zu falschen Begriffsbesetzungen könnte dazu beitragen, den Druck auf die Politik, Kehrtwendungen vorzunehmen, zu reduzieren. Allerdings haben sich mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland in politischen Institutionen und bei der Bevölkerung zahlreiche ökologische Begriffe, Maßstäbe und Orientierungen herausgebildet, die sich aber leider häufig in einer apodiktischen, aggressiven, moralisierenden und auf Freund-Feind-Verhältnisse abstellenden und nicht verständigungsbereiten Sprache zeigen.
Die zivilisatorische Entwicklung hin zu einer modernen Gesellschaft und freiheitlich-demokratischen Ordnung wäre ohne Einschränkung von Emotionen, ohne „Affektdämpfung“, ohne Bändigung von destruktiven Kräften wie Hass, Wut, Aggression, gerade auch in verbal-rhetorischer Form, nicht möglich gewesen. Hass gilt als das Zerstörende, das Extreme, das sich im äußeren und inneren „Staatsfeind“ verkörpert, der in demokratischer Ordnung zum einzigen Objekt legitimen Hasses werden darf. Hass als Extremform der Verneinung und Lust auf „Vernichtung“ des anderen gilt ansonsten als infam und unterliegt starker Tabuisierung, ebenso auch andere Regungen wie Rache, unkontrollierter Zorn; es findet sich kaum jemand, der solche Dispositionen zu verteidigen oder zu propagieren bereit wäre. Sie sind niedrige Instinkte, die bestenfalls hingenommen werden dürfen (müssen), wenn Verstöße gegen grundlegende Prinzipien und Ordnungen freiheitlicher Gesellschaft erfolgen.
In extremen Ideologien finden sie jedoch Akzeptanz, ja sie werden geradezu eingefordert, zumeist für ausgegebene hohe und höchste Ziele wie Schutz von Volk und Nation, der Rasse, Klasse, von Weisen der religiösen Hingabe; Feindschaft gerät zu offenem Hass auf Personen und Gruppen, die als zutiefst verabscheuungswürdig dargestellt werden. Leidenschaftliche Verneinung des Feindes ist dann moralisch, wenn sie der Bewahrung hoher Werte dient. Maßhalten bezüglich der Affekte ist Verrat, Maßlosigkeit gegenüber dem Feind gehört zu den propagandistischen Postulaten.
Es gibt aber auch in unserer Demokratie außerhalb der Verurteilung von Extremismus häufig Hass, Zorn, Wut, die ein beachtliches Maß an Akzeptanz erfahren, vor allem in Gestalt demonstrativen Protests, wie der vielfach positiv besetzte Begriff des Wutbürgers signalisiert. Hier geht es zumeist nicht um Infragestellung fundamentaler Werte und Ordnungen, sondern um vehemente Kritik an einzelnen Vorhaben, Praktiken, Gestaltungen etc., wobei die sich als Gutmenschen Verstehenden einen hohen, ja überlegenen moralischen Status gegenüber anderen, zumeist schweigenden Mehrheiten beanspruchen, auch wenn es sich primär um eigene Interessen und Vorteile handelt. Der Glaube an den hohen Wert der vertretenen Sache ist unabdingbar, damit nicht die fanatische Gesinnung unglaubwürdig wird und selbst bei den Protestlern ein schlechtes Gewissen wachruft. Für solche Phänomene der öffentlichen Demonstration ist der Begriff des Protestes angemessen, der auf eine relativ sanfte Kultur rhetorischen Drucks hinweist.
Politische Führung wird heute herausgefordert durch in jüngster Zeit recht stark gewordene Protestformen und soziale Bewegungen wie beispielsweise Stuttgart 21, Occupy mit ihrer Kapitalismus- und Globalisierungskritik, Anti-Atomkraft-Demonstrationen, durch öffentlichen Dauerwiderstand gegen Flughafenausbau und Fluglärm, Piraten und Piratenpartei, vor allem auch durch Aktivitäten im Internet, das im Rahmen der vielfältigen öffentlichen Protestkultur zunehmend an Bedeutung gewinnt43. Die Formen des Protestes reichen von eher passiv-demonstrativen über provokativ-aktivistischen bis zu gewaltbereiten Protesten, und ganz unterschiedliche Ideen und Ziele liegen diesen Phänomenen zugrunde, oft in einer schwer zu entwirrenden Mischung: anarchistisch, kommunitaristisch, basisdemokratisch, antietatistisch und auf kleine Einheiten abstellend. Immer geht es um eine größere Partizipation im öffentlichen Raum, um eine Art demokratische Eroberung von unten nach oben, vielfach getragen von dem Leitmotiv „Empört euch!“. Der Bahnhof Stuttgart wurde zum Symbol für den Typus des neuen sog. Wutbürgers, der die Missachtung seiner Ziele für großes Unrecht hält und protestierend auf die Straße geht, oft über Wochen und Monate in regelmäßigen Zeitabständen, aber auch bei ganz konkreten Anlässen, wobei die Anliegen in einen Kontext mit hehren Werten wie Umweltschutz, Freiheitsrechten, Gesundheit, Lebensschutz etc. gebracht werden, man sich häufig nicht scheut, den eigenen Protest in großer Anmaßung in den Zusammenhang mit den Montagsdemonstrationen in Leipzig zu DDR-Zeiten oder den Befreiungsbewegungen in der arabischen Welt zu stellen, entsprechend Abscheu, Wut, Spott, Hass gegen Andersdenkende verbreitet, Starrsinn und Unbelehrbarkeit zeigt und sich des breiten Spektrums aggressiv-fanatischer Kommunikationsmittel bedient. Für die etablierten Parteien und die Regierungen werden diese unerbittlichen Wutbürger vor allem deshalb auch zu einem großen Problem, weil sich hier eine neue, breite Trägerschaft des Protests herausgebildet hat, deren Mitglieder in hohem Maße aus der Bevölkerungsgruppe der Mittelschicht, dem sog. Bürgertum, stammen. Neue Milieus der bürgerlichen Welt, die sich bisher weniger an öffentlichen Protesten in Gestalt von Straßendemonstrationen betätigt hatten, fühlen sich nun hier besser repräsentiert als in den offiziellen politischen Vertretungen. Augenscheinlich setzt eine neue Ära ein, wo sich viele Bürger auch mithilfe der neuen Medien und ihrer Vernetzungsmöglichkeiten in kurzer Zeit mobilisieren lassen. Es geht bei den Protestbewegungen um ganz verschiedene Bereiche wie beispielsweise neue Technologien, Veränderungen des vertrauten Ortsbildes, Überfremdung von Gebieten durch Migration oder Grundstücksspekulation, soziale Verwerfungen, Lärmbelästigungen, Naturschutz, Denkmalschutz, Teilhabe an Kommunikationsprozessen, Transparenz von Entscheidungen, neue Architektur, Großprojekte etc.
In den Vereinigten Staaten ist 2009 das Buch „Nimby Wars“ erschienen; Nimby – das ist die Abkürzung für „not in my backyard“, d. h. „nicht in meinem Hinterhof“, nicht in meinem Vorgarten, nicht in meiner Straße, meiner Stadt. Man ist also z. B. für die Windkraft, für den Ausbau der Elektrifizierung, für eine Umgehungsstraße, für Geothermie oder Pumpspeicherkraftwerke, für die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid, für die Endlagerung des Atommülls, für den Ausbau einer S-Bahn – aber bitte nicht bei mir, sondern beim Nachbarn, in anderen Orten, in anderen Städten. Selbst Umwelt- und Klimaschutz werden häufig zweitrangig, wenn man sich von Veränderungen negativ betroffen fühlt, sprich: Gar bei grüner Wertorientierung dominieren dann häufig Eigennutz und Egoismus. Trotzdem ist der sprachliche Habitus häufig sehr aggressiv und gewaltbesetzt.
In Demokratien geht es nicht einfach nur um Sachlichkeit von Politik, um Rationalität von Strategien, um empirisch fundierte, Objektivität beanspruchende Auffassungen und Handlungen, um plausible Begründungen in Argumentationen, sondern auch um Emotionen wie beispielsweise Leidenschaft, Empathie, Empörung, Angst. Gefühle motivieren Handlungen, unterliegen Wertvorstellungen und prägen Situationsdeutungen. Entsprechend zielt die politische Rhetorik nicht nur auf rationale Auseinandersetzung über Interessen, Normen und Werte, auf kognitive Konzepte der Bürger, sondern auch auf Emotionen; Herz und Verstand gehören eng zusammen im Streit über politische Gemeinschaft und Gemeinwohl; überzeugend sind seit der antiken Rhetorik solche Argumente, die sachlich überzeugen, aber auch die Menschen emotional berühren. Oft sind es Gefühle, die einem kognitiven Inhalt Bedeutsamkeit verleihen. Da aber Emotionen, so z. B. Patriotismus, Liebe zur Heimat, zivilreligiöse Leidenschaft, Opferbereitschaft für das Gemeinwesen etc., nicht selten zu gefährlichen Übertreibungen und extrem negativen Formen neigen, müssen sie dort ihre Grenze finden, wo sie zu Einbrüchen des Irrationalen führen, vernünftige Argumentation eliminieren, individuelle Freiheit und Menschenrechte bedrohen und im Medium der Gewaltsprache zu Bevormundungen, Zwängen und Unterdrückungen führen. Die Respektierung solcher Grenzen und die Bekämpfung und Ächtung von verbaler Gewalt gehören zu den Essentials freiheitlicher Ordnung.