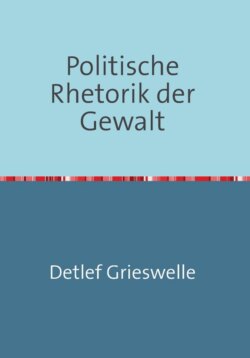Читать книгу Politische Rhetorik der Gewalt - Dr. Detlef Grieswelle - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Öffentlichkeit als Signatur freiheitlicher Systeme13
ОглавлениеAls zentraler Unterschied zwischen Diktaturen und freiheitlichen Systemen wird unter kommunikativen Aspekten die große Bedeutung von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung für demokratische Ordnungen herausgestellt. „Öffentlichkeit gehört zur verfassungsrechtlich gesicherten Grundausstattung der Demokratien“14. Ein öffentlicher Prozess geistiger Auseinandersetzung, in dem sich Meinungen frei bilden und verändern können, ist Voraussetzung für politischen Wettbewerb. Demokratie verlangt die Publizität öffentlicher Angelegenheiten. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 5 GG beinhaltet kennzeichnenderweise einen offenen, freien Meinungsmarkt, da erst dieser den für das Demokratieverständnis des Grundgesetzes konstitutiven politischen Wettbewerb ermöglicht15.
Öffentlich sind Kommunikationen, die allen Mitgliedern freier Gesellschaften zugänglich sind, die jeder verfolgen und an denen er sich beteiligen kann, bei denen sich private Abschirmung gegen Mitteilungen und Beobachtungen verbietet. Öffentlichkeit ist also ein Kommunikationsraum, in dem allgemeine Themen und Meinungen transparent gemacht werden, „die Gesellschaft spiegelt sich mit dem, was sie von sich gibt, im Medium der Öffentlichkeit16.“ Über öffentliche Kommunikation können sich die Akteure wechselseitig beobachten und durch ihre Handlungen in die Öffentlichkeit hineinwirken und Einfluss ausüben. Die Bürger haben die Chance, sich durch öffentliche Kommunikation über relevante Ereignisse, Themen und Meinungen zu informieren. Politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse von allgemeiner Relevanz gehen in der Regel unter öffentlicher Anteilnahme vor sich, politisch-soziale Verhältnisse und Veränderungen sind ständigen Rechtfertigungs- und Begründungszwängen in der Öffentlichkeit ausgesetzt. Permanentes „Hinterfragen“ wird zur Signatur moderner freiheitlicher Systeme, öffentliche Meinung ist das Korrektiv zu Macht und Herrschaft, d. h. das Wechselspiel zwischen öffentlicher Meinung und den politisch Mächtigen gehört zur Grundstruktur der Demokratie. Ansonsten würde ja den Bürgern die Mündigkeit im Sinne das Mundgebrauches beschnitten, sie wären im Wesentlichen nur Herrschaftsunterworfene. Die Demokratie unterstellt jedoch für alle Bürger eine grundlegende politische Mündigkeit, Besitz und Bildung oder andere soziale Kriterien sind nicht mehr entscheidend für die Zubilligung politischer Mündigkeit, Vormundschaft im Sinne von Aussperrung aus öffentlicher Kommunikation ist obsolet. Neben der Bedeutung des Begriffes der Öffentlichkeit als einer sozialen Handlungssphäre, die frei zugänglich ist und in der soziale Akteure sich an ein unabgeschlossenes Publikum wenden und der Beobachtung durch ein solches Publikum ausgesetzt sind, bezieht sich der Terminus auf allgemeine Angelegenheiten oder Aktivitäten, die Gegenstand kollektiver Verantwortlichkeit und Entscheidungen sind. Gedacht ist insbesondere an politische und Staatsangelegenheiten, an kollektive Probleme, die geregelt sind oder geregelt werden sollen. Die öffentliche Selbstverständigung ist freilich nicht zu beschränken auf unmittelbar entscheidungsbedürftige oder -fähige praktische Fragen; hierher gehören auch Debatten über moralische Prinzipien, grundlegende Werte, das Verhältnis zu kollektiven Vergangenheiten und Zukunftserwartungen. Peters17 fasst zusammen: „Öffentliche Diskurse behandeln praktische Fragen des kollektiven Zusammenlebens. Sie betreffen also nicht nur die Beurteilung objektiver Handlungsbedingungen, das heißt kognitive oder instrumentelle Probleme, sondern auch normative Fragen des Ausgleichs von Ansprüchen und Interessen und evaluative Probleme der Definition von kollektiven Werten und Aspirationen. Durch solche Diskurse sollen die Teilnehmer die Möglichkeit gewinnen, auch ihre eigenen Interessen und Ansprüche zu reflektieren und möglicherweise zu revidieren. Öffentliche Diskurse sollen nicht nur Meinungen bilden, sondern auch Motive prägen, zur kollektiven Willensbildung beitragen.“
Der Einfluss öffentlicher Meinung auf die Politik setzt voraus, dass das politische System, das für die Gesellschaft kollektiv verbindliche Entscheidungen erzeugt, so weit demokratisiert ist, um die Meinungen der Bürger ernst nehmen zu müssen. Die Bestimmung politischer Herrschaft auf Zeit durch regelmäßige allgemeine Wahlen ist die zentrale institutionelle Bedingung, um die Aufmerksamkeit der politischen Akteure für öffentliche Meinungsbildungsprozesse strukturell zu sichern. Politische Akteure müssen alles daransetzen, dass öffentliche Kommunikation in ihrem Sinne beeinflusst wird und ihre politischen Interessen sich durchsetzen bei der Bevölkerung. Die große Bedeutung der politischen Kommunikation in moderner Demokratie durch die Macht der Bürgerschaft als Elektorat hat schon Max Weber in seinem klassischen Aufsatz „Politik als Beruf“ zum Ausdruck gebracht, als er sagte, dass die „Politik nun einmal in hervorragendem Maße in der Öffentlichkeit mit den Mitteln des gesprochenen oder geschriebenen Wortes geführt wird“18; zwischen der Herrschaftsordnung und der Kommunikationsordnung einer Gesellschaft besteht also in der Regel ein enger Zusammenhang.
Die politische Ordnung in Demokratien ist ganz wesentlich gekennzeichnet durch den binären Code Regierung/Opposition, wie Luhmann formuliert: Die Herstellung und Durchsetzung kollektiv verbindlicher Entscheidungen lassen sich nur erreichen, wenn politische Akteure Positionen besetzen, die ihnen die Chance der Machtausübung geben. Politische Akteure handeln deshalb nach der Maxime, möglichst Regierungspositionen zu erringen und Oppositionspositionen zu vermeiden. Dazu bedürfen sie in Demokratien der Stimmen des Publikums, der Stimmen der Wähler: „Die Maximierung bzw. Optimierung von Wählerstimmen ist also das abgeleitete Ziel der Akteure, wenn sie die Regierungspositionen erringen bzw. erhalten wollen“19. Dazu machen sie politische Angebote, die von Personen, Äußerungen und Forderungen zu aktuellen Fragen über Beschlüsse und Entscheidungen bis hin zu Grundsatzpapieren, Partei- und Wahlprogrammen reichen und die ihnen möglichst viele Wählerstimmen einbringen. Die Akteure des politischen Systems beobachten sich selbst und die anderen Akteure vor allem über das Mediensystem und versuchen mit ihren kommunikativen Handlungen, das Bild von sich und den anderen Akteuren in der politischen Öffentlichkeit so zu gestalten, dass sie Aufmerksamkeit und Zustimmung beim Publikum gewinnen für die eigenen Positionen und Personen.
Gemessen an der früheren bürgerlichen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts und des räsonierenden Publikums der gesellig miteinander verkehrenden interessierten, informierten und gebildeten Privatleute hat sich die Öffentlichkeit in der modernen Massengesellschaft nicht nur zahlenmäßig ausgeweitet, sondern sich parteien- und verbändepluralistisch ungeheuer diversifiziert und in zahlreiche Machtkomplexe organisierter Teilöffentlichkeiten fragmentiert, die ihre Interessen an marktgängiger Publizität mit kommunikativer Professionalität verfolgen. Obwohl im Verständnis demokratischer Kultur die politische Mündigkeit nicht nur Einzelnen oder kleinen Gruppen zugestanden wird, sondern etwas darstellt, was alle zu gleichen Teilen besitzen, zeigen sich in der sozialen Wirklichkeit doch beträchtliche Chancenunterschiede für öffentliche Partizipation und Einflussnahme. Bei allen normativen Bedingungen politischer Öffentlichkeit wie Meinungs- und Informationsfreiheit, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit usf. und dem Verbot an den Staat, den Bürgern den „Mund zu verbieten“, ist öffentliche Meinungsbildung in hohem Maße an kollektive Organisationen und die Macht der Medien, Parteien und Verbände gebunden. Frei diskutierende Privatleute der bürgerlichen Öffentlichkeit sind nicht mehr in der Lage, politische Herrschaft zu kontrollieren und ihre Entscheidungen zu beeinflussen, es fehlt ihnen an Zeit, an Macht und Kompetenz; die Großorganisationen haben viel größere Durchsetzungschancen, sie haben sich der Öffentlichkeit bemächtigt, sie prägen die Willensbildung. Politische Diskussionen werden wenig von Privatleuten, sondern vor dem Publikum der Privatleute geführt, staatsbezogen agierende Mächte wie Parteien, Verbände und Massenmedien halten mit ihren professionellen Apparaten den Bereich der Öffentlichkeit weitgehend besetzt. Politisches Öffentlichkeitsmarketing ist vor allem Teil der Partei- und Staatsrollen, auch der großen Interessenorganisationen, insbesondere der Spitzenverbände. Zu den Akteuren der Interessenartikulation gehören auch kulturelle Einrichtungen, „public interest groups“, die Kollektivgüterinteressen vertreten (Umwelt, Verbraucherschutz), Kirchen, karitative Verbände, auch weniger organisierte und vermachtete soziale Bewegungen und spontane Vereinigungen.
Für eine rhetorische Betrachtungsweise über Öffentlichkeit und öffentliche Meinung trifft es sich gut, dass öffentlichkeitssoziologische Analysen20, wie wir sie diskutieren, dem rhetorischen Ansatz verpflichtet sind und sich häufig expressis verbis hierauf beziehen. Moderne Öffentlichkeit ist entsprechend diesem Modell ein relativ frei zugängliches Kommunikationsfeld, in dem Akteure (Sprecher) mit ihren Kommunikationsbeiträgen in der Regel über Massenmedien und ihre Foren/Arenen versuchen, beim Publikum Aufmerksamkeit und Zustimmung zu finden. Alle wesentlichen Fragen der Rhetorik wie das Sozialkapital eines Redners in Form beispielsweise von Prominenz und Prestige, die eingesetzten Thematisierungs- und Überzeugungsstrategien, verschiedene Kommunikationsstile, das Vertrauen des Publikums in Medien und Öffentlichkeitsakteure, die unterschiedlichen sozialen Strukturen und Segmentierungen des Publikums, die Bedeutung sozialer Netzwerke für die Meinungsbildung des Einzelnen usf. finden in der Öffentlichkeitssoziologie Beachtung. Besonders betont wird, dass in der modernen Mediengesellschaft die Grenzen des Publikums schwer bestimmbar sind, die prinzipielle Unabgeschlossenheit konstitutiv ist. Entsprechend ist in einem solchen Kommunikations-system die Meinungs- und Willensbildung schwer zu steuern. Weiterhin ist vor allem zu beachten, dass das Publikum, auf das sich die Interessen der Öffentlichkeitsakteure richten, in demokratisch-marktwirtschaftlich verfassten Ordnungen vor allem als Elektorat und Kundschaft strategische Bedeutung hat. „Die politischen Interessen ergeben sich für die Sprecher aus dem strategischen Stellenwert des Publikums als Elektorat, die ökonomischen Interessen für die Medien aus dem Umstand, dass das Publikum sowohl die eigene Kundschaft darstellt als auch die Kundschaft jener Interessenten enthält, für die die Medien als Werbeträger dienen. Insoweit stellt sich Öffentlichkeit für Sprecher und Medien als ein Markt dar, und dieser Markt wird bestimmt durch Konkurrenzen“21.
Außerdem gilt es festzuhalten, dass im Rahmen des Forumsmodells der soziologischen Öffentlichkeitstheorie „öffentliche Meinung“ nicht zu verstehen ist im Sinne individueller Einstellungen bzw. Meinungen der Bevölkerung, sondern von Meinungen, die in öffentlicher Kommunikation geäußert werden und die von einem mehr oder weniger großen Publikum wahrgenommen werden können. „Öffentliche Meinung“ bezieht sich also nicht auf Bevölkerungsmeinung, sondern auf medial vermittelte Meinungsäußerung von Sprechern vor einem Publikum. Weiterhin ist „öffentliche Meinung“ nicht einfach die Summe aller öffentlich geäußerten Meinungen, sondern jenes kollektive Produkt von Kommunikation, das durch Fokussierungen auf Themen und Synthetisierung von Meinungen hohe Konsonanzgrade aufweist, bisweilen sogar herrschende Meinung darstellt mit normativer Kraft, die also bei Abweichung eines Sprechers eine Mehrzahl anderer Sprecher zu Widerstand und Gegnerschaft veranlasst. Die Menschen bilden zwar ihre eigene Meinung in hohem Maße an der öffentlichen Meinung, sie orientieren sich dabei aber häufig nicht an der Wirklichkeit, sondern an ihren Eindrücken von öffentlicher Meinung und vor allem herrschender Meinung, und überschätzen oft sowohl deren Konsonanz wie auch deren Überzeugungskraft auf das Publikum.
Was nun die Akteure in moderner Öffentlichkeit betrifft, so ist es in der Regel eine Minderheit von Sprechern, die sich an eine große Mehrheit von Zuhörern wendet. Moderne Kommunikationsmittel haben Kommunikationszusammenhänge mit großen Teilnehmerzahlen ermöglicht, das bedingt per se eine Ungleichheit von Sprecher- und Hörerrollen.
Neben dieser fundamentalen Ungleichheit gibt es Ungleichheiten zwischen Sprechern, die als Asymmetrien in Kommunikationen bezeichnet werden. Drei Grundformen lassen sich unterscheiden. Zunächst einmal gibt es Ungleichheiten der Sichtbarkeit und Vernehmbarkeit, des jeweiligen Anteils am öffentlichen Raum; manche Teilnehmer sprechen häufiger oder länger als andere, erreichen einen größeren Adressatenkreis, empfangen mehr Aufmerksamkeit, bekommen also mehr Raum in der öffentlichen Sphäre. Zweitens gibt es Ungleichheiten des Einflusses, wobei Redemacht und Akzeptabilität von Aussagen auf der jeweiligen Überzeugungskraft der Rede, unabhängig von der Person, beruhen oder aber – wie häufig – auf Wahrnehmungen und Wertungen der Person bzw. ihrer Rollen und ihres sozialen Status, indem ihnen z. B. Wissen und Sachkompetenz, kollektive Repräsentation, moralische Führerschaft oder charismatische Qualitäten zugerechnet werden. Und drittens gibt es strukturelle Asymmetrien der Wissensverteilung in Kommunikationen, in Form von Informationsvorsprüngen in Themengebieten, von spezialisiertem Wissen, von kognitiven Stilen und Denkweisen etc.
Auch ist festzuhalten, dass soziale Stratifikations- und Machtstrukturen entscheidend die Einflusschancen bestimmen, vor allem die Verfügung über ökonomische Ressourcen und politische Machtpositionen. Die Verfügung über ökonomische Ressourcen ermöglicht es, eigene Botschaften über viele Kanäle zu verbreiten, Öffentlichkeitsspezialisten mit effektiver Formulierung und Präsentation zu beauftragen, Einrichtungen der Massenkommunikation auf direkte oder indirekte Weise zu beeinflussen. Politische Machtpositionen haben in der Regel beträchtliche Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, erhebliche Informationsmonopole und vor allem Aufmerksamkeitsvorteile. Die Medien erwarten ja Themen und Meinungen, mit denen sie beim Publikum Aufmerksamkeit gewinnen, die politischen Sprecher Publizität für die Durchsetzung ihrer Themen und Meinungen.
Die politischen Sprecher haben konsequenterweise den zentralen Code des Mediensystems Aufmerksamkeit/Nicht-Aufmerksamkeit zu beachten. Informationen aus der Umwelt des Mediensystems – auch aus der Politik – werden wesentlich nach diesem Kriterium selektiert. Die Faktoren für die Gewinnung von Aufmerksamkeit in den Medien sind mit dem Terminus der Nachrichtenwerte beschrieben worden. Genannt werden vor allem Werte wie Neuigkeit, Konflikthaftigkeit des Geschehens, hoher Status der Akteure, starke Veränderungen in Quantitäten, Unterhaltung, „human touch“, Sensation. „Nachrichtenwerte sichern die Aufmerksamkeit des Publikums und operationalisieren damit den Code des Systems oder in handlungstheoretischer Sprache: Sie sind Mittel zur Erreichung des übergeordneten Ziels der Aufmerksamkeitszentrierung und des Erhalts von Einschaltquoten und Auflagenhöhen“22. Allerdings unterscheiden sich die Medien, inwieweit auf Nachrichtenwerte als Selektionskriterien zurückgegriffen wird, und je nach ideologischer Ausrichtung der Medien dominieren unterschiedliche Inhalte und Formen zur Aufmerksamkeitsgewinnung, wobei vor allem die jeweiligen Teilöffentlichkeiten des angesprochenen Publikums die Kommunikation bestimmen. Der politische Kommunikator ist entsprechend in solche Kommunikationsbedingungen („constraints“) eingebunden, um Aufmerksamkeit und Zustimmung zu finden.
Der Erfolg eines Kommunikationsaktes hängt nach Auffassung der Öffentlichkeitssoziologie weiterhin vor allem davon ab, ob ein Sprecher über das sog. soziale Kapital von Prominenz und Prestige verfügt: „Dabei lässt sich Prominenz als die generalisierte Fähigkeit verstehen, Aufmerksamkeit zu erregen; der Prominente kann mit einem öffentlichen Interesse an sich selber und dann auch für seine Angelegenheiten rechnen. Prestige ist demgegenüber die mit Prominenz nicht unbedingt einhergehende generalisierte Fähigkeit, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Zustimmung zu erzeugen. Der Besitz von Prestige sichert situationsübergreifend (und deshalb generalisiert) überdurchschnittliche Überzeugungschancen“23. Prestige bewirkt vor allem, dass andere den Redner für eine vertrauenswürdige Informationsquelle halten und ihm „glauben“, auch wenn sie nicht in der Lage sind, die Informationen selbstständig zu verifizieren, bzw. sich nicht die Mühe machen wollen. „Vertrauen in die Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Sprecher und Kommunikateure ist eine wesentliche Bedingung für die Akzeptanz dessen, was sie sagen“24. Da Prominenz und Prestige knappe Güter darstellen, die mit Chancen für öffentliche Aufmerksamkeit und Zustimmung verbunden sind, entsteht zwischen den politischen Akteuren dauerhafte soziale Konkurrenz um diese sozialen Güter, und es kommt qua ihrer Verteilung zu Schichtungen im Ensemble der Öffentlichkeitsakteure.
Die Öffentlichkeitssoziologie hat innerhalb des Sprecherensembles, das sich zu politischen Angelegenheiten zu Wort meldet, Sprechertypen unterschieden, je nachdem, was bzw. wen sie vertreten. Peters25 beschreibt in einem Beitrag folgende Rollen: Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppierungen und Organisationen (vor allem Interessenverbände, Parteien, Regierungen); Advokaten, die im Namen von zumeist schwächeren und unverfassten Gruppen sprechen und mit Blick auf deren Interessen Plädoyers einbringen; Experten, Sprecher mit wissenschaftlich-fachlichen Sonderkompetenzen; Intellektuelle, die am kritischen Maßstab kultureller Werte sozial-moralische Sinnfragen aufnehmen und allgemeine Zeitdeutungen öffentlich machen; Journalisten als Kommentatoren, wenn sie nicht nur berichterstattend tätig sind, sondern sich mit eigenen Meinungen zu Wort melden. Einhellig wird in den verschiedenen Arbeiten der Öffentlichkeitssoziologie konstatiert, dass die Repräsentanten im Zentrum der politischen Macht, der großen Interessenverbände und der Medien in der modernen Arena der Öffentlichkeitsakteure überrepräsentiert sind.
In welchem Maße sich Öffentlichkeitsakteure mit ihren Beiträgen in öffentlichen Arenen durchsetzen, hängt nicht nur von den Sprechern und Medien ab, sondern entscheidend vom Publikum, bei dem die Sprecher Aufmerksamkeit und Zustimmung für sich und ihre Aussagen erwarten. Das Publikum ist als Adressat der Kommunikation die Öffentlichkeit konstituierende Bezugsgruppe, wobei die Publikumsbeteiligung von zahlreichen Faktoren wie Einschätzung der Sprecher und Medien, den Sozialstrukturen des Auditoriums, seinen Bedürfnissen und Interessen, von Themen und Meinungen sowie Kommunikationsstilen der Akteure und Medien, der Wahrnehmung öffentlicher Meinung und demoskopisch ermittelter Bevölkerungsmeinung und vielem mehr abhängt.
Unabhängig von solchen spezifischen Selektivitätsmustern ergeben sich aus den Merkmalen der Öffentlichkeit allerdings einige allgemeine Kennzeichen für jedes moderne Publikum. Bei der Größe des Publikums ist in der Regel von dem Übergewicht von Laien auszugehen, d. h. von Nicht-Fachleuten im Hinblick auf die behandelten Themen. Folglich müssen sich die Öffentlichkeitsakteure auf eine begrenzte Verständigungsfähigkeit des Publikums einstellen. Zusätzliche Schwierigkeiten für eine überzeugende Kommunikation ergeben sich aus der Heterogenität des Publikums, das sich zwar häufig nach Sprache, Medium, Themen und Meinungen segmentiert, aber selbst dann noch höchst unterschiedliche Bezugsgruppen wie Junge und Alte, Männer und Frauen, Gebildete und weniger Gebildete, Linke und Rechte umfasst mit ihren unterschiedlichen Einstellungen, Interessen und Wertungen. In der Politik sehen sich Sprecher zumeist Anhängern, Gegnern und „Neutralen bzw. Unentschiedenen“ gegenüber, und da ist es schwierig, die jeweilige quantitative Verteilung dieser Gruppierungen zu eruieren und entsprechend den Hauptzielen Kommunikationsinhalte und „Stile“ an einer Gruppe auszurichten, weil auch auf die anderen „publics“ Rücksicht zu nehmen ist. Weiterhin gilt, dass trotz eines vorherrschend schwachen Organisationsgrades des Publikums soziale Netzwerke als intermediäre Strukturen das Publikum und dessen Rezeption öffentlicher Meinung beeinflussen.
Ein fundamentales Problem für moderne Öffentlichkeit stellen die große Bedeutung kognitiven Wissens und die äußerst differenzierten Verteilungsmuster der Verfügung über solches Wissen dar. Moderne Wissenschaft und Fachdisziplinen erzeugen spezielles Wissen, kognitive Stile und Diskursweisen, die beim Publikum in der Regel nicht vorausgesetzt werden dürfen. Das Publikum muss sich auf Urteile und Empfehlungen beziehen, die in den spezialisierten Handlungssystemen hervorgebracht werden und sich in hohem Maß selbst regulieren und kontrollieren, was eine gewisse Zuverlässigkeit von Ergebnissen verbürgt. Durch „checks“ und „balances“ zwischen Experten kann der Kenntnisstand eines Publikums gehoben und die Urteilskraft gestärkt werden. Außerdem gibt es Bereiche, in denen das Publikum viel eher mitsprechen kann, so z. B. in moralischen und sonstigen evaluativen Fragen, die ja gerade in der Politik hohes Gewicht haben.
Politische Kommunikation steht vor dem Dilemma, dass Aufmerksamkeit hierfür ein knappes Gut darstellt. Knappheit ist eine Größe, die sich aus dem Verhältnis zwischen mobilisierbaren Ressourcen wie Wissen, Zeit, Energie und wahrgenommenen alternativen Verwendungsmöglichkeiten ergibt. Die Beschäftigung mit politischen Angelegenheiten tritt in Konkurrenz zu anderen Lebensinhalten, bei zunehmend disponibler Zeit vermehren sich auch die alternativen Möglichkeiten. Außerdem haben die Anlässe öffentlichen Engagements außerordentlich zugenommen, „der Gegenstandsbereich öffentlicher Kommunikation ist enorm gewachsen. … Die Verwendungsmöglichkeiten für öffentliche Aufmerksamkeit steigen entsprechend“26, das Problem der Knappheit von Aufmerksamkeit und die Notwendigkeit der Selektion nehmen zu. Dies auch deshalb, weil der Schwierigkeitsgrad vieler öffentlicher, so auch politischer Themen angestiegen ist und trotz gewachsener durchschnittlicher Kompetenz des Publikums häufig Grenzen der intellektuellen Verarbeitungskapazität erreicht werden. Das Kapazitätsproblem verändert sich zwar durch die interne Differenzierung des Publikums in Teilöffentlichkeiten („publics“), es gibt viele öffentliche Agenden, also eine Vielzahl von Themen und Politikbereichen. „Gleichwohl lässt sich sagen, dass die Verarbeitungskapazität der Öffentlichkeit sehr beschränkt ist relativ zur Zahl und Komplexität von Themen, die gemessen an modernen kulturellen Standards potenziell relevant sind für öffentliche Diskurse. Eine sehr restriktive Auswahl von Themen ist unvermeidlich, und der Auswahlprozess kann offensichtlich nicht einfach die Form einer Tagesordnungsdebatte haben, in der die gesamte Öffentlichkeit sich nach Prüfung möglicher Themen ein Urteil über die Prioritäten der Debatte bildet. Es muss also Formen oder Mechanismen der Auswahl von Themen und der Steuerung von Aufmerksamkeit geben, die anders wirken“27.
In der politischen Soziologie wurde in der Vergangenheit vielfach betont, dass die Politikvermittlung in westlichen Demokratien immer bedeutsamer geworden sei. „Diesen Wandel kann man beschreiben als zunehmende Bedeutung politischer Öffentlichkeit in ihrer Funktion als Beobachtungssystem von Politik und in der Folge als eine Zunahme von Handlungen des politischen Systems im Hinblick auf den Bedeutungszuwachs von politischer Öffentlichkeit“28. Eine wesentliche Ursache hierfür ist ein Wandel der Publikumsrolle im politischen System. Schlagwortartig seien folgende Merkmale genannt: Erhöhung des Bildungsgrades der Bevölkerung und Verbesserung wirtschaftlich-sozialer Lagen mit der Konsequenz gewachsener Beobachtungskompetenz und gewachsener Interessen an Politik – fast alle Bürger der Bundesrepublik beobachten tagtäglich das politische Geschehen in der Gesellschaft; vermehrte Staatstätigkeit und Steigerung der Menge kollektiv verbindlicher Entscheidungen, damit gestiegene Aufmerksamkeit für das politische System; kontinuierliche Erweiterung des Programmangebots, auch an politischen Informationen, vor allem durch Zulassung privater Sender und dementsprechende Einbeziehung politischer Öffentlichkeitsakteure; Wertewandel und Auflösung sozialstruktureller Milieus, Pluralisierung und Individualisierung – vor allem nachlassende Bindung an politische Gruppierungen, mit der Konsequenz eines wachsenden Bedarfs an Überzeugungskommunikation und der Erzeugung von Zustimmung zu Programmen und Entscheidungen. Die gesellschaftliche Entwicklung ist gekennzeichnet durch die abnehmende Verbindlichkeit von Traditionen, reduzierte soziale Kontrollen, eine erhöhte Bereitschaft, sich bietende Wahlfreiheiten zu nutzen, durch eine entsprechende Pluralisierung der Lebensstile. In der Politik zeigen sich diese Entwicklungen ebenfalls in der Weise, dass tradierte politische Milieus aufweichen und soziale Gruppenbezüge für politische Orientierung und Meinungsbildung an Bedeutung verlieren. Wachsende Wahlenthaltungen, ein beweglicheres Wahlverhalten und konsequenterweise weniger Stammwähler, Stagnation oder gar Schrumpfen der Mitglieder in den großen Volksparteien beweisen die nachlassende Bindungskraft in der Politik und eine eher instrumentelle bzw. stimmungsabhängige, gefühlsbetonte Einstellung der Bevölkerung.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der öffentlichkeitssoziologische Ansatz mit dem rhetorischen Paradigma auch insofern Gemeinsamkeiten hat, als hier von so manchem Autor an Kommunikationsstrukturen und eine Sphäre öffentlichen Handelns gedacht wird mit bestimmten anspruchsvollen Merkmalen und Funktionen. Hier werden nämlich Kriterien in einem Modell von Öffentlichkeit entwickelt wie die Inklusion möglichst aller Beteiligten in die öffentliche Kommunikation, die Reziprozität von Hörer- und Sprecherrollen in den Beziehungen, eine weitgehende Offenheit für Themen und Beiträge, eine adäquate Kapazität der öffentlichen Sphäre zur Bearbeitung von Problemen und schließlich eine „diskursive“ Struktur der Debatten. Die öffentlichen Kommunikationen in solch hochwertigen Diskursen sollen zu reflektierten Überzeugungen und Urteilen des Publikums und zu rationalen politischen Entscheidungen führen. „Auseinandersetzungen über Problemdefinitionen und Lösungsvorschläge werden mit Argumenten ausgetragen, die Anspruch auf eine kollektive Akzeptanz erheben, welche auf geteilter, zwanglos erzielter Überzeugung beruht“29. Die diskursive Kommunikation erfolgt mit Bezug auf andere Akteure, mit Begründungen auf einem hohen Rationalitätsniveau; Resultate sind der Konsens oder eine argumentativ gestützte Mehrheitsmeinung, Legitimität der Entscheidungen und Gemeinschaftsbildung durch Diskurs. Bisweilen wird eine diskursive Öffentlichkeit in Verbindung gebracht mit bürgernahen individuellen oder kollektiven Akteuren sog. Zivilgesellschaft (zu denen das sog. politische Zentrum und die großen Interessenverbände nicht hinzuzählen), die die Öffentlichkeit dominieren sollen. Habermas unterscheidet eine „autochthone“ von einer „vermachteten“ Öffentlichkeit, wobei bei ersterer vor allem an soziale Bewegungen, freiwillige Assoziationen und informelle Milieus gedacht wird.
Gegen solche normativen Konzepte von Öffentlichkeit gibt es vielerlei berechtigte Einwände, die wichtigsten seien kurz genannt:
1 Das geforderte hohe Maß an politischer Teilnahme und Initiative im politischen Prozess ist illusorisch, weltfern und mit moderner Demokratie nicht vereinbar. Dahrendorf hat schon sehr früh in einer „grenzenlosen“ aktiven Öffentlichkeit aller Bürger einen fundamentaldemokratischen Irrtum gesehen. Dahrendorf unterscheidet in seiner bereits klassisch gewordenen Definition zwischen aktiver, latenter und passiver Öffentlichkeit und kann in hoher politischer Teilnahme keineswegs ein Zeichen „gesunder“, also gefestigter und verlässlicher politischer Verhältnisse erkennen, vielmehr signalisiere sie politische Störungen oder politischen Zwang. Ein erhebliches Maß an politischer Teilnahmslosigkeit gehe durchaus mit repräsentativer Demokratie zusammen, ja sei sogar wünschenswert: „Initiative verlangt Initiatoren (und natürlich Realisierung Realisatoren und Kontrolle Kontrolleure). Dass alle prinzipiell Berechtigten dies leisten, ist unwahrscheinlich, zu fordern, dass alle prinzipiell Berechtigten es leisten sollen, ist für den politischen Prozess hinderlich, wenn nicht vernichtend“30.
2 Zur Politik gehört auch, dass viele Fragen sich nicht durch Konsens bzw. Kompromissfindung lösen lassen, sondern durch Mehrheitsentscheid.
3 Die Akteure im Zentrum der Politik sind in hohem Maße durch Wahl legitimierte Akteure, und es gibt in den verschiedenen Verfahren der Interessenvermittlung wahrscheinlich kein gerechteres Verfahren der Interessenabbildung als das des allgemeinen und gleichen Wahlrechts: „Insofern können die kollektiven Akteure, die durch Wahlen legitimiert sind, auch eine besondere Legitimation in der Öffentlichkeit für sich reklamieren“, meint Gerhards31.
4 Eine diskursiv begründete Mehrheitsmeinung kann für sich nicht mehr Legitimation beanspruchen als eine Mehrheitsmeinung, die ohne anspruchsvollen Diskurs zustande gekommen ist: „Der öffentlich aggregierte Gesamtwille ergibt sich aus der Aggregation der Individualmeinungen. Qualitätskriterien zur Beurteilung der öffentlichen Äußerungen werden abgelehnt, weil sie eine Instanz der Beurteilung voraussetzen, die jenseits der Individuen liegt“32.
5 Die Akteure des sog. politischen Zentrums und der großen Interessenverbände werden systematisch diskriminiert, weil ihnen die den Sprechern der autochthonen Zivilgesellschaft zugeschriebenen Qualitäten wie Spontaneität, Kreativität, Diskursivität, Freisein von Ideologie und speziellen Organisationsinteressen abgesprochen werden. Es wird ohne Begründung von einem hohen Rationalitätsniveau der „autochthonen“ gegenüber den „vermachteten“ Öffentlichkeiten ausgegangen, obwohl die Praxis häufig das Gegenteil zeigt.
6 Politik kann in der sozialen Wirklichkeit nicht vor allem aus Deliberation und aufgeklärtem Diskurs bestehen, sondern auch aus Expressivität und symbolischer Aggression in Form von Verlautbarung und Propaganda. Das Publikum gelangt nicht nur über diskursive Kommunikation zu reflektierten Meinungen, sondern auch über die Transparenz der Vielfalt vorgetragener Meinungen, auf welchen Überzeugungsmitteln sie auch im Einzelnen beruhen.
Trotz der Ablehnung der in Teilen der Öffentlichkeitssoziologie aufgestellten rigiden Forderungen an politische Kommunikationen bedeutet das keineswegs, dass es eines Fundaments an Normen und ihrer Einhaltung nicht bedürfte. Die Öffentlichkeitssoziologie hat zahlreiche Defizite in der politischen Kommunikation in demokratischen Ordnungen herausgearbeitet, die nicht auf politikfernen-utopischen Urteilen beruhen und unter dem Terminus symbolischer Aggression oder Gewalt subsumiert wurden; genannt seien Strategien wie Beleidigung, Signalisierung von Verachtung und Feindschaft, Täuschung und Manipulation, Motivverdächtigung, unangemessene moralische Aufladung. Da sich Kommunikationen in freier Gesellschaft vor allem in der Form der Auseinandersetzung um Personen und politische Positionen vollzieht, wurden die Fragen der normativen Postulate an politische Kommunikation in der Hauptsache unter dem Begriff der Streitkultur diskutiert.