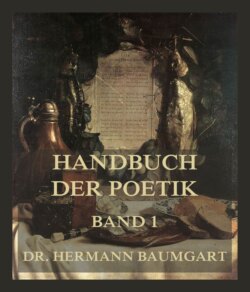Читать книгу Handbuch der Poetik, Band 1 - Dr. Hermann Baumgart - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort.
ОглавлениеFür den Kundigen bedarf es nicht des Hinweises auf die fast unüberwindlichen Schwierigkeiten der Aufgabe, eine "Theorie der Dichtkunst" aufzustellen, zu deren Lösung hier ein Versuch gemacht ist; gibt es doch auf diesem Gebiete kaum einen einzigen Satz von unbestritten geltendem Ansehen. Nur in einem Punkte dürfte Einigkeit herrschen, dass ein rein deduktives Verfahren dabei nicht zum Ziele führen kann, sondern dass allein auf dem Wege der kritischen Untersuchung des Vorhandenen Resultate zu erhoffen sind. Eine solche, nach einheitlichen Gesichtspunkten verfahrende Kritik kann aber nicht anders als unter steter Berücksichtigung der historischen Entwicklung sowohl der poetischen Produktion als der zu den verschiedenen Zeiten für dieselbe maßgebenden Theorien angestellt werden. Demgegenüber möchte es als ein Widerspruch erscheinen, dass diese Darstellung den Anspruch macht, für ein "Handbuch der Poetik" zu gelten. Ein solches müsste die Hauptgesetze der Dichtkunst und die Beantwortung der wichtigsten dieselben betreffenden Fragen in übersichtlicher Zusammenstellung dem Leser darbieten. Wer jedoch, mag er nun den Wissenden oder den Suchenden und Lernenden sich zurechnen, wird es bezweifeln, dass eine kompendiarische Anordnung von Formeln der Poetik wertlos bleiben müsste, sobald nicht jeder kleinste Teil derselben durch eingehende Begründung Leben und gesicherten Bestand erhielte? Das Gebiet der Poetik ist so beschaffen, dass hier jeder Schritt ohne die immer erneute Prüfung und Orientierung nach allen Seiten einer ganzen Schar von Missverständnissen ausgesetzt wäre.
Der Verfasser hat es daher versucht, die kritisch-historische Darstellung überall bis zu einem bestimmt formulierten Ergebnis zu führen, so dass als Gesamtresultat eine Zusammenordnung der Hauptsätze der Poetik sich ergibt, deren jeder in der Entwicklung des Ganzen als der Abschluss eines organischen Teiles gedacht ist.
Er hat es versucht — voluit! — im Vertrauen auf die ihn selbst mit voller Überzeugung durchdringende Kraft der aristotelischen Grundauffassung von der Einheit der künstlerischen Nachahmung und von der einzigen Richtigkeit der aristotelisch-lessingschen Untersuchungsmethode. Wenn jedoch Lessing seinem Laokoon als Motto das Plutarchische Wort von den Künsten voranstellte, dass sie nach den Mitteln und nach der Art und Weise der Nachahmung sich unterscheiden — ὕλῃ καὶ τρόποις μιμήσεως διαφέρουσιν — so unterließ er es, den nicht minder gewichtigen Schluss hinzuzufügen: τέλος ἕν ὑπόκειται — das Ziel der künstlerischen Nachahmung ist ein einheitliches, für alle Künste ein und dasselbe.
Daher sind auch die Gesetze der Künste einheitlich und ewig. Die Unterschiede der Nationen und Zeiten reihen sich nur den Verschiedenheiten ein, die an sich schon je nach den Mitteln der Nachahmung für die Art und Weise, wie sie zu geschehen hat, von selbst gegeben sind. Daher die innere, engste Verwandtschaft, der mächtige Zug der Wesensgleichheit, der alle die miteinander verbindet, die zu allen Zeiten und an allen Orten das Größte in der Kunst hervorgebracht haben. Dadurch aber waren sie die Größten, dass in ihrem Geist und Gemüt jene Einheit als eine unerschütterliche Gewissheit feststand, die nach dem ewig sich gleichbleibenden Ziele sie immer wieder den gleichen Weg finden lassen musste.
Diese Wege in den verschiedenen Gattungen der Kunst zu erkennen, ist die Aufgabe einer produktiven Kritik; ihre unabänderlichen Gesetze festzustellen muss die Theorie der Kunst bestrebt sein. Was das Genie als ein göttliches Vermögen in sich trug, demgemäß es sich schaffend betätigte, soll sie in seinen Äußerungen betrachten und das Gleichmäßige, immer Wiederkehrende darin, soweit es erkennbar ist, in festen Normen aussprechen. Es ist nicht erweisbar, dass ein Homer, ein Aischylos, Sophokles oder Shakespeare bei ihrem Dichten mit klarem Bewusstsein solchen festen, theoretischen Normen gefolgt sind: wohl aber müssen dieselben, wenn sie richtig erkannt sind, überall in den Meisterwerken des Genies wiedergefunden werden; sie müssen daher ebenso wohl das Verständnis der Kunstwerke zu eröffnen vermögend sein, ihren Genuss zu vertiefen, das ästhetische Urteil über das Beste wie über das Minderwertige zu begründen, als die künstlerische Produktion selbst auf ihrem Wege zu leiten und vor dem Abirren zu sichern. So hat sich Aristoteles den Griechen, Lessing den Deutschen, so haben beide sich der Welt als Lehrer und Führer erwiesen.
Der größte Dichter der Neuzeit, in welchem die spontan schaffende Kraft des Genius am stärksten erscheint, war am meisten von dem Werte der Theorie für die Kunst durchdrungen. "Es ist weit mehr Positives, das heißt Lehrbares und Überlieferbares in der Kunst, als man gewöhnlich glaubt," lautet ein Wort von Goethe. Und ganz wie Aristoteles sucht er den Schlüssel für die Erkenntnis der Kunstgesetze in der Kenntnis der menschlichen Seele. Davon handelt eine schöne Stelle des inhaltreichen Aufsatzes "Der Sammler und die Seinigen" in dem Gespräch zwischen dem "Philosophen" und dem "Gaste":
Gast: "Ich will über Poesie nicht entscheiden.
Philosoph: Und Ich nicht über bildende Kunst.
G. Ja, es ist wohl das beste, dass jeder in seinem Fache bleibt.
Ph. Und doch gibt es einen allgemeinen Punkt, in welchem die Wirkungen aller Kunst, redender sowohl als bildender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesetze fließen.
G. Und dieser wäre?
Ph. Das menschliche Gemüt.
G. Ja, ja, es ist die Art der neuen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boden zu spielen, und bequemer ist es freilich, die Welt nach der Idee zu modeln, als seine Vorstellungen den Dingen zu unterwerfen.
Ph. Es ist hier von keinem metaphysischen Streite die Rede.
G. Den Ich mir auch verbitten wollte .... Wie wollen Sie auch den wunderlichen Forderungen dieses lieben Gemütes genug tun?
Ph. Es ist nicht wunderlich, es lässt sich nur seine gerechten Ansprüche nicht nehmen. Eine alte Sage berichtet uns, dass die Elohim einst untereinander gesprochen: Lasset uns den Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei! Und der Mensch sagt daher mit vollem Recht: Lasset uns Götter machen, Bilder, die uns gleich seien!
G. Wir kommen hier schon in eine sehr dunkle Region.
Ph. Es gibt nur ein Licht, uns hier zu leuchten.
G. Das wäre?
Ph. Die Vernunft.
G. Inwiefern sie ein Licht oder Irrlicht hat, ist schwer zu bestimmen.
Ph. Nennen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forderungen ab, die der Geist an ein Kunstwerk macht! Eine beschränkte Neigung soll nicht nur ausgefüllt, unsere Wissbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Kenntnis nur geordnet und beruhigt werden: das Höhere, was in uns liegt, will erweckt sein, wir wollen verehren und uns selbst als verehrungswürdig fühlen.
G. Ich fange an, nichts mehr zu verstehen ... Was wäre denn jenes Höhere?
Ph. Das Göttliche, das wir freilich nicht kennen würden, wenn es der Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrechte.
G. Ich behaupte immer meinen Platz und lasse Sie in die Wolken steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen den hohen Stil der griechischen Kunst bezeichnen, den Ich aber auch nur insofern schätze, als er charakteristisch ist.
Ph. Für uns ist er noch etwas mehr; er befriedigt eine hohe Forderung, die aber doch noch nicht die höchste ist.
G. Sie scheinen sehr ungenügsam zu sein.
Ph. Dem, der viel erlangen kann, geziemt, viel zu fordern. Lassen Sie mich kurz sein! Der menschliche Geist befindet sich in einer herrlichen Lage, wenn er verehrt, wenn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zustand nicht lange verharren; der Gattungsbegriff ließ ihn kalt, das Ideale erhob ihn über sich selbst; nun möchte er in sich selbst wieder zurückkehren, er möchte jene frühere Neigung, die er zum Individuo gehegt, wieder genießen, ohne in jene Beschränktheit zurückzukehren, und will auch das Bedeutende, das Geisterhebende nicht fahren lassen. Was würde aus ihm in diesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht einträte und das Rätsel glücklich löste! Sie gibt dem Wissenschaftlichen erst Leben und Wärme, und indem sie das Bedeutende, Hohe mildert und himmlischen Reiz darüber ausgießt, bringt sie es uns wieder näher. Ein schönes Kunstwerk hat den ganzen Kreis durchlaufen; es ist nun wieder eine Art Individuum, das wir mit Neigung umfassen, das wir uns zueignen können.
G. Sind Sie fertig?
Ph. Für diesmal! Der kleine Kreis ist geschlossen; wir sind wieder da, wo wir ausgegangen sind; das Gemüt hat gefordert, das Gemüt ist befriedigt, und Ich habe weiter nichts zu sagen."
Dazu noch ein Wort, das Goethe einmal an seinen Freund Schiller schreibt: "Lust, Freude, Teilnahme an den Dingen ist das einzige Reelle, und was wieder Realität hervorbringt; alles andere ist eitel und vereitelt nur."
Königsberg, i/Pr., Ostern 1887.