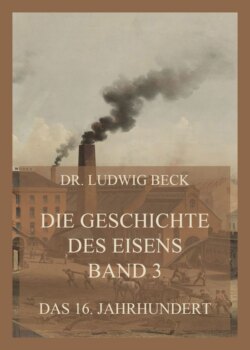Читать книгу Die Geschichte des Eisens, Band 3: Das 16. Jahrhundert - Dr. Ludwig Beck - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SCHRIFTSTELLER DES SECHSZEHNTEN JAHRHUNDERTS.
ОглавлениеGeorg Agricola.
Wenden wir uns zu dem Leben und Wirken des Mannes, den man mit Recht den Vater der Mineralogie und mit noch höherem Recht den Vater der Metallurgie nennt, der zuerst die reichen Schätze empirischer Kenntnisse auf diesen beiden Gebieten der Naturwissenschaft mit philosophischem Geist durchdrungen und in lichtvoller Ordnung behandelt hat.
Georg Bauer, der als Schriftsteller nach der Sitte der Zeit seinen Namen latinisierte und sich Georgius Agricola nannte, wurde am 24. März 1494 zu Glauchau in der Grafschaft Schönburg geboren. Er erwarb sich eine gründliche humanistische Vorbildung, doch trat schon früh eine entschiedene Neigung für die Naturwissenschaften bei ihm zu Tage. Nachdem er sich für das Lehrfach entschlossen hatte, wurde er bereits 1518 Rector extraordinarius für die griechische Sprache bei der „großen Schule“ in Zwickau.
Eine grammatische Abhandlung, die er 1520 schrieb, erregte Aufsehen und brachte ihn mit namhaften Gelehrten in Verbindung, namentlich mit Petrus Mosellanus, der damals als Professor in Leipzig wirkte. Dieser bestärkte Agricola in seinem Streben, sich noch weiter auszubilden. Zu diesem Zweck gab derselbe 1522 seine Stelle in Zwickau auf und bezog die Universität Leipzig als Lektor bei Petrus Mosellanus. Dieser Aufenthalt war entscheidend für seine künftige Richtung. Durch seinen eigenen Genius, wie durch den Geist der Zeit zum Studium der Natur hingezogen, widmete er sich der Medizin und der Chemie. Sein Trieb zu noch gründlicherer Ausbildung, sowie des Mosellanus Tod veranlassten ihn, nach zweijährigem Aufenthalt im Jahre 1524 Leipzig zu verlassen und in das gelobte Land der Wissenschaften — insonderheit der Naturwissenschaft — nach Italien zu ziehen.
Daselbst verbrachte er über zwei Jahre auf den berühmten Universitäten von Bologna und Padua im eifrigen Studium besonders der Medizin und Philosophie. Agricola erwarb sich dort den medizinischen Doktorhut, sowie viele hochgebildete Freunde. Auf seiner Rückreise von Italien kam er, angezogen von den reichen Mineralschätzen des Erzgebirges, nach der rasch erblühten Bergstadt Joachimsthal in Böhmen, und ließ sich auf den Rat von Freunden daselbst als Arzt umso lieber nieder, als er hier die beste Gelegenheit fand, seinem Lieblingsstudium, der Mineralogie, nachzugehen. Sein Interesse für die Mineralogie stand in unmittelbarer Verbindung mit seinem medizinischen Beruf. Er war überzeugt, dass ein gründliches Studium der Mineralien das beste Mittel sei, den Arzneischatz zu vermehren und zu verbessern. Er schreibt selbst: „Diese Lücke in der Heilkunde“ — nämlich, dass man die Heilmittel nicht sorgfältiger studiere, was nur da richtig geschehen könne, wo sie in der Natur vorkämen — „war vorzüglich der Grund, der mich bewog, einen Bergort zu meinem Aufenthalt zu wählen.“
Aber der mächtige Eindruck, den das praktische Leben in dem rührigen, silberreichen Joachimsthal auf ihn machte, weckte bei dem strebsamen Gelehrten ein ganz neues Interesse. Er sah, welche mannigfachen Kenntnisse und welche Erfahrung zur Anlage und zum Betriebe der Bergwerke, zum Ausschmelzen und zur Scheidung der Metalle nötig sind, und er erfasste diese Seite der praktischen Naturwissenschaft mit dem ganzen Feuer seines strebsamen Geistes. Sieben Jahre blieb er in Joachimsthal, neben medizinischen und klassischen Studien hauptsächlich mit Mineralogie beschäftigt in fast täglichem Umgange mit bergwerkskundigen, praktischen Männern, wie dem Hüttenschreiber Lorenz Bermann und dem reichen Gewerken Bartholomäus Bach. Dieser Anregung entsprang die 1528 veröffentlichte originelle Schrift „Bermannus sive de re metallica“, eine in klassischer, dialogisierender Form gehaltene lateinische Schrift über Bergbau und Hüttenkunde. Dieses Büchlein erlebte zahlreiche Auflagen und Übersetzungen, darunter die bereits genannte von Schmid (Freiberg 1806).
Bermannus erweckt in vieler Hinsicht unser Interesse. Fesselt zunächst die Form, das lebendige Gespräch, so erfreut bald noch mehr der reiche Inhalt und die glückliche Verbindung der klassischen Überlieferung mit der praktischen Gegenwart. Diese ist in genialer Weise durch die dramatische Form erreicht. Bermannus, der Joachimstaler Freund des Agricola, der erfahrene Praktiker, erörtert die wichtigsten auf Bergbau und Hüttenkunde bezüglichen Fragen, mit zwei in den Schriften der Alten wohlerfahrenen Medizinern Johannes Nävius und Nikolaus Ancon, und obwohl der eine seinen empirischen Standpunkt, die andern beiden die gelehrte Theorie konsequent festhalten, finden sie sich doch am Ende immer zusammen, indem die Kenntnisse des einen die der andern ergänzen, bestätigen und erweitern. So soll die kleine Schrift zugleich ein Beweis dafür sein, wie wichtig das Zusammenwirken von Praxis und Theorie ist. Zugleich ist sie eine liebenswürdige Huldigung, die Agricola, seinem Freunde Bermann, dem er seine Worte in den Mund gelegt und dessen Namen er dadurch unsterblich gemacht hat, darbringt. In diesem Büchlein finden wir die Hauptgesichtspunkte aller späteren umfassenden Werke Agricolas in leichter Weise skizziert. Das gefällige Schriftchen, welches in klassischer Form doch so ganz aus dem praktischen Leben gegriffen war, erregte allgemeines Interesse und den lebhaften Beifall der gelehrtesten Männer jener Zeit, wie dies aus den beiden anerkennenden Briefen des Erasmus von Rotterdam und des Petrus Plateanus, welche den zahlreichen späteren Auflagen vorgedruckt sind, beweisen. Auch für die weitere Entwicklung und die äußeren Lebensschicksale des Agricola war der Erfolg dieses Buches von maßgebendem Einfluss.
Agricola war aber nicht nur Gelehrter, sondern auch ein Mann, der an dem öffentlichen Leben lebhaften Anteil nahm und die Fragen seiner Zeit mit Wärme ergriff. 1529 war Sultan Soliman vor Wien erschienen. 1530 erschien eine geharnischte Schrift Agricolas: Oratio de bello Turcicis inferendo, eine Art Kreuzzugspredigt gegen den Türken, die großen Anklang fand und die eigentlich der Ausgangspunkt des für Agricolas Leben so wichtigen Verhältnisses zu dem späteren Kurfürsten Moritz von Sachsen wurde. Auch der Reformation Luthers hatte er sich anfangs mit Begeisterung zugewandt. Es geschah dies in der Zeit, als er noch Lehrer in Zwickau war. Besonders war ihm, wie allen wohldenkenden Deutschen, der Ablasskram des römischen Papstes in der Seele verhasst und er trat ihm mit beißenden Epigrammen entgegen. Aber dabei blieb er nicht stehen. Wie es sein innerstes Wesen verlangte, allem auf den Grund zu gehen, vertiefte er sich sogar in theologische Studien und schrieb ein Büchlein „von den Überlieferungen der Apostel“, „de traditionibus apostolicis“. Und doch sollte die feindliche Stellung zur Reformation dem nach Wahrheit Strebenden am Abend des Lebens verhängnisvoll werden.
Der Beifall, den seine Schriften, insbesondere sein Bermannus fanden, lenkten die Blicke seiner Landsleute auf ihn und so entschloss er sich im Jahre 1531, einem Ruf der Bergstadt Chemnitz zu der Stelle eines Stadtphysikus Folge zu leisten. Wahrscheinlich geschah diese Berufung auf Veranlassung des Herzogs von Sachsen selbst, der ihm nicht lange danach auch die Stelle des ersten Historiographen des sächsischen Fürstenhauses (der albertinischen Linie) übertrug. Als solcher verfasste er das genealogische Werk: „Dominatores Saxoniae“.
Die Trennung von dem freundlichen Joachimsthal wurde ihm schwer. Aber jetzt erst fand er die Muße, den Schatz der Erkenntnis, den er dort mit rastlosem Fleiß gesammelt hatte, der Welt in herrlichen Schriftwerken zu offenbaren. Schon 1533 erschien die mehr einleitende Schrift De mensuris et ponderibus, Libri V. Die Reihe berühmter Werke, die ihn unsterblich gemacht haben, begann er aber erst zehn Jahre später zu veröffentlichen, so durchdacht und ausgearbeitet, dass sie in ihrer klassischen Vollendung heute noch unsere Bewunderung erregen. Im Jahre 1544 erschienen die Schriften, die als die Fundamentalwerke der Geologie anzusehen sind:
De ortu et causis subterraneorum, Libri V (Von der Entstehung und Ursache der unterirdischen Dinge).
De fontibus medicatis (Über die Heilquellen).
De balneis (Von den Bädern).
De natura eorum, quae effluunt exterra (Über die Natur der Erdausströmungen), eine geologische Abhandlung, der eine im November 1545 verfasste Widmung an den Kurfürsten Moritz von Sachsen vorgedruckt ist.
Hieran reiht sich noch 1548 die sonderbare Schrift: De animantibus subterraneis (Von den lebenden Wesen im Inneren der Erde), in welcher die Existenz der Berggeister verfochten wird.
Noch gereifter und bedeutungsvoller waren die hierauf folgenden mineralogischen Werke des Agricola, von denen die Schrift De veteribus et novis metallis mehr eine historische Einleitung ist, in welcher die Geschichte der Kenntnis der Metalle behandelt wird, während das große Werk De natura fossilium, Libri X, die zehn Bücher von den Mineralien, die Grundlage der wissenschaftlichen Mineralogie, insbesondere der Oryklognosie geworden ist. Dieses wichtige Werk erschien im Februar 1546 ebenfalls mit einer Widmung an Herzog Moritz von Sachsen.
Daneben arbeitete der fleißige Mann ununterbrochen an dem Werke, das am meisten seinen Ruhm begründet hat und das auch für uns das wichtigste ist, an den zehn Büchern De re metallica (über das Hüttenwesen). Es war dies sein Lieblingswerk, an dem er bis zu seinem Tode hämmerte und feilte, dessen Veröffentlichung er aber nicht mehr erlebte. Es war sein Schwanengesang. Obgleich in der Hauptsache schon im Jahre 1550 vollendet, gelangte es erst 1556 nach Agricolas Ableben zum Druck und zwar in Basel, wurde aber in diesem ersten Jahre bereits dreimal aufgelegt. Bis zum Jahre 1614 sind sieben Auflagen davon erschienen, sowie zwei deutsche Übersetzungen, die eine von Philipp Bechius 1580 bei Sigmundt Feyrabend in Frankfurt a. M., die andere 1621 in Basel.
Die äußeren Lebensschicksale des großen Mannes hatten sich leider nicht so gestaltet, wie er es verdient hätte. Selbstlos wie er war, opferte er sich für die Allgemeinheit und musste in den letzten Jahren seines Lebens die Bitterkeit der Armut kennen lernen.
In noch schmerzlichere Bedrängnis brachte ihn sein Verhältnis zur Reformation. Er hatte der Sturmtrompete von Wittenberg mit derselben Begeisterung gelauscht, wie alle aufgeweckten Geister seiner Zeit. Auch ihm waren Luthers Hammerschläge an der Kirchentür zu Wittenberg sympathische Klänge gewesen. Aber die Konsequenzen dieser tief eingreifenden Revolution waren dem gewissenhaften, auf ernstes Studium gerichteten und entschieden konservativen Gelehrten nicht erfreulich. Die Bauernkriege, die er auf die Reformation zurückführte, missbilligte er; noch weniger aber konnte der reichstreue Mann sich mit der Auflehnung der protestantischen Fürsten gegen den Kaiser befreunden. Der Schmalkaldische Bund war ihm ein Unrecht. Zu diesen sich mehr und mehr verschärfenden Anschauungen wirkten verschiedene Verhältnisse bestimmend mit. Sein Aufenthalt in Italien und das intime Verhältnis zu seinen katholischen Lehrern mögen schon dazu beigetragen haben, noch mehr sein Verhältnis zu Erasmus von Rotterdam, dem er in freundschaftlicher Verehrung ergeben war, am meisten aber in älteren Jahren seine innigen Beziehungen zu Kurfürst Moritz von Sachsen, diesem hochbegabten, ehrgeizigen Fürsten, dessen rege Natur, wissenschaftliches Streben und hochfliegende Pläne Agricola mächtig anzogen. Es bestand zwischen dem jugendlichen Fürsten und dem gereiften Gelehrten ein geradezu freundschaftliches Verhältnis und Agricola hatte seinem Fürsten für viele Wohltaten zu danken. Kurfürst Moritz gewährte ihm schon bald nach seiner Thronbesteigung, besonders auf die Empfehlung seines vertrauten Rates Dr. Kammerstädt freie Wohnung, einen Jahresgehalt und Steuerfreiheit zur unbehinderten Fortsetzung seiner wissenschaftlichen Studien. Im Jahre 1546 war Agricola durch die Wahl seiner Mitbürger in Chemnitz nicht nur in den Stadtrat gewählt, sondern auch — eine Ausnahme der Regel — sofort zum Bürgermeister ernannt worden. Dieses Ehrenamt wurde ihm dreimal von neuem übertragen, ein Beweis, wie sehr ihn trotz abweichender Religionsansichten seine Mitbürger achteten. Aber in der Konfliktzeit wurde er der streng protestantisch gesinnten Bürgerschaft verdächtig und infolgedessen nach vielen Verdrießlichkeiten trotz sechsjähriger tadelloser Amtsführung im Jahre 1552 seines Amtes entsetzt. Die hauptsächliche Veranlassung hierzu war sein persönliches Verhältnis zu Kurfürst Moritz und seine laute Verurteilung der schmalkaldischen Wirren. Agricola stand fest und unerschütterlich auf der Seite des Kaisers und zwar mit solcher Begeisterung, dass er als betagter Mann noch zu den Waffen griff und sich dem Heere Karls V. gegen die aufrührerischen Böhmen anschloss, „zur Bewährung seiner volkstümlichen Treue mit Hinterlassung seiner Kinder und schwangeren Gattin, ja mit Aufopferung seiner Habe“, wie er selbst schreibt. Die Chemnitzer dagegen hielten es mit dem Schmalkaldischen Bunde und mit dem Kurfürsten Johann Friederich. Diesem war es 1547 kurz vor der Schlacht von Mühlhausen gelungen, die Stadt Chemnitz in seine Hände zu bekommen. Als dann Herzog Moritz nach der Schlacht vor den Toren erschien, verließ Agricola die Stadt und zog mit diesem, ein Schritt, den man ihm nachmals in gehässiger Weise als Feigheit oder gar als Verrat an der Stadt ausgelegt hat. In Wahrheit war Agricola nicht nur ein guter Deutscher, sondern auch ein guter Sachse, was er dadurch bewies, dass er, als ihn im Jahre 1534 Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig unter fürstlichen Versprechungen zur Mithilfe der Wiederaufnahme des Berg- und Hüttenwesens im Harze einlud, er diesen Ruf dankend ablehnte.
Seine Opposition gegen die reformatorischen Bestrebungen, wodurch er sich so vielen Verdruss schuf, verdient achtungsvolle Beurteilung, denn sie entsprang bei ihm nur aus edler Vaterlandsliebe. So warm er sich anfangs der Bewegung zur Abstellung der Missbräuche in den katholischen Kirchen angeschlossen hatte, so sehr beklagte er nachmals die politische Uneinigkeit, die infolge derselben in Deutschland eingerissen war. Er hoffte auf Herzog Moritz als Wiederhersteller der deutschen Einheit. In diesem Sinne schrieb er in der Zueignung seines Werkes De natura eorum quae effluunt ex terra bereits 1545 an den Fürsten: „Mögest du und dein Bruder, die Ihr von Gottesfurcht erwärmt seid, beten, dass er unser durch Religionsirrungen gespaltenes Deutschland wieder zu seiner früheren Eintracht zurückführe.“
Der sektiererische Geist, der in Deutschland immer mehr um sich griff, war ihm ein Gräuel. Er konnte nicht einsehen, wie es verschiedene Arten des Christentums geben könne. Ihm war die christliche Religion etwas viel Höheres als das Bekenntnis, und so blieb es ihm unverständlich, warum sich diese nicht in der alten Form bekennen lassen solle. Die leidenschaftliche Wut gegen die ihm ehrwürdigen Formen der früheren Gottesverehrung, die Spaltungen und die Zwietracht, welche die Reformation bewirkt hatten, erschienen ihm als ein Unglück, als ein Attentat gegen die Kultur. Kurz, er sah diese weltbewegende Zeitfrage von dem Standpunkte des Patrioten und des von humanistischem Geiste erfüllten Katholiken an.
Schon als Herzog Heinrich der Fromme, des nachmaligen Kurfürsten Moritz Vater, an die Regierung gekommen war, und die Lutheraner bevorzugte, wurde Agricola wegen seines Festhaltens am Katholizismus eine förmliche Verwarnung erteilt. Hierzu bemerkt ein zeitgenössischer Biograph Melchior Adam: „Viele unbedachtsame Schritte mancher lutherischen Gelehrten und Schriftsteller, ein ärgerliches Leben vieler neuen Anhänger der gereinigten Lehre, die fanatischen Gräuel des Bauernkrieges und der Bilderstürmer, die durch die Kirchenverbesserung erfolgte schnelle Abstellung alles Gepränges bei kirchlichen Gebräuchen hätten ihn nie zur evangelischen Bekehrung vermögen können.“ Es war ein achtungswerter Mut, dass er in dieser Zeit, trotz aller äußeren Verlockungen seinem strengen Gewissen folgend, dem Katholizismus auch im äußerlichen Bekenntnis treu blieb. Wohl aber verbitterten die Kränkung seiner Absetzung als Bürgermeister wegen seiner religiösen Anschauung, und der Hohn und Spott, den er ertragen musste, die letzten Jahre seines Lebens und beschleunigten seinen Tod. Der als Gelehrter so milde Mann konnte sich im Kreise von Freunden und Mitbürgern nicht immer die Mäßigung abgewinnen, frivolen Spott schweigend zu ertragen und es gab eine feige Clique in Chemnitz, die sich förmlich ein Geschäft daraus machte, den alten Herrn zu reizen. Es lag dann in seinem Wesen aufzubrausen und heftig seine Meinung zu verfechten. Diese unbeschränkten, lauten Bekenntnisse bei einem Disput dieser Art sollen auch seinen frühen plötzlichen Tod herbeigeführt haben, und schmachvoll war die Behandlung, welche der edle Mann noch nach dem Tode von seinen Mitbürgern zu erdulden hatte. Am 21. November 1555 geschah es, dass Agricola ganz unerwartet während eines heftigen mündlichen Zwistes in einer Gesellschaft mit Neuprotestanten von einem Schlagfluss getroffen dahinstarb. Diese beklagenswerte Veranlassung seines Todes erweckte erst recht den Hass und den Ingrimm der neugeordneten evangelischen Behörden von Chemnitz, und da sie den Lebenden nicht anzufassen gewagt hatten, rächten sie sich an dem Toten, indem sie ihm ein ehrliches Begräbnis verweigerten. Ihm als früherem Bürgermeister und kurfürstlichem Historiographen und Pensionär mit freier Wohnung hätte nach altem Herkommen eine Grabstätte in der Hauptkirche gebührt, statt dessen entschied der Pastor Herr Johann Tettelbach, dass ihm eine jede Beerdigung auf städtischem Gebiete zu versagen sei. So lag denn der Leichnam Agricolas fast fünf Tage unbeerdigt, wie der eines Verfluchten, bis sich die wenigen Freunde des Verewigten an den damaligen Bischof Julius von Pflug in Zeitz, sieben Meilen von Chemnitz, wendeten. Dieser gewährte der Hülle des großen Mannes eine anständige Ruhestätte in der dortigen Stiftskirche mit friedlicher Abholung und allem Gepränge, wie es der katholische Ritus vorschreibt. Dies erfolgte aber erst am sechsten Tage nach seinem Hinscheiden, Mittwoch nach Katharina im Jahre 1555. Auf seinem Grabe wurde ein schöner Denkstein mit Inschrift errichtet. Sie lautet:
„D. O. M. Giorgio Agricolae, Medicinae Doctori et Cons. Chemnicensi, viro pietate atque doctrina insigni, deque Republica sua optime merito, cujus nomen scripta, quae reliquit, praeclara, immortalitati consecrarunt. Spiritum autem Christus in sua illa aeterna tabernacula transtulit.
Uxor et Liberi lugentes F. C.
Mortuus est aetatis suae 62. 10 calend. Nov. Anno post Christum natum 1555.“
Es ist ein melancholisches Schicksal, dass oft die besten Männer von den Nächststehenden ihrer Zeit nicht verstanden werden, denn während der Leichnam des Georg Agricola solche Schmach seitens seiner Mitbürger erfuhr, war sein Ruhm als Gelehrter schon über das ganze gebildete Europa verbreitet. Und wie begründet dieser Ruhm war, dafür spricht der Umstand, dass er bis zu unserer Zeit nicht abgenommen hat. Er war einer der größten Naturphilosophen, die je gelebt haben. Unübertroffen ist er in seinen Schriften durch die wunderbare Durchdringung von Praxis und Theorie. Die Empirie, die damals allein die Technik und selbst die Naturwissenschaft beherrschte, genügte ihm nicht, er strebte nach systematischer Behandlung, besonders der Mineralogie und Metallurgie. Dabei sind seine Schriften klassisch in Ausdruck und Form, lebendig und kernig, anmutig und kräftig, scharfsinnig und originell. Gesner, mit dem er in wissenschaftlichem Verkehre stand, nennt Agricola den deutschen Plinius. Melanchthon schreibt von ihm: Argenti venas olim celebravit Albertus Magnus Sed hunc longe vicit Georgius Agricola Medicus. In einem der Lobgedichte, die sein Freund und Landsmann Georg Fabricius nach seinem Tode auf ihn verfasste, heißt es:
Viderat Agricolae, Phoebo monstrante libellos
Jupiter et tales edidit ore sonos:
„Ex ipso hic terrae thesaurus eruet
Ores Et fratris pandet tertia regna mei!“
Ein anderer hervorragender Zeitgenosse, Joh. Bodinus schreibt über ihn: Metallicam disciplinam ita tractavit Georg. Agricola, homo Germanus, ut Aristoteles ac Plinius in eo genere nihil intellexisse videantur.
Und ähnlich schreibt Thuanus, der ihn unter den großen, klassischen Schriftstellern aufführt:
Er hat in diesem Jahrhundert über Bergwerkswesen, Fossilien und unterirdische Geschöpfe mit solcher Sorgfalt geschrieben, dass er in dieser Gattung die Alten übertraf.
Dabei durchweht seine Schriften bei aller Lebhaftigkeit des Ausdruckes ein Geist ruhiger Objektivität, wie er nur umfassendem Wissen, verbunden mit dem reinen Streben nach Wahrheit, eigen ist und sein Urteil der Geist der Gerechtigkeit und Mäßigung. Er sagt selbst an einer Stelle: „Wenn ich die Ergebnisse meiner Forschung schriftlich mitteile, bin ich wohl zuweilen genötigt, mit einigem Nachdruck die Schriften anderer zu bekämpfen und zu widerlegen, aber wahrlich nicht aus unredlicher Absicht, achtungswerte Männer herabzusetzen, Männer, welche der Erforschung der Natur so viele Zeit und Mühe geopfert haben, sondern im Feuereifer, die schwarzen Nebel zu zerstreuen, welche unsere Kenntnisse von der unterirdischen Natur umhüllen und ein neues Licht darüber anzuzünden. Erreiche ich diesen Zweck nicht ganz, stifte ich durch meine Arbeit nicht den gehofften Nutzen, so ist es dem heiligen Dunkel zuzuschreiben, hinter welchem die Natur vorzüglich die Gegenstände im Inneren des Erdkörpers verbirgt.“
Dass ein Arzt der erste Lehrer der Bergbau- und Hüttenkunde wurde, kann uns nicht wunder nehmen. Die einzelnen Disziplinen der Naturwissenschaft waren zu jener Zeit noch nicht getrennt, das Studium der Medizin umfasste sie alle. Agricolas Genie lenkte sich aber mit Vorliebe der praktischen Naturforschung zu und er verteidigt die Würde derselben mit Nachdruck. „Multi habent hanc opinionem, rem metallicam fortuitum quiddam esse et sordidum opus, atque omnino ejusmodi negotium, quod non tam artis indigeat, quam laboris.“ Und an einer andern Stelle: „Metallicus sic oportet multarum artium et disciplinarum non ignarus.“
Dies schrieb er hauptsächlich gegenüber dem hochmütigen Dünkel derjenigen, die ihre schwindelhafte Mystik für etwas Höheres hielten, als die praktische Naturwissenschaft, und deren unwahrhaftige Hohlheit Agricola mit scharfen Worten geißelte. Er stand klar und fest auf dem Boden der Beobachtung; die Spekulation ohne diese Grundlage verwarf er, nur was er selbst gesehen und erkannt hat, will er beschreiben: „Sic sane a me id praetermissum, quod nec ipse vidi, neque legi, nec ex hominibus fide dignio cognovi; id profecto, quod non vel vidi, vel lectum aut auditum suspendi, non est scriptum.“
Von diesem Geist des wahren Naturforschers erfüllt, schrieb er seine Werke, schrieb er besonders seine zwölf Bücher De re metallica. Dieses Werk ist für uns das wichtigste. Wir haben bereits erwähnt, dass es erst nach seinem Tode im Jahre 1556 im Druck erschien, obgleich die Widmung desselben an Kurfürst Moritz und Herzog August von Sachsen schon von 1550 datiert ist. Jedenfalls feilte der gewissenhafte Mann noch immer an diesem seinem Lieblingswerk, denn das Horazische decem prematur in annis war auch sein Grundsatz. Ja, so vollendet das Werk vor uns liegt, so scheinen doch noch Abschnitte darin zu fehlen, wie dies aus einer Stelle hervorgeht, in der er sagt, die Beschreibung der Formerkunst werde er in seinem Werke „De re metallica“ geben; — diese ist er aber schuldig geblieben.
In der Widmung führt er zunächst die Bedeutung des Bergbaus besonders mit Hinweis auf die Landwirtschaft aus. Freilich, fährt er fort, sei es weit schwerer für ihn, über den Bergbau zu handeln als dem Columella — dessen Werk De re rustica, Libri XII ihm als Vorbild gedient zu haben scheint und dem er Titel und Einteilung nachbildete — über die Landwirtschaft. Denn Columella habe noch mehr als 50 griechische Schriften und 10 lateinische Werke als Quellen benutzen können, während ihm von klassischen Schriften nur die Bücher des Plinius zum Studium hätten dienen können.
„In unserer Sprache sind aber nur zwei Schriften verfasst, die eine „„über die Aufsuchung der Metalle und metallischen Stoffe““, sehr verworren und von unbekanntem Autor, die andere handelt über die Erzgänge, über welche auch der Engländer Pandulphus gehandelt haben soll. Diese deutsche Schrift verfasste Kalb aus Freiberg, ein nicht ununterrichteter Arzt.“ Doch spricht Agricola auch von dieser Schrift geringschätzig. Beide sind wohl gänzlich verloren gegangen. Dagegen rühmt er das Werk des Italieners Vanuccio Biringuccio, das ihm genau bekannt war und das er, wie er bemerkt, zum Teil benutzt habe. Er erwähnt noch, dass er dieses Buch von Franziscus Bodoarius, einem Patrizier Venedigs und einem sehr gelehrten und würdigen Mann, zum Geschenk erhalten habe.
Agricolas Werk De re metallica zerfällt in zwölf Bücher. Während das erste eine allgemeine Betrachtung über die Bedeutung der Erzgewinnung gibt, handeln die fünf folgenden vom Vorkommen der Erze und vom Bergbau, das siebente von der Probierkunst, das achte vom Waschen, Aufbereiten und Rösten der Erze, das neunte von den Schmelzprozessen und Schmelzvorrichtungen im allgemeinen, das zehnte von der Scheidung von Gold und Silber und von der des Bleies von beiden, das elfte hauptsächlich von der Gewinnung des Silbers aus den Erzen, das zwölfte endlich behandelt die Bereitung des Salzes, des Salpeters, des Alauns u. s. w.
Über die Darstellung von Eisen und Stahl ist nur kurz im neunten Buche, in dem alle Schmelzverfahren zusammengestellt sind, Nachricht gegeben. Überhaupt sind die Mitteilungen über das Eisen weniger ausführlich, als wie über die andern Metalle. Es ist das für uns sehr zu beklagen, aber nicht verwunderlich, da in jener Zeit das Eisen trotz des gestiegenen und immer steigenden Bedarfes noch das Stiefkind unter den Metallen war. Es wurde an vielen Plätzen, aber meist in wenig umfangreichen Betrieben gewonnen, von Leuten, die ihre Arbeit ganz empirisch betrieben, vielfach sogar noch von den Bauern als Nebengewerbe. Das Ausschmelzen des Eisens schien so einfach zu sein, seine Verarbeitung aus einer Reihe vererbter Handgriffe zu bestehen, so dass es das Interesse der Gelehrten nicht auf sich zog und auch die Habsucht der Besitzenden, namentlich der Fürsten nur in geringem Grade reizte.
Dennoch sind die Mitteilungen Agricolas über das Eisen inhaltsreicher und bedeutender, als man gewöhnlich annimmt, man muss sich nur nicht mit den zwei kurzen Abschnitten über die Eisen- und Stahlbereitung im neunten Buche der Metallurgie, wie dies gewöhnlich geschieht, begnügen, sondern sämtliche auf das Eisen bezügliche Stellen, die in den verschiedenen Werken zerstreut sind, zusammenstellen. Wir wollen dies in systematischer Weise zu tun versuchen und die Stellen wörtlich nach dem lateinischen Originaltext wiedergeben. Es wird sich dann zeigen, dass Agricolas Kenntnisse vom Eisen doch recht umfassend waren und dass uns über dasselbe außer von Vanuccio Biringuccio, nichts Besseres geschrieben worden ist bis zu den Schriften von Reaumur und Swedenborg im vorigen Jahrhundert. Auch in betreff des Eisens blieben die Werke Agricolas die wichtigste Quelle der Erkenntnis der Gebildeten während der folgenden zwei Jahrhunderte.
Über die erste Erfindung des Eisens findet sich im ersten Buche de veteribus et novis metallis folgende sorgfältige Zusammenstellung aus den klassischen Schriften des Altertums:
Die Telchinen, welche aus Kreta zuerst nach Zypern und dann nach Rhodus kamen, betrieben sowohl Eisen- als auch Kupferwerke.
Aber in Asien haben die Chalyber zuerst das Eisen erfunden: in Kreta wiederum Faunus und die Diktäer, wie Herodot schreibt, jener im Gebirge Dicta, diese im Ida. Eine Eisenwerkstätte erfanden auch die Zyklopen, welche berühmte Erz- und Eisenschmiede waren: die Lötung des Eisens ersann Glaukos von Chios: die Kunst des Gießens Theodoros von Samos. Aber Cynira, der Sohn der Agriopa, erfand die Zange, den Hammer, den Rengel und den Amboss, wie Diodor von Sizilien berichtet. Andere aber lehren, dass Vulkan die Kunst der Bereitung des Eisens, Erzes, Goldes, Silbers, kurz aller Metalle für den Gebrauch der Menschen, die des Feuers bedürfen, zuerst erfunden und gelehrt habe. Weshalb die Arbeiter in diesen Dingen jenem Gott ihre Gelübde und Opfer darbringen: und das Feuer zur ewigen Erinnerung an die von ihm empfangene Wohltat mit dem Namen des Vulkan benennen: wie die Soldaten den Krieg Mars, weil er die ersten Waffen bereitet und die ersten Kriege geführt habe.
Über die geographische Verbreitung des Eisens und über die wichtigsten Plätze, wo Eisen gewonnen wird, gibt das zweite Buch desselben Werkes eine ausführliche und interessante Zusammenstellung, die umso wichtiger ist, als darin auch Bemerkungen über die Verwendung des Eisens in einzelnen Gegenden eingestreut werden, die von technischer Bedeutung sind.
Von den alten und neuen Metallen. 2. Buch.
Es bleibt noch das Eisen übrig, mit dessen Erzen alle Gebirgsgegenden angefüllt sind. Die Hügel Britanniens erzeugen es, wie Strabo schreibt: das diesseitige Spanien, wie das ganze Gebiet der Pyrenäen, nach Plinius, der ferner berichtet, dass in dem seewärts gelegenen Kantabrien, da, wo der Ozean die Küste bespült, ein Berg hoch und steil hervorragt, der — unglaublich zu sagen — ganz aus diesem Stoff besteht. Sodann befinden sich bei Perigord und Bourges in Gallien Hütten, in denen Eisen dargestellt wird. In Deutschland findet sich, wie ich schon im vorhergehenden Buche erwähnt habe, Eisen in den böhmisch-mährischen Bergen (Luna sylva), wie Ptolemäus schreibt: dieses gruben nach Cornelius Tacitus die Gotinnen. Dann kommt Steiermark (Noricum), dessen Eisen von den Versen der Dichter besungen wird. So Ovid:
„Härter noch als Eisen, geschmolzen in norischem Feuer.“ Weiterhin liegt im Tyrrhenischen Meer Elba: „Die Insel gesegnet mit unerschöpflichem Metall der Chalyber.“ Diese nennen die Griechen Äthalia und von ihr erzählen sie, wie auch die Latiner, dass das Eisen wieder wachse. Aber Varro hat berichtet, dass alles in Stäbe gestreckt werden könne, was nach Populonia, einer tuskischen Stadt, hinübergebracht werde. Fernerhin gruben die Diktäer auf Kreta Eisen. Sodann war, wie Strabo erzählt, Kupfer und Eisen gemein im lilandischen Felde auf Euböa. Aber in Asien fand man Eisenerze bei Andira: im Gebiete der Chalyber: in den Gebirgen Palästinas, die nach Arabien zu schauen: in Carmanien. Und wie in Europa das norische und hispanische Eisen am meisten in den Liedern der Dichter gepriesen wird, so in Asien das chalybische. Deshalb haben dieselben Dichter den Namen Chalybien oft für Eisen missbraucht. In Afrika aber findet sich Eisen auf der Insel Meroe.
Weil nun in allen gebirgigen Gegenden Eisen im Überfluss vorkommt, so will ich nur die Erzgebiete anführen, die in unserer Zeit in größter Blüte stehen. Es gibt jetzt auch bei den Schotten, die in Britannien wohnen, wie in Spanien und Frankreich viel und gutes Eisen. Ebenso in Deutschland in der Gegend, die man die Eifel nennt, und zwar im Gebiete des Grafen von Manderscheid. Woselbst auch eiserne Öfen, die wir in den Warmräumen gebrauchen, gegossen werden. Die Art und Weise, wie diese gegossen werden, will ich in den Büchern über die Metalle beschreiben. (Ist aber leider nicht geschehen!)
Aber noch an vielen andern Plätzen des großen Deutschland wird dieses Metall dargestellt, welche einzeln aufzuführen mir unnötig erscheint, weshalb ich nur die besonders hervorragenden anführen will. So wird im Harz bei Muckshol, welches etwa 12000 Schritt von Nordhausen entfernt liegt, Eisenstein gegraben, welcher nahezu abgebaut zu sein scheint, und der Mennige ähnlich erscheint. In Hessen ist bei Waldungen Überfluss an Eisenstein, sowie bei der Stadt Siegen und im ganzen Sauerland, nach der kölnischen Seite zu, wo ebenfalls eiserne Öfen gegossen werden.
Sodann hat der Thüringer Wald (sylva Semana) sehr viel Eisenerz: noch mehr das norische Land diesseits der Donau, wo an Güte die Erze bei Amberg gegen Sulzbach zu nicht weniger vortrefflich sind. Ferner wird an vielen Orten im Fichtelgebirge Eisen gegraben, ganz besonders bei Wunsiedel: im Elbogenschen (in Böhmen) bei der Lessau-Mark: im Meißnischen, insbesondere bei dem Dorf Pela, da, wo man nach rechts hin in das reiche Joachimsthal kommt, welches Bergwerk von seinem Entdecker Burkart und dem abschüssigen Ort seinen Namen hat. Sodann das zwischen dem Wald von Rascha und dem Kloster von Grünhain, welches man den Memmeler nennt: aber das beste soll das bei Lauenstein und Gießhübel sein, wo auch eiserne Öfen gegossen werden. Es ist nicht weit von Pirna gegen Süden gelegen. Bei Sagan in Schlesien wird auf Wiesen Eisenstein gegraben, vermittelst zwei Fuß tiefer Schürfe. Tiefer darf man der Wasser wegen nicht niedergehen. Nach zehn Jahren wird das wieder erzeugte Eisen von neuem gegraben, gerade wie das elbanische, das ebenso sehr schwer ist. Weit voran steht aber das schwedische, welches Osemund genannt wird. Es wird in Upland gegraben, in einem Wald, der von Kupfertal bis zum Hafen Tuna sich erstreckt: ferner in Ostgotland bei dem Dorf Advidha: bei der Stadt Tingualla an der Grenze Schwedens und Norwegens: in Norwegen zwischen Socnadal und Osterdal und im Gebiet Tillemarchia, drei Meilensteine von der Stadt Schida (in Drontheim?). Endlich wird in Norikum nicht weniger und häufig Stahleisen reichlich gewonnen und dargestellt, zumeist in Kärnten und Vordernberg. Doch nun auch genug vom Eisen.
Von den Eisenerzen berichtet Agricola ausführlich in seinem größten mineralogischen Werke „De natura fossilium“, allerdings ohne Berücksichtigung des hüttenmännischen Standpunktes. Wir geben in dem Folgenden einen Auszug seiner zum Teil sehr weitläufigen Mitteilungen.
Über den Eisenrost sagt er im dritten Buche: „Der Eisenrost (Hammerschlag) ist sozusagen eine Ausscheidung des metallischen Eisens. Der Eisenrost wird in der Erde ebenso selten gefunden, als das gediegene Eisen. Man nennt ihn im Lateinischen bald ferrugo, bald rubigo. Ersteres, weil er sich wie ein Ausschlag an das nass gemachte Eisen anlegt; letzteres, weil seine dunkle Farbe ins Rötliche schielt. Daher ihn auch einige rot, andere schwarz nennen. Er ist ebenso adstringierend, aber weniger ätzend als der Vitriol. Die Schuhmacher bedienen sich seiner zum Schwärzen des Leders. Aus der Wäsche und den Kleidern sind Rostflecken schwer herauszubringen.“
Ausführlich handelt dann Agricola über die wichtigsten Eisenminer im fünften Buche. Er gibt darin zunächst eine allgemeine Einteilung aller Steine in vier Geschlechter:
1. Eigentliche oder gemeine Steine (Magnetstein, Hämatit, Gips etc.). 2. Edelsteine (Diamant, Smaragd etc.). 3. Marmorarten (die sich schleifen lassen). 4. Fels- und Gebirgsarten (Sandstein, Kalkstein).
Zu dem ersten Geschlechte rechnet er den Magnetstein (Magnes), über den er sehr eingehend berichtet: „Der Magnetstein ist wegen seiner wunderbaren Kraft, das Eisen an sich zu ziehen, unter allen Steinen der berühmteste und bekannteste. Die Griechen haben ihm die Namen: Magnes, magnetes, heraklischer Stein und Siderit beigelegt. Magnes und Magnetes wird er genannt nach seinem Entdecker, der ihn auf dem Ida fand — eine Mutmaßung des Nikander, wie Plinius berichtet —, oder nach der asiatischen Provinz Magnesia, einem Hauptfundort desselben. Deshalb singt Lucretius von ihm:
Quem Magneta vocant patrio de nomine Graii,
Magnetum quia sit patriis in finibus ortus.
Die Benennung „heraklischer Stein“ bezieht sich entweder auf die Stadt Heraklea oder auf den Herakles. Denn wie Herakles die grässlichen, unbändigen Ungeheuer bezwang, so zieht der Magnet das Eisen, den Besieger aller Körper auf Erden, an sich und hält ihn gefangen. Diese Kraft erwarb ihm auch den Namen Siderit. Der Magnet hat das Ansehen des polierten Eisens und bricht auch gewöhnlich auf Eisensteingruben, freilich nur auf wenigen, denn ihrer gibt es bekanntermaßen sehr viele. Es sind entweder kleine Stückchen davon in dem Eisenerz eingeschlossen oder er bildet mächtigere und größere Mittel.“ Unter den Fundorten, die er nun aufführt, erwähnt er die spanische Provinz Kantabrien, eine nordische Insel, nicht weit von Lappland, verschiedene Plätze in Deutschland, sowie Magnesia, „linkerhand vom See Böbeis“ und andere mehr. Nachdem er die wichtigsten physikalischen Kennzeichen: Farbe, Festigkeit und Schwere beschrieben hat, fährt er fort: „Einige Magnete ziehen das Eisen stark an, andere schwach; jener heißt weiblicher Magnet.“ — „Der ganz gute Magnet begnügt sich nicht damit, das Eisen an sich zu ziehen und festzuhalten; er teilt sogar diese Kraft dem Eisen mit, so dass dieses nunmehr selbst anderes Eisen an sich zu ziehen und festzuhalten vermag. Wenn man mehrere eiserne Ringe auf einem Tisch herumstreut und hält einen magnetischen Ring darüber, so zieht dieser dieselben an, so dass sie an ihm herabhängen. Ein Magnet, den man einem eisernen Ringe nahe bringt, teilt letzterem die magnetische Kraft mit, so dass dieser Ring einen zweiten, der zweite einen dritten und so ferner anzuziehen vermag; in welchem Falle dann die Ringe reihenweise und wie die Glieder einer Kette aneinander hängen, ohne dass einer in den andern verschlungen ist. Von diesen Ringen hängt jedoch der erste am festesten und die folgenden immer lockerer, bis sie zuletzt gar nicht mehr halten. Diese Erscheinung hat von jeher die größte Bewunderung erweckt. Das gemeine Volk pflegte zu Plinius’ Zeiten das magnetische Eisen „lebendiges Eisen“ (ferrum vivum) zu nennen. Empedokles, ein Philosoph aus Agrigent, soll dem Magnet eine Seele beigelegt haben. — Die Theologen halten die Ursache dieser Kräfte des Magnetes für übernatürlich, die Ärzte für natürlich, obgleich unerklärbar.“
Nun folgt eine Aufzählung scheinbarer Wunder, die mit dem Magnet auszuführen sind, so z. B. die eiserne Kugel, die von einem Spiegel, durch einen verborgenen Magnet, angezogen wird, dann die schwebende Figur im Serapistempel zu Alexandria und endlich der bekannte Versuch des Baumeisters Dinokrates (der aber nicht gelang), ein magnetisches Gewölbe in einem Tempel der Arsinoe so zu konstruieren, dass das Bild der Göttin im Mittelpunkte ganz frei schweben sollte.
Hieran knüpft Agricola verschiedene anekdotenhafte Berichte über die Entdeckung des Magneten, wie Bergleute, welche ihr Gezähe in der Grube zurückgelassen, am andern Tage ihre Schlägel und Eisen nicht mehr an ihrem Platze, sondern an der Decke hängend gefunden hätten, sowie die bekannten arabischen Märchen von den Magnetinseln. Von dem ökonomischen Gebrauche des Magneten erwähnt er, dass, nach Angabe des Plinius, die Glaser sich ehemals des Magnetes bedient hätten, weil sie glaubten, dass er die Kieselfeuchtigkeit ebenso an sich ziehe, wie das Eisen. Auch die Ärzte machten Gebrauch davon, wie man beim Galen und Dioskorides nachlesen könne. Des Kompasses bedienten sich die Schiffer und die Bergleute. Gebrannt nähme er die Farbe des Hämatites an, wofür man ihn auch ehemals verkauft habe. Nachdem er noch den Stein „theamedes“, der eine dem Magnet entgegengesetzte Natur habe, so dass er das Eisen abstoße, statt anziehe, und der beiden indischen Inseln, auf deren einer der, welcher Nägel an den Schuhen hat, hängen bleibe, während er auf der andern den Fuß nicht aufzusetzen vermag, erwähnt hat, wendet er sich zu den dem Magnetstein verwandten Steinarten, dem Hämatitos und dem Schistos. Was er über diese sagt, lassen wir wörtlich folgen:
In den Eisengruben, oft aber auch in eigenen, findet man Hämatite und Schistos (Blutsteine und Glaskopf oder Faserstein), zwei (unter sich und dem Magnet) verwandte Steine, die auch aus derselben Materie verdichtet sind und nur in der Gestalt und in einigen andern Eigenschaften voneinander abweichen. Hämatite werden sie genannt, teils weil sie die Farbe des Blutes haben, wie dies Galen, der darin dem Theophrast folgt, bemerkt: teils, weil sie, wie einer oder der andere meint, am Schleifsteine gerieben einen blutroten Saft geben.
Der Schistos aber wird so genannt, nicht weil er gespalten oder leicht spaltbar wäre, denn das ist er nicht, sondern weil er aussieht, als sei er gespalten (d. h. von faseriger Struktur). Seine einzelnen Teile sind so zusammengesetzt, als seien sie gerade wie Holz zusammengewachsen, ähnlich wie bei dem Salmiak.
Viele Gegenden Deutschlands erzeugen diese Steinarten, so Sachsen in der Hildesheimer Gegend, jenseits des Moritzbergs, und zwar in Quadern. In demselben Sachsen beim vierten Meilensteine von Goslar, da, wo man nach dem Berge zu geht, den sie dort mit seinem Eigennamen „Kalte Birke“ nennen, diese nennen wir den Goslarischen.
Am Harze finden sie sich an verschiedenen Plätzen, vorzüglich aber bei Harzgerode, wo Schistos vorkommt, und bei Ilefeld, einem Kloster im Gebiete des Eichsfeldes. In Hessen, das ein Teil des Landes der Katten bildet, in den Bergen bei Gladenbach. Zu Müsen in einer Grube der Hermunduren, welche sie „die Goldkrone“ nennen. Ein Überfluss an Schistos findet sich etwa 5000 Schritte von der Stadt Marienberg (im Erzgebirge). In Böhmen in den Eisengruben der Lessau-Mark (Karlsbader Gegend), ebenso zuweilen in den Silberbergwerken von Joachimsthal. Jedoch an beiden Orten nur hier und da: wie auch in den Eisengruben von Norikum diesseits der Donau, zwei Meilensteine von Amberg entfernt, wenn man von Sulzbach nach Westen geht. Überall, wo Hämatit und Schistos gefunden werden, sind die Felsen rot und die Erde von derselben Farbe und aus diesen sind sie ursprünglich entstanden. So schreibt auch gleichermaßen Dioskorides, dass sich Hämatit in der roten sinopischen Erde fände. Ferner erzeugt Spanien Schistos; Arabien, Ägypten, Afrika und Äthiopien Hämatit. Die verschiedenen Steinarten weichen aber in der Farbe ab. Denn entweder sehen sie aus wie verdichtetes Blut und daher eben haben sie den Namen Hämatite: oder sie haben die Farbe des Eisens und dann wieder sind die äußeren Teile von gelber Farbe: wie sie Müsen (oder Meißen? Misena) erzeugt (brauner Glaskopf). Oder sie sind ganz schwarz, wie diejenigen, welche an dem oben erwähnten Berge „Kalte Birke“ gegraben werden. Wie denn auch, wie Sotacus berichtet, in Afrika ein schwarzer Schistos wächst, den sie wegen der Farbe wie Holzkohlen Anthrazit nennen.“ .....
Agricola fährt dann fort, die einzelnen Varietäten des Schistos zu beschreiben, wobei er besonders den weichen Eisenrahm und Eisenglimmer dem harten Eisenglanz, wie er besonders bei Müsen vorkomme, gegenüberstellt. Dann wendet er sich zu den Farben, welche man durch Mahlen oder Brennen aus diesen Steinarten gewinnt, dem roten, gelben und schwärzlichen Ocker. Dabei hebt er hervor, dass die Farben des gebrannten Schistos lichter sind, als die des ungebrannten. Er unterscheidet die vielen Varietäten in klarer Weise. Er schreibt nicht nur dem Hämatit, sondern auch dem Schistos einen adstringierenden Geschmack zu; kommt sodann auf die verschiedene Härte der einzelnen Arten, wobei im allgemeinen zu bemerken sei, dass der Schistos umso härter sei, je mehr er wie Eisen glänze. Er erwähnt seine vorzüglichen Eigenschaften als Polierstein für die Goldschmiede. Danach führt er die verschiedenartigen eigentümlichen Formen auf, in denen besonders die Glasköpfe gefunden werden. Endlich wendet er sich eingehend zur Verwendung des Hämatites und Schistos in der Heilkunde.
Die Beschreibung des Agricola ist eine durchaus mineralogische. Von der Verwendung dieser Steinarten als Erze zur Gewinnung des Eisens spricht er nicht. Dennoch ist sie auch für uns von großem Interesse ihrer Gründlichkeit und Klarheit wegen.
Über das Eisen als Metall, seine Eigenschaften und seine Verwendung handelt er dagegen ausführlich in einem interessanten und für uns sehr wichtigen Kapitel des achten Buches „de natura fossilium“ folgendermaßen:
Ich wende mich zu dem Eisen, von dem die Alten nirgends berichten, dass es gediegen vorkomme. Solches, das seine Farbe trägt, wird allerdings im Sand der Flüsse gegraben und gefunden, wenn auch nur selten. Aber eben dieses ist noch nicht völlig rein: so dass die schwarzen Graupen, aus denen das Zinn geschmolzen wird, reiner sind und weniger Schmelzens bedürfen, als diese Eisenkörner und Stückchen, was auch Albertus Magnus wohl bekannt war. Denn er schreibt, das Eisen wird in einer wässerigen Erde in der Gestalt von Hirsekörnern, aber sehr verunreinigt gefunden. Die Farbe des unpolierten Eisens fällt ins Schwärzliche, die des polierten ins Mattweiße. Das aus dem Erz geschmolzene Eisen ist flüssig und kann geschmolzen werden: wenn man es darauf, nachdem die Schlacken abgezogen sind, nochmals glüht (frischt — refrixit), so wird es weich, so dass es unter dem Hammer gestreckt und zu Blechen ausgebreitet werden kann, aber gießen lässt es sich dann nicht mehr leicht: es sei denn, dass man es in dieselbe Art Öfen bringt und niederschmelzt. Alles Eisen ist hart, deswegen gibt es auch von allen Metallen den größten Schall. Aber das eine weicht darin von dem andern ab.
Denn einiges ist zähe und dies ist das beste, anderes nur mittelmäßig, deshalb auch nur von mittlerer Güte: anderes spröde und kupferhaltig: dieses ist das schlechteste. Von der ersten Sorte ist das schwedische, norwegische und norische, von der zweiten das von Lauenstein und Gießhübel im Meißnischen und das von Sulzbach in den norischen Bergen diesseits der Donau; zu der dritten gehört das, welches auf dem Amboss unter dem Hammer wie Glas auseinander fliegt: und das noch andere Fehler in sich vereinigt. Aus dem Eisen, wenn man es öfter schmelzt und von den Schlacken reinigt, entsteht das, was die Griechen στόμωμα nennen, die Lateiner aber, wenn ich mich nicht irre, öfter acies — Stahl. Von dieser Art war das serische, parthische, norische, comensische. Bisweilen wandelt sich das Eisen infolge der Güte seiner Erze in Stahl, wie auch noch heute das norische: bisweilen durch das Wasser, in das man es öfter eintaucht, wie zu Como in Italien und zu Bilbilis und Turassio in Spanien. Der Stahl wird zu höherem Preise als das übrige Eisen verkauft.
Wird das Eisen öfter gereinigt, so verliert es viel an Masse und Gewicht. Das Eisen wird verdorben durch einen Fehler, den man den Rost (ferrugo et rubigo) nennt; er entsteht durch die Berührung mit Feuchtigkeit, am raschesten mit Menschenblut. Mit Meerwasser kann man diese Flecken am schnellsten wieder herausbringen: und man schützt es davor durch mancherlei Umhüllungsmittel, durch Mennige, Bleiweiß, Gips, Bitumen und flüssigen Teer. Das glühende Eisen bricht leicht, wenn es nicht durch Hammerschläge dicht gemacht ist. Aus Eisen werden mehr Gegenstände gefertigt, als aus irgendeinem andern Metall. Außer als Geld haben es die Lakedämonier zu Ringen benutzt: Halsketten davon trugen die hispanischen Frauen: zu Delphi waren sehr schöne Kratere davon, ein Geschenk des lydischen Königs Alyattes, ein Werk des Glaukos von Chios: eiserne Statuen waren in dem lakonischen Skias, ein Werk des Theodoros von Samos. Aus Eisen macht man ferner Schlüssel, Türangeln, Schlösser, Nägel, Gitter, Türen, Torflügel, Spaten, Stangen, Heugabeln, Haken, Dreizacke, Dreifüße, Setzeisen, Hämmer, Keile, Hauen, Äxte, Sicheln, Grabscheite, Keilhauen, Ambosse, Ketten, Hebel, Karste, Pflugscharen, Baummesser, Pfannen, Schüsseln, Löffel, Bratspieße, Messer, Dolche, Degen, Beile, Speere, Wurfspieße, Lanzen und andere Waffen, die ihre Namen von verschiedenen Völkerschaften führen. Ferner Wurflanzen, Mörserkeile, Fußangeln, Brustharnische, Helme, Beinschienen, Kugeln, die aus den ehernen Geschützen geschleudert werden, Handschellen u. s. w. Doch jetzt genug vom Eisen .....
Nun endlich kommen wir zu dem, was Agricola vom hüttenmännischen Standpunkte aus über die Bereitung und Verarbeitung von Eisen und Stahl in seinem Werke „De re metallica“ mitteilt.
Zunächst bemerkt er über die Prüfung der Eisenerze auf ihren Gehalt an Eisen im fünften Buche, worin er von der Probierkunst handelt, folgendes:
Endlich wird das Eisen im Schmiedefeuer probiert; es wird gleichfalls geröstet, zerstoßen, gewaschen und getrocknet. Dann wird ein Magnet in die Masse (das Gekrätz) gelegt, welcher die Eisenteilchen an sich zieht: diese werden dann, nachdem sie mit einer Feder abgestrichen worden sind, in einen Tiegel gebracht, und wird der Magnet so oft in dies Pulver gelegt und die Teilchen abgestrichen, bis nichts mehr da ist, was der Magnet anziehe. Diese werden mit Salpeter im Tiegel eingeschmolzen bis zum Fluss und so wird ein Eisenkorn ausgeschmolzen. Zieht der Magnet rasch und leicht die Eisenteilchen an sich, so schließen wir, dass das Eisenerz reich sei: scheint er sie aber eher abzustoßen, so enthält das Erz wenig oder kein Eisen.
Agricola kennt nur diese eine trockene Probe, wie denn überhaupt auch in dem folgenden Jahrhundert der Eisengehalt der Eisenerze einzig durch die Schmelzprobe im Tiegel bestimmt wurde.
Nun kommen die beiden wichtigen Kapitel im neunten Buche, welche von dem Ausschmelzen der Erze, von der Stabeisen- und Stahlbereitung handeln.
(Luppenfeuer.) Eisenerz, das besonders gut ist, soll in einem Ofen geschmolzen werden, der dem folgenden fast gleich ist. Der Schmelzherd soll 3½ Fuß hoch und an 5 Fuß breit und lang sein: in dessen Mitte sei ein Tiegel 1 Fuß tief und 1½ Fuß weit. Wiewohl er höher oder niedriger, breiter oder enger sein kann, je nachdem mehr oder weniger Eisen aus dem Erz bereitet wird. Dem Meister (Renner) soll ein gewisses Maß Eisenerz gegeben werden, ob er daraus viel oder wenig Eisen schmelzen kann: will dieser seine Arbeit beginnen, so wirft er erst Kohlen in den Tiegel, darauf so viel gepochtes Eisenerz, gemischt mit ungelöschtem Kalk, als eine eiserne Schaufel fassen mag. Dann werfe er abermals Kohlen hinein und dies öfter und streue das Eisenerz darauf, und zwar so lange, bis allmählich ein Haufen daraus entstehe, welchen er, nachdem die Kohlen entzündet, mittels Blasebälgen, die künstlich in ein Rohr (die Form) zusammengeführt sind, durch den Wind zur Glut anfacht und so ausschmelzt, welche Arbeit er bald in acht, bald in zehn, manchmal auch in zwölf Stunden vollbringen kann. Damit ihm aber das Feuer das Gesicht nicht verbrenne, wie dies zu geschehen pflegt, bedecke er es ganz mit einem Hut, an dem jedoch Löcher angebracht sind, durch welche er sehen und atmen kann. An dem Ofen sei eine Zugstange, mit der er, so oft es die Arbeit verlangt und sie verlangt es, sobald die Bälge zu viel Wind in den Ofen einblasen, oder sobald er selbst die übrigen Erze und Kohlen aufgibt, oder sobald er die Schlacken abzieht, das Schussgerinne, durch welches das Aufschlagwasser auf das Rad geleitet wird, und die Welle, welche die Bälge niederdrückt, in ihrer Bewegung hemmt oder sich umdrehen lässt: auf diese Weise fließt das Eisen in eine Masse (Stück) zusammen, von zwei bis drei Zentner Gewicht, je nach der Reichhaltigkeit der Erze. Alsbald öffnet der Meister das Schlackenloch mit dem Spieß und lässt, nachdem die Schlacken ganz abgeflossen sind, die Masse erkalten: sodann soll er und die Gesellen dieselbe mit eisernen Brechstangen aus dem Ofen auf den Boden schaffen und sie mit hölzernen Hämmern, die dünne, aber 5 Fuß lange Stiele haben, zusammenschlagen, damit er die Schlacken, welche ihr noch anhängen, abklopfe und sie dieselbe zugleich dicht mache und ausbreite. Denn wenn sie sogleich auf den Amboss gelegt, mit dem großen Hammer, der von den Hebedaumen der Welle, die das Wasserrad bewegt, aufgehoben wird, geschlagen würde, flöge sie auseinander: während so kann sie bald mit Zangen aufgehoben unter demselben Hammer mit einem scharfen Eisen (Schrotmeißel) in vier, fünf oder sechs Stücke, je nachdem sie groß oder klein war, geteilt werden: aus diesen, nachdem sie von neuem in einem andern Herd ausgeheizt und wiederum auf den Amboss gebracht worden sind, fertigen die Schmiede quadratische Blöcke (Kolben), Pflugeisen, Radschienen, zumeist aber Stangeneisen, von denen vier, sechs oder acht den fünften Teil eines Zentners wiegen: aus diesen pflegen sie dann abermals verschiedene Werkzeuge anzufertigen. Bei jedem Hammerschlag schüttet ein Junge mit einer Kelle Wasser auf das glühende Eisen, das die Schmiede formen: daher kommt es, dass diese Schläge einen so lauten Schall geben, dass man es weithin von der Hütte hört. Nachdem das „Stück“ aus dem Ofen, in dem die Erze geschmolzen worden sind, herausgebrochen ist, bleibt im Tiegel hartes Eisen, das sich nur schwer strecken lässt, zurück: aus diesem kann man die Köpfe der Pochstempel (Pocheisen) und andere ganz harte Gegenstände machen.
(Stücköfen.) Aber für die Eisenerze, welche kupferhaltig sind oder nur schwer, wenn sie geschmolzen werden, fließen, muss man mehr Arbeit und stärkeres Feuer anwenden, denn man muss sie nicht nur, um die metallischen Teile von den nicht metallischen zu trennen, unter einem trockenen Pochwerke zerkleinern, sondern sie auch rösten, wie die Erze anderer Metalle, damit die schädlichen Säfte sich verflüchtigen, und sie waschen, dass alles, was leicht ist, von ihnen geschieden werde. Sie sollen aber in einem Ofen, der dem ersten ganz ähnlich, nur viel höher und weiter, um viel Erz und Kohlen fassen zu können, geschmolzen werden; dieser wird nun ganz mit Erzen, welche nicht über nussgroß sein dürfen, und mit Kohlen angefüllt, welche die Schmelzer auf Stufen, die auf der einen Seite des Ofens angebracht sind, hinauftragen und einwerfen. Aus solchem Erz, wenn es einmal oder zweimal geschmolzen ist, wird dann ein Eisen erhalten, das geeignet ist, in dem Herd eines Eisenofens von neuem ausgeheizt und unter jenem großen Eisenhammer ausgebreitet und mit scharfen Eisen in Stücke zerschroten zu werden.
(Stahl.) So macht die Kunst mittels Feuer und Zuschlägen das Eisen und aus diesem den Stahl, welchen die Griechen στόμωμα nennen. Man wähle solches Eisen aus, das leicht fließt, dabei hart ist und das sich leicht ausstrecken lässt. Denn wenn es auch aus Erzen, die mit andern Metallen gemischt sind, erblasen schmilzt, so ist es doch entweder weich oder spröde (fragile). Ein solches Eisen aber soll zuerst glühend in kleine Stücke zerschlagen, sodann mit zerkleinerten, leichtflüssigen Zuschlägen vermischt werden: danach mache man in dem Frischherd einen Tiegel, aus demselben angefeuchteten Pulver, aus welchem man die Tiegel macht, die sich vor den Öfen, in welchen man die Gold- und Silbererze schmelzt, befinden, mit einer Weite von 1½ Fuß und 1 Fuß tief. Die Bälge aber sollen so gesetzt werden, dass sie durch die Form in die Mitte des Tiegels blasen: hierauf fülle man den Tiegel mit den besten Kohlen und setze ringsherum Bruchsteine, welche die Eisenstücke und die darüber geschütteten Kohlen zusammenhalten: aber sobald die Kohlen in Brand sind und der Tiegel glüht, lässt man den Wind blasen und der Zerennmeister gibt von der Mischung von Eisen und Flusssteinen so viel auf, als ihm einzuschütten geboten erscheint; in diese taucht er, sobald sie geschmolzen ist, vier Eisenluppen, von denen eine jede 30 Pfund wiegt, ein und soll sie bei starkem Feuer fünf oder sechs Stunden schmelzen und dabei mit einer Krücke das flüssige Eisen öfter umrühren, damit die kleinen Öffnungen der Luppen den zartesten Teil derselben einsaugen, welche Teile durch ihre Kraft die fetten Teile der Luppen verzehren und ausdehnen: wodurch sie weich und einem Hefenteig ähnlich werden. Hierauf soll der Meister unter Beihilfe des Vorläufers eine Luppe mit der Zange herausziehen und auf den Amboss bringen, damit der Hammer, der durch das Rad abwechselnd auf und ab bewegt wird, sie ausbreite. Ist dies geschehen, so wirft er sie noch heiß in das Wasser und löscht sie ab: das so Abgelöschte bringt er wiederum auf den Amboss und zerbricht es, indem er es mit demselben Hammer schlägt. Indem er die Stücke sofort betrachtet, sieht er, ob noch irgendwo sich Eisen zeigt, oder ob die ganze Masse dicht und in Stahl umgewandelt erscheint. Danach nimmt er ein Luppenstück nach dem andern mit der Zange heraus und zerbricht es nach dem Ausrecken in Stücke, dann macht er die Mischung (das Werk — den Sauer) wieder heiß und setzt von der frischen einen Teil zu: welcher das ersetzt, was die Luppen aufgesaugt haben und die Kräfte des übrigen Teils auffrischt, so dass es die Masselstücke, welche danach wieder in den Herd eingelegt werden, besser reinigt, deren jedes er, nachdem sie wie die ersten ausgeheizt sind, mit der Zange fasst, unter den Hammer bringt und in die Form von Stäben ausreckt. Diese wirft er noch glühend in ganz kaltes, fließendes Wasser, das nahe dabei sein muss, wodurch es sich sofort verdichtet und in lauter Stahl verwandelt wird, welcher viel härter und weißer ist als Eisen.
Fügen wir hier noch hinzu, dass Agricola das Verzinnen eiserner Geschirre erwähnt und dass er über die Verwendung der Steinkohle im Schmiedefeuer von den Eisenschmieden im Meißnischen bereits im Bermannus berichtet, so haben wir wohl alle Stellen zusammengestellt, die in seinen Werken auf die Eisenindustrie Bezug haben.
Einen besonderen Wert erhält das Buch des Agricola „De re metallica“ noch durch die vorzüglichen Zeichnungen, mit denen es ausgestattet ist. Dieselben sind in realistischer Weise von einem begabten Künstler, der selbst metallurgisches Verständnis hatte, nach der Natur aufgenommen. Es war dies Basilius Wefring, Bürger in Joachimsthal, wie Mathesius in seiner Joachimstaler Chronik bezeugt, welcher die 264 Zeichnungen jedenfalls unter Agricolas Leitung angefertigt hat.
Vanuccio Biringuccio.
War Georg Agricola der hervorragendste deutsche metallurgische Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, so war dies für die Völker romanischer Zunge der Italiener Vanuccio Biringuccio.
Er war ein Zeitgenosse des Agricola, als metallurgischer Schriftsteller sogar sein Vorläufer, denn die erste Auflage seiner Pyrotechnia erschien bereits 1540. Auch war dem Agricola das Buch des Biringuccio bekannt, als er sein Werk „über die Metalle“ schrieb, und er bekennt selbst in seiner Vorrede, es benutzt zu haben. Das Buch des Agricola ist aber so originell, so ganz auf eigener Erfahrung und Beobachtung aufgebaut, dass sich kaum nachweisen lässt, wo er sich der Schriften des Italieners bedient habe. Trotz der Vortrefflichkeit der Hüttenkunde des Agricola bleibt es aber doch zu beklagen, dass durch den Beifall und die Anerkennung, welche dieses Werk sich sofort nach seinem Erscheinen in Deutschland erworben hatte, das höchst originelle und inhaltsreiche Buch des Biringuccio bei uns unbeachtet blieb, so dass dieses, während es in Italien und Frankreich denselben Ruhm erlangte, wie bei uns die Metallurgie des Agricola und in zahlreichen Auflagen verbreitet wurde, in Deutschland so gut wie unbekannt blieb, und als J. Beckmann in seinen „Beiträgen zur Geschichte der Erfindungen“ (Bd. I, S. 133 etc.) 1780 wieder die Aufmerksamkeit darauf lenkte, galt dies fast mehr der literarischen Kuriosität als dem reichen Inhalt, der noch heute eine Quelle der Belehrung bietet, welche erst von den neuesten metallurgischen Schriftstellern richtig gewürdigt worden ist. Leider gibt es keine deutsche Übersetzung des Werkes.
Das Buch des Biringuccio heißt einfach „Pyrotechnia“ oder genauer „Della pirotechnia, libri X“. Dasselbe ist aber kein „Feuerwerksbuch“, wie deren mehrere in dieser Periode erschienen sind und die sich darauf beschränken, die Künste vorzutragen, die ein geprüfter Büchsenmeister verstehen muss, sondern es ist ein systematisches Lehrbuch der Metallurgie, in dem allerdings der Guss und die Bearbeitung der Kanonen, die Pulverbereitung und die Minierkunst mit behandelt sind. Es ist in italienischer Sprache in Briefform verfasst.
Konnten wir von Georg Agricola eine ziemlich ausführliche Lebensbeschreibung geben, so wissen wir von Vanuccio Biringuccio (oder Biringoccio) fast nichts, als das, was er hier und da in seinem Buche über sich selbst eingestreut hat.
Er war von edlem Geschlecht in der Stadt Siena geboren, in welchem Jahre aber ist unbekannt. Er studierte Mathematik und Naturwissenschaften und wurde ein bedeutender, ja ein berühmter Ingenieur. Mazuchelli, der einzige Schriftsteller, der von Biringuccio etwas zu sagen weiß, nennt ihn einen Mathematiker, sehr erfahren besonders in der Kenntnis und der Schmelzung der Metalle, der um die Mitte des 16. Jahrhunderts gelebt habe. Er sei von verschiedenen Fürsten und Staaten seiner Kenntnisse wegen berufen worden, so von Peter Aloysius Farnese — den sein Vater Papst Paul III. 1545 zum ersten Herzoge von Parma gemacht hatte, der aber schon im Jahre 1547 ermordet wurde, von Herkules II. von Este, Herzog von Ferrara, der 1534 bis 1559 regierte — und ebenso von der Republik Venedig. Mazuchelli nennt ihn den ersten Italiener, der über Metallurgie geschrieben habe.
Aus den in seinem Buche zerstreuten Stellen über sich selbst geht hervor, dass er in jüngeren Jahren die Bergwerke und Eisenwerke des Fürsten Pandolfo im Tal von Boccheggiano zu leiten hatte und daselbst bedeutende Maschinenanlagen ausführte. Denn in dem Kapitel über die Eisenerze (Lib. I, Cap. VI) sagt er: „Die meisten Eisenerze sind so sehr mit andern Metallen vermischt, dass sie sich nur mit Mühe davon befreien lassen, wie ich solches in unserer Gegend bei Siena, als ich noch ein junger Mann war, erfahren habe, und zwar in dem Tale von Boccheggiano, wo sich mehrere Fabriken für Eisenbereitung des mächtigen Fürsten Pandolfo, deren Betrieb ich zu leiten hatte, befanden. Ich nahm zu den Eisenerzen von Elba noch diejenigen, welche in der Nachbarschaft gefunden wurden, hinzu und mit dem einen und dem andern habe ich schöne Erfahrungen gemacht.“ In einem andern Kapitel, wo er von den Blasebälgen und den Übertragungen spricht, erzählt er, dass er in dem genannten Tale von Boccheggiano eine große Maschinenanlage gemacht habe, bestehend aus einem großen Kübelrad, das eine Anzahl Bälge in Bewegung setzte, so dass diese vier Feuer gleichzeitig bedienen konnten, wofür man sonst vier Wasserräder nötig hatte. Er fügt bescheiden hinzu: „Ich kann Euch dies nicht durch eine Zeichnung deutlich machen, denn es wäre für mich eine zu schwierige Sache, es zu zeichnen.“
Ferner erfahren wir von Biringuccio, dass er zu seiner Ausbildung große Reisen, besonders nach Deutschland gemacht und dass er in diesem Lande seine Kenntnisse vom Erzschmelzen sehr erweitert hat.
Da, wo er in dem Kapitel „von den Öfen“ vom Ausschmelzen der Kupfer- und Silbererze spricht, sagt er: „Ich erinnere mich, in Deutschland, wo solche Kunst vielleicht am meisten in der ganzen Christenheit geübt wird und blüht, nicht allein diese Anordnung der Schachtöfen, sondern auch die Vorbereitung zum Schmelzen gesehen zu haben.“ Er schildert sodann das in Deutschland übliche Verfahren, silberhaltige Kupfererze in Schachtöfen zu schmelzen und fügt hinzu, dass er sich desselben selbst bedient habe.
Ebenso bemerkt er bei den Flammöfen, dass solche in Deutschland auch zum Schmelzen von Erzen in Anwendung seien, dass er zwar selbst keine gesehen habe, dass sie ihm aber dort mit Worten so gut erklärt worden seien, dass er eine Beschreibung davon liefern könne.
Besondere Erfahrung hatte er in dem Guss, sowie in dem Ausbohren der Geschütze, welche Künste er meisterlich beschrieben hat.
Als Stückgießer scheint er hochberühmt gewesen zu sein und als solcher hauptsächlich wurde er von Fürsten und Städten berufen. Er beschreibt die Flammöfen zum Schmelzen des Kanonen- und Glockenmetalls nach den Verbesserungen, die er selbst dabei gemacht und wie er sie konstruiert habe. „Ich will Euch nur von der Art von Öfen sprechen, welche ich ausgeführt habe, so oft ich dazu Gelegenheit hatte, wobei ich von keiner der oben erwähnten Formen Gebrauch machte, sondern von allen diejenigen Teile nahm, welche mir am zweckmäßigsten schienen.“
Ebenso beschreibt er Maschinen zum Ausbohren der Geschütze seiner eigenen Erfindung. Er spricht dabei von Erfahrungen, die er an unterschiedlichen Plätzen gemacht habe, wie z. B. zu Florenz, und von verschiedenen von ihm angewendeten Konstruktionen. So bohrte er schwere Stücke aus mittels einer starken Holzspindel, in der acht Bohrmesser eingesetzt waren. Das Riesengeschütz Leofante aber bohrte er mit einem großen „französischen Bohrer“, wahrscheinlich einem Radbohrer, aus.
Aus alledem ersehen wir, dass er ein tätiger, erfindungsreicher Ingenieur war. Sein Todestag ist uns ebenso unbekannt, wie der Tag seiner Geburt und wir wissen nicht, wo seine Gebeine beigesetzt worden sind.
Vanuccio Biringuccio war ein Mann der ausübenden Praxis und dies drückt auch seinem Buche den Stempel auf. Es ist nicht in gewähltem Latein geschrieben, wie das des Agricola, sondern in seiner Muttersprache, leichthin erzählend, sogar des Autors toskanischen Dialekt nicht verleugnend. Es ist nicht so gelehrt und im Einzelnen durchdacht und abgemessen, wie Agricolas Schriften, aber seine Ausdrucksweise ist gefällig, klar und lebendig. Meisterhaft sind seine Schilderungen und Beschreibungen technischer Vorgänge, anschaulich und unmittelbar, wie dies nur derjenige vermag, welcher die Dinge, die er beschreibt, selbst kennt und erlebt hat. Dabei hält er sich fern von aller Pedanterie und bleibt auch in ausführlichen Einzelbeschreibungen noch fesselnd. Die leichte Briefform unterstützt dies wesentlich. Sie ist zwar nicht ganz streng festgehalten, aber indem der Verfasser immer eine dritte Person anspricht und ihr die Dinge, die er vorträgt, zu verdeutlichen bestrebt ist, wird er von selbst deutlich und der Leser versetzt sich unwillkürlich an die Stelle des Angeredeten. Der Zweck, zu belehren, liegt schon in dieser Form, wenn er auch nur gelegentlich betont wird. Dabei ist der umfangreiche, spröde Stoff meisterlich disponiert, logisch geordnet und übersichtlich behandelt.
Werfen wir nun einen Blick auf das Werk selbst.
Die erste Ausgabe erschien im Jahre 1540 in Venedig in Folio mit einer Zueignungsschrift von Moncelesi an Navo, aber ohne den Namen des Verfassers unter folgendem Titel: Della pirotechnia, libri X dove ampiamente si tratta di ogni sorte e diversita di miniere, ma ancora quanto si ricerca intorno alla pratica, di quelle cose, di quel che si appartiene a l’arte della fusione, ovver gitto de metalli come d’ogni altra cosa simile a questa. — In Venezia per Ventorino Roffinello 1540. 4°. —
Eine zweite Ausgabe erschien ebenfalls anonym 1550. „Venezia per G. Padovano a instanzia di Curzio Navo.“
Eine dritte Ausgabe mit dem Namen des Autors erschien um 1558 zu Venedig und schon im folgenden Jahre eine neue vierte Auflage in Kleinoktav, welche ich besitze und deren Titel verdeutscht folgendermaßen lautet: „Des G. Vanuccio Biringuccio von Siena zehn Bücher von der Feuerkunst, in denen nicht nur von den Verschiedenheiten der Mineralien gehandelt wird, sondern auch von der Art ihrer Gewinnung; sowie von dem, was zur Kunst des Schmelzens und Gießens gehört, Glocken und Geschütze zu machen, Kunstfeuerwerk und andere sehr nützliche Dinge. — Von neuem durchgesehen und gedruckt mit den Abbildungen der bemerkenswertesten Dinge zu Venedig in der Druckerei des P. Gironimo Giglio und Genossen 1559.“
Vorgedruckt ist dem Texte ein Vorwort des Vanuccio Biringuccio von Siena an den Herrn Bernardino Moncelese von Salo.
Eine fünfte Auflage erschien zu Bologna 1678.
Es gibt drei französische Übersetzungen der Pyrotechnia, die älteste von 1556 par Jacques Vincent à Paris chez Claude Fremy, die zweite von 1572, die dritte von 1627. Die Übersetzung von Vincent ist unvollständig, indem verschiedenes darin ausgelassen ist. Eine späte lateinische Übersetzung erschien 1658 zu Köln in Quart.
Das Werk zerfällt, wie der Titel besagt, in zehn Bücher, deren Hauptinhalt der folgende ist:
Nachdem in der Einleitung einiges über den Bergbau gesagt ist, handelt das erste Buch von den Metallen und deren Erzen; das zweite von den Halbmetallen und deren Zugutemachung; das dritte von dem Probieren der Erze, von ihrer Vorbereitung zum Schmelzen, von den Blasebälgen, Öfen und den Hüttenwerken und den Hüttenprozessen, wobei auch schon des Saigerns des Schwarzkupfers gedacht wird; das vierte von der Goldscheidung und der Bereitung des Scheidewassers; das fünfte von den Legierungen des Goldes, Kupfers, Silbers und Zinnes; das sechste von der Formerei, besonders von dem Gusse der metallenen Geschütze und Glocken; das siebente enthält die Beschreibung der Schmelzöfen, der Bälge und Balgengerüste, der Bohrmühlen zum Kanonenbohren und des Gusses eiserner Kugeln; das achte handelt vom Gusse kleiner Gegenstände; das neunte vom Destillieren, Sublimieren und von der Münzkunst, sowie vom Gold- und Eisenschmieden, von der Zinnverarbeitung, der Schriftgießerei, Drahtzieherei, dem Vergolden, der Anfertigung von Metallspiegeln und endlich noch von der Töpferkunst und dem Kalkbrennen; das zehnte von der Bereitung des Schießpulvers, der Feuerwerkerei und Minierkunst.
Ohne auf den reichen Inhalt der einzelnen Bücher näher einzugehen, wollen wir nur eine Übersicht derjenigen Kapitel geben, die mehr oder weniger direkt auf das Eisenhüttenwesen Bezug haben.
Im ersten Buche trägt das sechste Kapitel die Überschrift von den Erzen des Eisens und von seiner Natur. In demselben ist nicht nur eine Beschreibung der Eisenerze gegeben, sondern auch schon das Ausschmelzen der Erze geschildert. Deshalb lässt Biringuccio hierauf sogleich die wichtige Darstellung „von der Praxis der Stahlbereitung“ als siebentes Kapitel folgen.
Im zweiten Buche sind nur etwa die Kapitel über die Kiese und Vitriole, dann über den Magnetstein und die Ockerarten zu erwähnen.
Im dritten Buche sind folgende Kapitel für uns von Interesse: „Von dem Verfahren, alle Erze zu probieren“; „Die Vorbereitung der Erze zum Schmelzen“; „Über die Gestalt der Blasebälge und der Schmelzöfen“; und „Von der Art und Weise, wie man beim Verschmelzen der Erze zu verfahren hat“; endlich das Schlusskapitel „Über die Eigenschaften und Verschiedenheit der Holzkohlen und die Art, wie man sie zu bereiten pflegt“.
Das vierte und fünfte Buch enthalten nichts auf das Eisen Bezügliches.
Das sechste Buch dagegen, welches den Guss der Kanonen und Glocken beschreibt, ist für die Formerkunst von größter Wichtigkeit, wie schon aus der Aufzählung der einzelnen Kapitel hervorgehen wird. Sie lauten: „Über die Beschaffenheit des Formsandes“; „Über die Herstellung der Formen“; „Über die Verschiedenheit der Geschütze und ihrer Dimensionen“; „Über das Formen der metallenen Verzierungen“; „Über das Formen der Kanonen“; „Wie man die Seele der Geschütze formt“; „Wie man den dritten Teil des Geschützes, „die Büchse“ genannt, formt“; „Über die Gusstrichter und die Windpfeifen bei den Formen“; „Über das Trocknen der Formen“; „Was man bei der Herstellung der Geschütze wissen und beachten muss“; endlich „Große Glocken zu formen und zu gießen“.
Hieran reiht sich unmittelbar das siebente Buch, welches hauptsächlich die Vorrichtungen zum Schmelzen und Gießen und die verschiedenen Arten desselben schildert, und zwar in den folgenden Kapiteln: „Wie man die verschiedenen Flammöfen (Reverberieröfen) zum Metallschmelzen macht“; „Über deren Konstruktion“; „Wie man die Schmelzgrube, die Schüssel oder den Test macht“; „Wie man den Korb macht“; „Von dem Schmelzen in Tiegeln, — im Herd (a crogiolo), — in kleinen Wind (Gebläse) öfen“; „Über das Schmelzen der Bronze und anderer Metalle im allgemeinen“; „Bemerkungen über den Guss von Geschützen“; „Über Bronzen und über zusammengesetzte und legierte Metalle überhaupt“; „Über verschiedene Erfindungen betreffs der Blasebälge zum Metallschmelzen“; „Über das Fertigmachen der Geschütze und der Geschützwagen“; „Über den Guss der eisernen Kugeln für grobe und leichte Geschütze“.
Das achte Buch handelt zunächst von verschiedenen Arten Formsand zu machen, um kleine Bronzegussstücke darin zu gießen; Von der Art, das Salz zu präparieren, um die Lauge dem Formsande beim Gießen zuzusetzen; Von den Regeln und der Art des Formens im Staubsande mit Gießrahmen oder hölzernen Kästen in der Kleingießerei; Methode, den Staubsand zu machen, um jedes Metall in die feuchte Form zu gießen und die Art des Formens; Methode, verschiedene Modelle (relievi) abzuformen; Von verschiedenen Stoffen, welche die Eigenschaft haben, das Metall flüssiger zu machen.
Im neunten Buche, welches die allgemeine Überschrift „Von verschiedenen andern wichtigen Wirkungen des Feuers“ trägt, sind die für uns wichtigsten Kapitel das von den Eisenschmieden und das vom Ziehen des Eisendrahtes.
Das zehnte Buch enthält nichts, was sich speziell auf die Eisenindustrie bezieht.
Aus dieser Inhaltsübersicht ergibt sich schon, dass Biringuccios Mitteilungen über das Eisen viel mannigfaltiger sind, als die des Agricola; sie sind auch, soweit dies das Gebiet der Technik betrifft, also über das Schmelzen, Gießen, Schmieden von Eisen und die Stahlbereitung, viel ausführlicher, und so verlockend es wäre, sämtliche bezügliche Stellen in ausführlicher Übersetzung, in ähnlicher Weise, wie wir es bei Agricola getan haben, zusammenzustellen, so würde dies doch zu weitläufig werden und zu unnötigen Wiederholungen Veranlassung geben, weil wir die betreffenden Stellen der Pyrotechnia doch wieder bei der speziellen Geschichte der Eisentechnik im 16. Jahrhundert bei jeder einzelnen Schilderung anführen müssen. Da erscheint es uns aber als eine Ehrenschuld, dem großen, zu wenig bekannten Metallurgen gegenüber, seine Aussprüche möglichst wortgetreu wiederzugeben.
Georg Agricola und Vanuccio Biringuccio sind diejenigen Schriftsteller, deren Werke das Fundament der metallurgischen Wissenschaft gelegt haben. Alle folgenden Autoren auf diesem Gebiete im 16., 17. und noch teilweise im 18. Jahrhundert stehen auf ihren Schultern und sind kaum über sie hinausgekommen. Wir können bei diesen späteren deshalb auch meist kurz verweilen.
Sonstige Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, die über das Eisen geschrieben haben.
Ein Zeitgenosse Georg Agricolas war Christoph Enzelius von Saalfeld, der unter demselben Titel wie jener ein Buch De re metallica schrieb. Es ist dies aber durchaus keine Hüttenkunde, sondern vielmehr ein Kompendium der Mineralogie, in der Hauptsache nur ein Auszug aus den Schriften des Agricola. Eine gewisse ausdrucksvolle Kürze und Übersichtlichkeit war es wohl zumeist, die Philipp Melanchthon veranlasste, die Drucklegung des Buches zu veranlassen, denn kein geringerer als der berühmte Reformator und vielseitige Gelehrte stand ihm Pate. Enzelius, der, wie Agricola, ebenfalls Arzt war, schrieb sein mineralogisches Kompendium ausdrücklich zum „Gebrauch der Medizin“. Doch scheint er dem Ruhm und der allgemeinen Anerkennung der Schriften des Agricola gegenüber zaghaft gewesen zu sein, seine Schrift zu veröffentlichen.
Dies bewirkte Melanchthon, der, wie Luther und Mathesius ein großer Freund und Förderer der Mineralogie und der Bergbaukunde, den pädagogischen Wert des mit gründlichem Fleiß und mit Verständnis ausgearbeiteten Buches wohl erkannte. Er schickte es bereits im August 1551 mit einem empfehlenden Einführungsschreiben an seinen Freund, den Drucker und Verleger Christian Egenolf in Frankfurt mit der Bitte, es drucken zu lassen. Doch geschah dies erst 1557 von den Erben des inzwischen verstorbenen Egenolf. In dem erwähnten Briefe, welcher dem Buche an Stelle einer Vorrede vorgedruckt ist, sagt Melanchthon ausdrücklich, dass das Buch durchaus nicht den Anspruch mache, mit den Schriften des berühmten Agricola in Wettbewerb zu treten, dass aber die fleißige Arbeit wohl ein dankenswerter Beitrag zur philosophischen Wissenschaft sei.
Der Abschnitt über das Eisen (Lib. I, Cap. XXVIII) bietet dem Historiker nur wenig, doch werden wir auf einige Bemerkungen über Gangerz und Sumpferz und das daraus gewonnene Eisen, sowie über Torf und Steinkohlen später zurückkommen.
Ein Schüler und Freund des Agricola und sein begeisterter Verehrer war der gelehrte Georg Fabricius von Meißen. Er war es, der nach Agricolas plötzlichem Tode die Drucklegung des Werkes „De re metallica“ besorgt hat. Das diesem Werke vorgedruckte, schwungvolle lateinische Gedicht „an den Leser“ trägt aber bereits die Jahreszahl 1551. Außer verschiedenen Lobgedichten auf Agricola verfasste Fabricius auch einige metallurgische Schriften, die aber erst nach seinem Tode im Druck erschienen. Sie enthalten indes nur Worterklärungen und Erläuterungen zu Agricola.
Ein origineller Schriftsteller war dagegen Lazarus Erker von Annaberg, der das erste selbständige Werk über die Probierkunst geschrieben hat. Er behandelt darin allerdings fast ausschließlich die Prüfung der Gold-, Silber-, Kupfer- und Bleierze. Was er über das Probieren der Eisenerze sagt, werden wir später mitteilen, hier sei nur erwähnt, dass daraus hervorgeht, dass zu seiner Zeit der Hochofen- und Frischprozess schon allgemeine Verbreitung gefunden hatte. Sein Probierbuch erschien 1574 unter folgendem Titel: „Beschreibung der allerfürnemsten Mineralischen Ertzt vnd Berckwerksarten, dieselbigen ...... trewlich vnd fleißig an Tag geben durch Lazarus Erckern.“ Die Vorrede ist an den „allerdurchleuchtigsten etc. Herrn Maximiliano den Andern“ gerichtet und schließt mit der Unterschrift „geben Prag, nach Christi vnsres Seligmachers geburt im ein Tausent fünff hundert und vier und Siebenzigsten Jahre den III. Septembris u. s. w. Lazarus Ercker von Sant Anna Berck“ ......, „gedruckt zu Prag inn der Alten Stadt durch Georgen Schwartz M.D.LXXIIIj.“ Dieses Werk fand großen und dauernden Beifall. Es blieb lange das angesehenste Probierbuch und wurde infolgedessen auch in den folgenden Jahrhunderten mehrfach neu aufgelegt. Es existiert noch eine ganze Anzahl von „Probierbüchlein“ aus dem 16. Jahrhundert, unter denen die von Cyriakus Schreitmann von 1578 und das von Modestin Fachs von 1595 die bekanntesten sind. Doch ist in sämtlichen das Eisen nur nebenher behandelt, indem die Silber- und Goldproben den Hauptinhalt ausmachen.
Von weit größerem Interesse selbst vom technischen Standpunkt aus sind die originellen Bergpredigten des Mathesius, Pfarrers von Joachimsthal, namentlich diejenigen, welche in seiner „Sarepta oder Bergpostill“ enthalten sind.
Es ist eine merkwürdige Zeit und merkwürdige Umstände, denen dies eigenartige Werk seine Entstehung verdankt. Eine kurze Schilderung derselben wird uns, ebenso wie die Lebensbeschreibung des Agricola, ein richtigeres Bild davon geben, als lange kulturgeschichtliche Auseinandersetzungen.
Der Bergbau auf silberhaltige Erze im Erzgebirge hatte gegen das Ende des 15. Jahrhunderts einen wunderbaren Aufschwung genommen, besonders auf der sächsischen Seite waren im Meißnischen durch die Erschürfung reicher Silbererzänge blühende Städte, wie Schneeberg, Annaberg und Marienberg, entstanden, welche mit ihrem Bergsegen den Herzog Albrecht von Meißen zum reichsten Fürsten Deutschlands machten. Bekannt ist, dass einst in Schneeberg eine so große Silberstufe gewonnen wurde, dass der Herzog mit seinen Gästen in der Grube daran zu Tafel sitzen konnte, wobei er in die Worte ausbrach: „Der Kaiser Friedrich ist ein mächtiger Herr, aber solch einen Tisch, daran wir sitzen, hat er doch nicht.“ Aber die Glanzzeit der sächsischen Bergstädte dauerte nicht lange. Der Reichtum, den die Natur bot, verwöhnte die Bergleute, so dass sie nur raschem und mühelosem Gewinn nachgingen. Die reichen Mittel, die über der Talsohle lagen und durch Stollen aufzuschließen waren, wurden rasch abgebaut, dann aber verließen die meisten durch den leichten Erwerb zu Abenteuern geneigten Bergleute die Bergwerke, um an einem andern Orte, wo man „fündig“ geworden war, in gleicher Weise ihr Glück zu versuchen. Es waren ähnliche Zustände, wie wir sie in unserm Jahrhundert bei den Goldfeldern von Kalifornien und Australien erlebt haben. In gleicher Weise lockte der Ruf des Silberreichtums des Erzgebirges Abenteurer aus allen Ländern und aus allen Ständen an. Städte entstanden in unwirtbaren Gegenden in erstaunlich kurzer Zeit, um oft ebenso rasch wieder zur Unbedeutendheit herabzusinken, wenn der Bergsegen erschöpft war. Dies war bei dem sächsischen Silberbergbau im zweiten Jahrzehnt des sechzehnten Jahrhunderts bereits eingetreten. Die reichen Erzmittel waren abgebaut, die Ausbeute ließ nach, die fahrenden Bergleute sahen sich nach lohnenderer Arbeit um.
Da erklang plötzlich die Kunde von reichen Silberanbrüchen „im Tal“ im böhmischen Erzgebirge. „Zum Tal“ — noch hatte der Platz keinen andern Namen — wurde die Losung der Bergleute. „Im Tal, im Tal mit Mutter und All“, das war der Ruf, der durch das ganze Erzgebirge scholl, wie Mathesius berichtet. Zwei sächsische Bergleute, Bach aus Geyer und Öser aus Schlackenwert, waren es gewesen, die wahrscheinlich im Jahre 1510 den ersten Bergbau „im Tal“ eröffnet hatten. Doch war ihr Erfolg nicht groß und fehlte es ihnen an Mitteln, ihren Bau fortzusetzen. Da bildete sich 1515 in Karlsbad eine Gewerkschaft zur Ausbeutung der Erzgänge im Tal, der namentlich der Hauptgrundbesitzer der Gegend Graf Stefan Schlick beitrat. Diese erzielte schon 1516 glänzende Ausbeute und wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht davon im Erzgebirge. Scharenweise kamen Bergleute und Kolonisten gezogen.
Überall fand man Silber, gediegen oder als reiches Rotgiltigerz, unter dem Rasen und unter Baumwurzeln, ähnlich, wie in Peru oder Bolivien. Im folgenden Jahre 1517 war schon eine Ortschaft entstanden mit einer Kapelle. 1518 wählten die Bergleute bereits zwei Bergmeister und einen Bergrichter, und die Grafen Schlick, die sich als Bergherren ansahen und das Regal beanspruchten, erließen eine neue Bergordnung mit zeitgemäßeren Bestimmungen als die alte Wenzeslaussche; auch prägten sie die ersten Silbermünzen, da sie sich das Münzrecht gleichfalls anmaßten, die unter dem Namen der „Taler“ bald in alle Welt gingen und sich als Münzname dauernd erhalten hat. Das erste Schulhaus wurde bereits 1518 erbaut. 1520 wurde die in drei Jahren entstandene Stadt im Tale unter dem Namen Joachimsthal zur freien Bergstadt erhoben. In demselben Jahre wurde auch schon die berühmt gewordene Lateinschule daselbst eröffnet.
Es war eine eigentümlich gemischte Gesellschaft, die sich in der neuen Stadt zusammengefunden hatte. Viel unruhige Köpfe waren darunter, das bewiesen die Aufstände, die in den Jahren 1523 und 1525 ausbrachen, aber auch viele tüchtige, nach Besserem ringende Kräfte, das bezeugen die vielen gemeinnützigen Stiftungen aus eigener Kraft und eigenen Mitteln und die gute städtische Verwaltung. Im Jahre 1525 wurden die bei dem Aufruhr vernichteten Statuten der Stadt erneuert und Dienstag nach Mariä Geburt öffentlich bekannt gemacht. Diesem Statut war bereits eine sehr gute Handwerkerordnung mit ausführlichen Lohnfestsetzungen, selbst einer Apothekertaxe beigefügt; ferner ein Luxusgesetz für Hochzeiten, Vorschriften über Leichenbestattung, eine Feuerordnung u. s. w. Die Stadt wuchs immer größer, so dass Sebastian Münster berichtet: „Umb das jar Christi 1526 hat man im Joachimsthal angefangen zu bawen, und ist dies Tal so voll Gebavs gesteckt worden oben und unden, dass die Heuser auff einander hocken und eine anzeigung geben einer großen Stadt“, und im Bermannus sagt Agricola 1528, dass Joachimsthal an Städte wie Erfurt und Prag erinnere. Die erwähnten Aufstände entstanden teils aus dem Widerstreben der unruhigen Bevölkerung gegen eine strenge Handhabung der Ordnung besonders in Bergsachen, teils aus dem Widerstande gegen die Heeresfolge, welche die Bergleute den Grafen Schlick mit Recht weigerten; endlich aus dem Zerwürfnis der Schlickschen mit dem Kaiser, welches zuerst darin seinen Ausdruck fand, dass König Ferdinand I. nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1528 den Grafen Schlick das angemaßte Münzrecht entzog. Indessen hören wir nach der Unterdrückung des Aufruhrs vom Jahre 1525 nichts mehr von ernsten Kämpfen in der Stadt, vielmehr war die darauf folgende Zeit eine Periode glänzender, friedlicher Entwicklung. Im Jahre 1527 kam Agricola als Stadtarzt nach Joachimsthal. 1530 wurde aus freiwilligen Beiträgen ein Spital und ein Friedhof erbaut und 1534 bis 1537 eine neue Kirche ganz aus eigenen Mitteln errichtet.
Die Joachimstaler hatten sich von Anfang an entschieden der Reformation Luthers zugewendet. 1532 wurde Johannes Mathesius als Rektor an die Lateinschule berufen. Er war am 24. Juni 1504 zu Rochlitz in Sachsen geboren, von angesehener Familie, die mehrere gelehrte Glieder besaß, darunter Burgard Mathesius, der lange Rektor bei St. Sebald in Nürnberg und später Vikar vom Stifte Bamberg war. Johanns Vater Wolfgang war Ratsherr zu Rochlitz. Auch in diese Stadt, in deren Umgebung schon früher Bergbau betrieben wurde, war das Silberfieber, welches damals das ganze Erzgebirge ergriffen hatte, eingezogen. Der alte Wolfgang beteiligte sich eifrig dabei, scheint aber sein ganzes Vermögen dabei zugesetzt zu haben, so dass, als er im Jahre 1521 starb, der verwaiste siebzehnjährige Johannes fast mittellos dastand. Doch hatte er bereits einen Blick in das Bergmannsleben tun können, denn sein Vater hatte schon in dem Jahre 1518 dem vierzehnjährigen Sohne eine Anstellung als Zubusseeinnehmer auf einer Zeche verschafft gehabt. Nach des Vaters Tode aber verließ er Rochlitz und zog, seinem inneren Berufe folgend, als fahrender Schüler nach Nürnberg, wo sein Vetter Burkhard Rektor war. Es folgten nun wechselvolle Jahre der Prüfung für Johannes. Mit Luthers Schriften wurde er 1525 zuerst bekannt. Sie erweckten in ihm die Sehnsucht, den kühnen Reformator persönlich kennen zu lernen, und so zog er 1528 zum ersten Mal nach Wittenberg, das damals in höchster Blüte stand, wo neben Luther Philipp Melanchthon, Justus Jonas und Johann Bugenhagen wirkten. Sein Herzenswunsch war erfüllt, er saß als eifriger Schüler zu den Füßen des großen Mannes, dem er später so viel näher treten sollte.
Damals gestattete ihm die Knappheit seiner Mittel nicht, seinen Wunsch, auch noch Theologie zu studieren, zur Ausführung zu bringen. Er musste für seinen Lebensunterhalt sorgen und so nahm er nach zwei Jahren 1530 die ihm von seinen ihn hochschätzenden Lehrern angebotene Stelle als Lehrgehilfe des Andreas Misenus zu Altenburg an. Von da wurde er bereits 1532, wie oben erwähnt, als Rektor an die Lateinschule nach Joachimsthal berufen. Hier begann und endete sein segensreiches Wirken. Leicht wurde ihm das anfangs freilich nicht gemacht. Er, der streng an Luthers Lehren hielt, fand mancherlei Widersacher. Zwar bekannten sich die Joachimstaler mit Eifer zu der neuen evangelischen Lehre, aber es spukte viel Unklarheit in den Köpfen dieser Bekenner. Den Samen dazu hatte der erste Pfarrer von Joachimsthal, Joh. Sylvius Egranus (Johann Wildauer aus Eger), selbst gegeben, der zwar, ehe er 1521 von Zwickau hierher berufen wurde, mit Luther eng verbündet gewesen war im Kampfe gegen Thomas Münzer und die Wiedertäufer, der aber sonst mehr der katholisierenden Richtung zuneigte und durchaus nach seinem Kopfe reformieren wollte. Schon vor ihm aber hatte das Silberfieber und der Ruf „zum Tale“ neben manchen fahrenden Schülern und Studenten, die ihrer alma mater den Rücken gekehrt hatten, um hier rasch reich zu werden, auch den unruhigen Karlstadt hierher geführt, der mit seinem fanatischen Eifer auch schon manche Köpfe verdreht hatte. Dass auch die Wiedertäufer eifrig und mit Erfolg hier für ihre Lehre warben, sieht man aus den strengen Maßregeln, welche die Grafen Schlick gegen sie ergriffen. Alle Anfeindungen und Schwierigkeiten — die allerdings so groß waren, dass nur die Bitten und der treue Beistand des Stadtarztes Dr. Naevius ihn davon zurückhielten, seine Stelle aufzugeben und Joachimsthal zu verlassen — überwand Mathesius durch seine Treue und Tüchtigkeit in seinem Lehrberuf.
Von Jahr zu Jahr erkannten die Bürger Joachimsthals immer mehr den Wert des gerechten, aufrichtigen, gelehrten Mannes und bald wandten sich ihm aller Herzen zu. Dass die berühmtesten protestantischen Gelehrten, wie Melanchthon, Eoban Hesse, Justus Jonas und Georg Spalatin, in diesen Jahren 1535 bis 1537 nach Joachimsthal kamen, um ihm und der berühmt gewordenen Lateinschule, wo lateinische und griechische Schauspiele unter seiner Leitung mit bestem Erfolge aufgeführt wurden, ihren Besuch abzustatten, trug gewiss auch viel zur Erhöhung seines Ansehens bei. Ein rührender Zug ist es aber, dass die Dankbarkeit seiner Schüler und deren Eltern ihm die Mittel verschafften, den höchsten Wunsch seines Lebens, nämlich noch einmal nach Wittenberg ziehen zu dürfen und unter Luthers Leitung seine theologischen Studien zu vollenden, zur Erfüllung zu bringen.
Im Jahre 1538 machte ihn der Steiger Mathes Sax aus Dankbarkeit für den seinen Kindern erteilten Unterricht zum Mitgewerken bei einer neuen Zeche, wovon Mathesius in der Vorrede zu seiner Sarepta sagt: „Unser lieber Gott hat mir durch meiner Schüler dankbare Eltern etliche Küxlein zugeworfen, davon ich zwei Jahre zu Wittenberg zum andern Mal studiert und eine schöne kleine Liberei erzeugt habe.“ In Wittenberg gestalteten sich die Verhältnisse für ihn außerordentlich günstig. Er wurde Luthers Tischgenosse und schloss sich ihm in inniger, vertrauter Freundschaft an, so dass nach Luthers Tod keiner so berufen war, das Leben des großen Mannes zu beschreiben, wie Mathesius. Hier in Wittenberg erhielt er erst sein charakteristisches Gepräge. Er kehrte, von einer stattlichen Deputation von Joachimstaler Bürgern eingeholt, im Jahre 1541 als Pfarrer in das ihm liebe und zur Heimat gewordene Tal zurück. Luther hatte die sieben Mitglieder der Deputation im eigenen Hause bewirtet und so freundlich empfangen und wiederkommen heißen, dass dieselben im folgenden Jahre 1542 ihren Besuch wiederholten.
Mathesius fand in seinem neuen Amte viel Arbeit vor. Sein Hauptstreben, das auch von Erfolg gekrönt war, ging dahin, eine strengere Kirchenordnung in seiner Gemeinde einzuführen. Natürlich begegnete er hierbei mancherlei Widerstand. Aber auch die politischen Verhältnisse brachten ihm viel Unruhe. Die Grafen Schlick, die eifrige Protestanten und seine treuen Beschützer waren, hatten sich viele Hoheitsrechte angemaßt, für die sie keine Rechtstitel besaßen und die ihnen von der kaiserlichen Regierung bestritten wurden. Dieser Konflikt spitzte sich zum förmlichen Kampfe um den Besitz von Joachimsthal zu, bis im Jahre 1545 der Kaiser die Grafen Schlick mit Gewalt zur Entsagung zwang. Eine kaiserliche Kommission nahm die Stadt für den Kaiser in Besitz. Die alten Privilegien wurden aufgehoben und neue veröffentlicht. — Bei diesem ganzen Streit hatte Mathesius auf der Seite der Grafen Schlick gestanden, sowohl aus persönlicher Überzeugung, als weil er von der katholischen kaiserlichen Regierung für seine Gemeinde fürchtete. Als nun die kaiserliche Regierung an die Joachimstaler Bürger das Ansinnen stellte, Kriegsvolk zu stellen zur Einnahme der sächsischen Orte Pletten und Gottesgab, verweigerten diese, auf altes Bergrecht sich stützend, die Heeresfolge, und Mathesius forderte in seinen Predigten zum Widerstande auf. Dafür wurde er mit Bürgermeister und Rat zur Verantwortung nach Prag geladen. Es war gewiss ein saurer Gang für den pflichttreuen Mann. Von Mitte November 1545 bis Ausgang des Jahres mussten sie warten, wurden dann aber mit glimpflichem Verweis entlassen. Mathesius wurde allein vor den Kaiser beschieden und der kluge Herr, der bekanntlich ein eifriger Freund und Förderer des Bergbaues war und dem deshalb Joachimsthal sehr am Herzen lag, sprach so freundlich, milde und verständig mit Mathesius, dass dieser dem einzigen Verlangen des Kaisers, für die Folge sich aller aufreizenden Reden gegen die Obrigkeit zu enthalten, gern entsprach. Der Kaiser hatte durch seine Freundlichkeit sein Herz gewonnen und er blieb ihm in aufrichtiger Treue ergeben, wie manche Stellen seiner Predigten bezeugen. Nun aber brach der Schmalkaldische Krieg aus, der neue Unruhen über Joachimsthal, das natürlich fest beim Schmalkaldischen Bunde hielt, brachte. Doch die Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1547 entschied rasch das Schicksal der Stadt. Sie ergab sich dem kaiserlichen Bevollmächtigten Graf Hassenstein, freilich war der größte Teil der Bürger zuvor geflohen. Den Grafen Schlick wurden ihre Güter genommen, Graf Albin Schlick floh nach Thüringen zum Grafen von Gleichen, wo er starb. Der immer noch mächtige Einfluss der Schlick war damit gebrochen. Die Stadt wurde glimpflich behandelt, doch wurden ihr die alten Privilegien genommen. Am 10. Oktober 1547 erteilte der König der Stadt ein neues Privilegium in 14 Artikeln. In diesen wurde sie für alle Zeiten als freie Bergstadt anerkannt, doch wurden die Freiheiten der Bürger darin wesentlich eingeschränkt. Von da ab folgte nun eine lange Zeit der Ruhe für Joachimsthal, in der das segensreiche Wirken ihres treuen Pfarrers sich erst recht entfalten konnte. Freilich, die Glanzzeit Joachimsthals kehrte nicht mehr zurück, umso mehr aber Ruhe und Ordnung, so dass Mathesius in seiner Joachimstaler Chronik vom Jahre 1562 schreiben konnte: „In diesen vergangenen 14 Jahren ist gottlob kein Totschlag hier geschehen.“ Auch er fühlte sich glücklich in Joachimsthal, er liebte den Ort und seine Gemeinde, wie er auch von ihr geehrt und geliebt wurde. Deshalb lehnte er auch alle Berufungen zu glänzenderen Stellungen, darunter auch die zu einer theologischen Professur in Leipzig ab. Befriedigt schreibt er in der Einleitung zur Sarepta:
„Darneben hat mir Gott in diesem Gebirge unter den Herrn Schlicken gnädigen Herren gute und beständige Freunde, gehorsame Pfarrkinder und gottselige, fleißige Kollegen, einesteils gute Nachbarn, dankbare Schüler, die vielen Städten mit Ehren dienen, gegeben. Überdies eine bequeme luftige Wohnung und ein tugendliches Weib aus ehrlicher Freundschaft, liebe Kinder, treues Gesinde und darneben mit gelehrten Leuten große Kundschaft machen lassen, und feinen Hausfrieden und manche ehrliche Freude in diesem Tale mit vertrauten Leuten bescheret.“ Der häufige Besuch gelehrter und hochverehrter Freunde verschönte ihm auch den Aufenthalt. Melanchthon besuchte ihn noch zwei Jahre vor seinem Tode im Jahre 1558, welchen Besuch er dem schon erkrankten Freunde im folgenden Jahre erwiderte.
Mathesius selbst nahm der Tod plötzlich mitten in seiner Berufstätigkeit weg. Den 8. Oktober 1565 an einem Sonntage, als er eben über das Evangelium von der Auferweckung des Sohnes der Witwe gepredigt hatte, rührte ihn in der Kirche der Schlag und in wenigen Stunden war er eine Leiche. Die dankbare Knappschaft stiftete dem Vielbeweinten im Jahre 1572 ein Grabdenkmal.
Mathesius, ähnlich wie sein großer Freund Luther, in der harten Schule des Lebens gebildet, hatte einen biederen Sinn, einen treuen, edlen, echt deutschen Charakter. Dabei war er ein Mann nicht nur von tiefer, sondern von fast universeller Gelehrsamkeit. Er gehörte zu den hervorragendsten Theologen, Philologen und Pädagogen seiner Zeit; Geschichte, Münzkunde, Musik und die Dichtkunst pflegte er, am meisten aber interessieren uns seine mineralogischen, berg- und hüttenmännischen und technischen Kenntnisse, die ganz hervorragend waren. In der Jugend schon auf den Bergbau hingewiesen, wuchs sein Interesse an dem Berufe in Joachimsthal, das sein Entstehen und sein Bestehen allein diesem Industriezweige verdankte. Er studierte nicht nur die Bücher des Agricola, der ja auch den größten Teil seines bergmännischen Wissens in Joachimsthal gesammelt hatte, sondern er unterhielt sich mit Vorliebe mit den Bergleuten, fuhr selbst mit an und sammelte seltene Mineralien mit solchem Eifer und Erfolge, dass er sich rühmen konnte, in seiner Sammlung Stufen zu besitzen, die selbst Agricola nicht habe. Aus diesem warmen Interesse für den Bergbau und aus der Anregung, die Luther — selbst eines Bergmannes Sohn — gegeben hatte, hielt er jedes Jahr zu Joachimsthal eine besondere Bergpredigt, und die Sammlung dieser Bergpredigten ist das originelle Buch, welches er unter dem Namen Sarepta — bekanntlich eine altbiblische Bergstadt — veröffentlichte. Das Buch erschien 1562 unter dem Titel: „Die Sarepta oder Bergpostille, samt der Joachimstaler kurzen Chronik.“ Sie enthält 16 Predigten, welche der Reihe nach Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei u. s. w., sowie das Schmelzen, Münzwesen und Glasmachen umfassen, daran schließt sich dann eine chronistische, kurz gehaltene Darstellung der Geschichte von Joachimsthal von der Zeit seiner Entstehung an.
Die Predigten sind eine merkwürdige Verquickung von Technik und christlicher Theologie, aber so wahr, ernst gedacht und treffend, dass sie noch heute tiefen Eindruck machen. An das, was der Bergmann sieht und erlebt, knüpfen sich die Gleichnisse an, welche die Allmacht, die Güte, das Wirken Gottes, wie die Pflichten der Menschen bezeugen sollen, und dies geschieht in so sachverständiger, eingehender Weise, dass in gewissem Sinne die Sarepta doch ein Lehrbuch der Metallurgie genannt werden kann. Den Zweck, ein technisches Lehrbuch zu schreiben, verfolgte Mathesius zwar durchaus nicht, er verwahrt sich in seiner Vorrede sogar ausdrücklich dagegen, aber die mineralogischen und technischen Erklärungen, die mitgeteilten Ansichten über die Bildung der Mineralien, die Lagerung der Gesteine, den Bergbau, die Gewinnung und Behandlung der Metalle zeugen von so viel Erfahrung und Geist, dass sie für den Historiker zu einer Quelle der Belehrung werden.
Die Predigt, die uns für unsern Zweck besonders interessiert, ist die achte der Sarepta, gehalten um 1558 und überschrieben: „Bergpredigt vom Eisen, Stahel vnnd der Regiment Seulen Danielis.“ Sie knüpft an das Traumbild des Königs Nebukadnezar von der gewaltigen Bildsäule, dessen Haupt von Gold, dessen Brust und Arme von Silber, dessen Bauch und Lenden von Erz, dessen Schenkel von Eisen, dessen Füße aber teils Eisen, teils Ton waren (Daniel II), und zwar redet er insbesondere von den eisernen Füßen, „daran etliche irdene Zehen waren“. „Weil wir den bisher vom löthigen und silbrichten Golde und vom Silber und Kupfer geprediget, wollen wir im Namen des Herrn aller Herren heute von Eisen und Stahl reden und erstlich dies Metall, des kein Haus auf Erden gerathen kann, preissen und von seinem Namen, Natur und Eigenschaft und wie man es gräbt, rennet, schröt, zu Stahl machet, bergläufftiger Weise bei euch Bergleuten handeln, wie denn Daniel selber als ein Bergmann von des Eisens Stärke und Kraft redet.“
Mathesius gibt nun zunächst eine ausführliche Skizze über das Alter und die Geschichte des Eisens. Er hält das Eisen mit dem Kupfer für das älteste Metall, „denn da Adam graben und roden, Eva spinnen und wirken, Kain mähen und schneiden, Abel, Seth und Enoch opfern und schlachten sollten, konnten sie des Eisenwerks nicht geraten“. Wenn uns dieser naive Beweis auch nicht genügen dürfte, so gibt der Prediger hiernach eine reichhaltige Zusammenstellung andrer Beweisstellen aus den alten Schriften, besonders aus der Bibel, worin er seine gründliche Kenntnis der hebräischen Sprache beweist. Seine sprachlichen Untersuchungen und Betrachtungen sind in der Tat höchst neu und geistreich. So spricht er beispielsweise die Vermutung aus, der Name der Stadt Barcelona stamme von dem hebräischen barzel, Eisen, her, denn es sei eine Stadt der Phönizier gewesen und diese hätten dort das berühmte spanische Eisen eingehandelt, der Name sei also gerade gebildet wie etwa Ferrara in Italien oder Eisenach in Thüringen, „darinn der würdig Herr D. Luther seliger in die Schul gangen“.
Hierauf verbreitet er sich über das Vorkommen des Eisens und die Eisenbergwerke, wobei er hauptsächlich die der Nachbargebiete in Böhmen und Sachsen erwähnt. Er gibt genaue Angaben über Maß und Gewicht, wonach die Erze gekauft werden, wie auch über den Preis des Eisens. Sodann beschreibt er die Vorbereitung der Erze und das Ausschmelzen derselben. Schildert dann die Arten des Eisens und wie man Stahl aus Eisen macht. Hierbei macht er wieder mancherlei Anmerkungen, z. B. dass die Innsbrucker Harnischmacher jetzt den größten Ruhm hätten, dem Stahl die richtige Härtung zu geben, was dem dortigen Wasser zugeschrieben werde. Die Bergleute weist er darauf hin, wie wichtig bei dem Berggezäh das richtige Anschweißen des Stahles sei.
Auch seine Betrachtungen über die innige Verwandtschaft von Stahl, Eisen und Kupfer sind, wenn auch nicht richtig, doch interessant. Er führt nämlich aus, dass, wie Eisen sich in Kupfer verwandle beim Eintauchen in gewisse vitriolische Laugen, so entstehe aus Eisen Stahl, sei also im Wesen nichts Verschiedenes. — So findet sich in dem technischen Teile dieser großen Predigt eine ganze Reihe von historisch wichtigen Bemerkungen, und wenn der Leser etwa glauben möchte, dass eine so ausführliche technische Einleitung zu einer Predigt höchst ermüdend sein müsse, so wird jeder Berg- und Hüttenmann, der sie liest, den entgegengesetzten Eindruck empfangen.
An Bergleute war aber die Predigt gerichtet. Ihr Interesse wurde durch diese praktische Einleitung, die an ihr eigen Wissen und Können anknüpfte und doch vieles Neue und Merkwürdige brachte, so angeregt, dass sie imstande waren, die folgenden großartigen Ausführungen der Predigt zu verstehen. Denn nun entrollt der Prediger, indem er wieder zu dem Ausgangspunkte, der riesigen Bildsäule, die Nebukadnezar im Traume erschienen war und ihn so in Schrecken versetzt hatte, zurückkehrt, ein gewaltiges Bild der Weltgeschichte und des Weltgerichtes mit prophetischem Hinweis auf schwere Zeiten, die über unser deutsches Vaterland hereinbrechen würden (30jähriger Krieg); mit der ernsten Mahnung zu rechtzeitiger Einkehr. Die ganze Predigt ist von hohem historischen Interesse.
Unter den im 16. Jahrhundert erschienenen Fachschriften, in denen sich beachtenswerte Angaben über Eisen und Stahl finden, sind ferner noch zu erwähnen: Kentmanns Mineralogie 1565 und Conrad Gesners Abhandlung: De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus metallicis etc. 1565.
Die mystisch-alchemischen Schriften jener Periode, wie die des Morienus Romanus De re metallica, metallorum transmutatione etc. 1564 und des Th. Moresinus Liber novus metallorum causis et transsubstantiatione 1593 verdienen kaum der Erwähnung. Bedeutsamer ist dagegen des Nic. Monardo Gespräch über das Eisen, welches 1580 in spanischer Sprache unter dem Titel: Dialogo del hierro y de sus grandezas etc. zuerst erschienen ist. Es ist in Gesprächsform geschrieben und werden darin drei Personen, ein Doktor, ein Apotheker und ein Eisenhändler, ganz in der Weise von Agricolas Bermannus, redend eingeführt.
Der Eisenhändler Octunus, der aus Kantabrien gebürtig ist und die Eisenindustrie seines Heimatlandes genau kennt, gibt auf Veranlassung des Doktor Monardo eine Schilderung derselben, und führt alsdann aus, zu welchen Zwecken Eisen und Stahl verwendet werden. Dr. Monardus erklärt im zweiten Gespräche die Natur von Eisen und Stahl und seine Bedeutung in der Medizin. Nachdem Burgus, der Apotheker, auf des Doktors Veranlassung, die Bereitung der Eisen- und Stahlarzneien beschrieben hat, schildert Monardus die mannigfaltige Heilkraft derselben. Das Ganze ist wirklich, wie der Titel sagt, „ein nützlich und lustig Gespräch“, und die praktischen Zusätze des deutschen Übersetzers Jeremias Gesner erhöhen noch seinen Wert.
Andreas Cesalpini von Arrezzo (geb. 1519), Professor in Pisa und Leibarzt des Papstes Clemens VIII., war, wie Monardo, ein berühmter Mediziner und Botaniker, und schrieb, wie dieser, ein Buch über die Metalle, welches zuerst 1596 zu Rom und dann 1604 zu Nürnberg unter dem Titel: „De metallicis libri tres“ gedruckt wurde. Es ist eine sehr schätzbare Mineralogie, in der auch dem Eisen und Stahl ein Kapitel gewidmet ist (Lib. III, Cap. VI), doch sucht man technische Angaben darin vergebens.
Interessanter und wichtiger hierfür sind zwei enzyklopädische Werke. Das Buch De rerum varietate des Cardanus und der Piazza universale des Garzoni.
Hieronymus Castellioneus Cardanus aus Pavia, geboren 1501, gestorben 1576, war einer der gelehrtesten und scharfsinnigsten Männer seiner Zeit. Besonders berühmt ist er als Mathematiker und Cardans Regel zur Lösung der Gleichungen vierten Grades trägt heute noch seinen Namen. Ursprünglich Theologe, wendete er sich der Mathematik und den Naturwissenschaften zu, wurde 1553 Professor der Mathematik in Mailand, 1559 Professor der Medizin in Pavia und 1562 zu Bologna. Er beherrschte das ganze Gebiet der Naturwissenschaften. Von seinen Schriften fanden besonders die Bücher De subtilitate (1550) und De rerum varietate (1556) große Verbreitung. Das letztere wurde wiederholt ins Deutsche übersetzt, zuerst von Heinrich Pantaleon, der Arznei Doktor, unter dem Titel: Offenbarung der Natur und natürlicher Dinge, 1559. Cardanus war sehr eigenartig in seinem Denken, wenn auch ein eifriger Astrologe und fest an Geistererscheinungen glaubend, trat er doch den alten überlieferten Doktrinen als Revolutionär gegenüber. Er verwarf sie und erklärte alles aus dem Genius. Aus drei Universalprinzipien: Materie, Form und Seele und aus drei Elementen: Erde, Luft und Wasser erklärte er das Wesen aller Dinge. Die Physik und Mechanik verdanken ihm wichtige Entdeckungen: er untersuchte die Schwere der Luft durch Versuche und lehrte zuerst das Parallelogramm der Kräfte für den Fall, dass die Kräfte im rechten Winkel wirken. — Die Offenbarung der Natur ist eine Enzyklopädie des gesamten damaligen Wissens, darin sind auch die Metalle abgehandelt und seine Bemerkungen über Eisen und Stahl sind sehr beachtenswert und werden bei den betreffenden Abschnitten mitgeteilt werden.
Noch mannigfaltiger und reichhaltiger sind aber die Mitteilungen über Eisen und Eisengewerbe in dem originellen „Schauplatz“ des Garzoni. Thomas Garzoni, einer der größten italienischen Satiriker, war geboren zu Bagna-Cavallo in der Romagna 1549. Er hieß eigentlich mit seinem Taufnamen Oktavius, wofür ihm aber bei seinem Eintritt ins Kloster im Jahre 1566 der Name Thomas gegeben wurde. Sehr früh zeigte sich seine hohe Begabung und eine unbändige Lernbegier. Schon im 11. Jahre verfasste er ein italienisches Gedicht, das großen Beifall fand, obgleich es nichts schilderte, als die gewöhnlichen Händel der Kinder. Im 14. Lebensjahre studierte er bereits zu Ferrara Rechtsgelehrsamkeit, gab aber dieses Studium auf, nachdem er in seinem 17. Jahre Ordensbruder geworden war. Er starb, kaum 40 Jahre alt, als ein Canonicus regularis Lateranensis in seiner Vaterstadt den 8. Juni 1589. Garzoni, obgleich Ordensbruder, war durch und durch Realist und besaß eine große Kenntnis aller Lebensverhältnisse und eine vorzügliche Begabung, sie zu schildern. Er war ein scharfer Satiriker, aber im Geiste des Aristophanes, und erfüllt von dem Glauben an die siegreiche Kraft des Realismus. Seine drastischen Schilderungen der menschlichen Schwächen sind packende Sittenpredigten. Rastloser Fleiß und aufreibende Tätigkeit machten seinem Leben früh im 40. Lebensjahre ein Ende.
Außer seinem Buche „La piazza universale“, das ins Lateinische, Französische und Deutsche übersetzt wurde, haben die satirischen Schriften: „L’hospitale de’ pazzi incurabili“, das deutsch als „das Spital unheilbarer Narren und Närrinnen“, und „La Sinagoga de gl’ignoranti“, in denen er die Gebrechen seiner Zeit verspottet und geißelt, besonderen Beifall gefunden. Der „Piazza universale“, dessen erste Ausgabe im Jahre 1580 erschien, ist eine Schilderung aller Berufsarten, Künste und Gewerbe, sowohl nach Ursprung und Entstehung als in technischer Beziehung. Die 1651 von M. Merian herausgegebene deutsche Übersetzung führt den Haupttitel: Thomae Garzoni Piazza Universale oder Allgemeiner Schauplatz aller Künste, Professionen und Handwerke, und wenn auf dem ausführlicheren zweiten Titel gedruckt ist „jedermänniglich, wess Standts der sey, sehr nützlich und lustig zu lesen“, so ist dies ganz der Wahrheit entsprechend. In der Anlage erinnert das Buch an des Polydorus Vergilius’ Geschichte der Erfindungen, ist aber viel reicher an praktischem Inhalt und zeigt, mit jenem verglichen, recht deutlich den bedeutenden Fortschritt der Technik im Laufe des 16. Jahrhunderts. Was er über Bergbau und Hüttenkunde mitteilt, ist meist aus Biringuccios Pyrotechnia entnommen, doch findet man auch viele originelle Mitteilungen, namentlich über die Kleineisengewerbe. So handelt z. B. der 46. Diskurs: „Von Schmieden insgemein, in specie aber von Grobschmiedten, Kupferschmiedten, Messerschmiedten, Waffenschmiedten, Schlossern, Scheerschmiedten, Schleiffern, Zinngießern, Spengelern oder Laternenmachern, Nadelmachern, Täschenbeschlagern, Sporern, Gürtlern und Huffschmiedten.“ Der 69. Diskurs, der überschrieben ist: „Von Bergleuten, von Rothgießern und sonderlich von Geschütz- und Glockengießern“, behandelt zunächst das Aufsuchen der Erze und Erzmittel, das Schürfen, Probieren und Rösten der Erze, die Anlage des Bergwerkes, die Einteilung der Mineralien, die Ansichten über die Natur der Metalle, das Vorkommen derselben, die Kunst des Gießens und Formens besonders von Glocken und Kanonen, wobei wieder hauptsächlich Vanuccio ausgeschrieben ist.
So gab es also nach dem Mitgeteilten im 16. Jahrhundert bereits eine Literatur des Eisens, wenn dieselbe auch zumeist nur in verschiedenen Werken eingestreut ist. Was sie uns bietet, gibt nur ein unvollständiges Bild der Eisentechnik jener Periode. Zur Vervollständigung desselben müssen noch viele andere Quellen herangezogen werden.
Über die Verwendung des Eisens zur Bewaffnung finden wir vieles in den Kriegsbüchern, die eine eigenartige Literatur bilden und von denen wir die des Leonhard Fronsperger 1557 und des Grafen Reinhard zu Solms 1559 besonders namhaft machen. Manches findet sich in Chroniken, wie z. B. besonders in der Meißnischen Chronik des Albinus vom Jahre 1589.
Wichtige Aufschlüsse geben die Berg- und Hüttenordnungen, die Hammerwerkseinigungen, von denen besonders die Sulzbacher zu erwähnen ist. Auch aus den Waldordnungen und den allgemeinen Landesgesetzen lässt sich manches entnehmen. Die Archive, besonders die der wichtigen Bergstädte, die Staatsarchive, die der Bergämter und königlich preußischen Regierungen enthalten in den auf Bergbau und Hüttenwesen bezüglichen Akten, besonders aber in den betreffenden Rechnungen noch Schätze der Belehrung über die Vergangenheit, doch sind dieselben meist noch ungehoben. Eine Bearbeitung dieses Materiales ist zeitraubend und sehr schwierig, weil sie nur an Ort und Stelle vorgenommen werden kann. Hoffentlich erwacht aber das Interesse für derartige Untersuchungen mehr und mehr, so dass sich aus den Ergebnissen der Lokalforschungen mit der Zeit ein richtigeres und vollständigeres Bild der Entwicklung der Eisenindustrie im 16. Jahrhundert darstellen lässt, als dies bis jetzt noch möglich ist.
Zum Schlusse erwähnen wir noch, dass auch das Studium der Mechanik, des Maschinenwesens, der Ingenieur- und Baukunst, worüber im 16. Jahrhundert bereits eine recht umfangreiche Literatur vorhanden ist — wir führen die Werke von Albrecht Dürer, Tartaglio, Rivius, Ramelli, Besson und Zonka an —, manchen Aufschluss über das Eisenhüttenwesen jener Periode gibt.