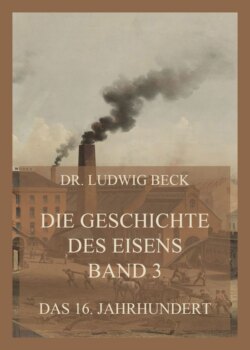Читать книгу Die Geschichte des Eisens, Band 3: Das 16. Jahrhundert - Dr. Ludwig Beck - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ALLGEMEINER TEIL. Eisen, Eisenerze, Probieren der Erze und Aufbereitung.
ОглавлениеDie Ansichten der Gelehrten des 16. Jahrhunderts über die Natur und das Wesen des Eisens waren noch die der aristotelischen Philosophie. Das Eisen galt als ein durch Verdichtung von Dämpfen im Schosse der Erde entstandenes Metall. Nach der Lehre der Alchimisten bestand es wie alle Metalle aus den zwei Materien oder „Prinzipien“, aus Schwefel und Quecksilber. Mercurius est materia metallorum cum sulphure sagte Geber. Davon sei der Schwefel der Vater, das Quecksilber die Mutter. Die natürliche Hitze des Schwefels zwinge und backe das Quecksilber in den Erdspalten dermaßen zusammen, dass aus beiden alle Metalle geboren werden: und aus diesen beiden Veränderungen entstehen allerlei unterschiedliche Metalle. Demnach bestehen alle Metalle aus derselben Materie und unterscheiden sich nur durch die größere oder geringere Reinheit derselben. Im Golde sind sie am reinsten, und manche sagen, alle Metalle hätten Gold werden sollen, aber die Unvollkommenheit des Schwefels und des Quecksilbers hätten es verhindert. Eisen enthält diese Materien im Zustande der größten Verunreinigung. Dies lehrte schon Geber, und Encelius drückt dies folgendermaßen aus: Wenn poröses, erdiges und unreines Quecksilber mit Schwefel, der gleichfalls unrein, stinkend und erdig und von fester Beschaffenheit ist, sich vereinigt („tanquam si pene morbidus cum matre menstruosa coit“), entsteht Eisen. Aus dieser Zusammensetzung werden nun auch die Eigenschaften des Eisens abgeleitet, zunächst seine unansehnliche Farbe. Monardo sagt, das Eisen sei finster, schwarz und grob, weil es aus solcher Materie seinen Anfang genommen habe. Encelius beschreibt das Eisen als metallisch, sehr bleifarbig, wenig rötlich von unreinem Weiß, magnetisch (? participans) und hart. Sodann wird seine Schwerschmelzbarkeit von seiner Unreinheit hergeleitet. Cäsalpinus sagt: Seine unedle Natur wird zunächst bezeugt durch seine Unschmelzbarkeit, die von den vielen trockenen, sehr dicken und erdigen Dünsten herrührt, ferner wird dieselbe durch seine schmutziggraue Farbe (colore livido) bewiesen, wie es denn auch am raschesten Rost anzieht und in Staub zerfällt. Im Feuer aber steht es besser wie die übrigen unreinen Metalle, wegen der vielen erdigen Beimengung. Albertus Magnus sagt schon: Wenn das Eisen glüht, wird es rot, weil es mehrenteils irdisch ist. — Endlich wurde auch die Härte des Eisens aus der Unreinigkeit seiner Materie hergeleitet.
Über die schlechten Eigenschaften, welche wir seine „Unarten“ nennen, und den Einfluss fremder Beimengungen auf dieselben teilen die metallurgischen Schriftsteller des 16. Jahrhunderts nur wenig mit. Agricola unterscheidet noch nicht zwischen Kalt- und Rotbruch; er sagt nur in seiner Hüttenkunde: „Das schlechteste Eisen, welches wie Glas auf dem Amboss zerspringe, sei kupferhaltig, ferrum fragile et aerosum.“ Sodann macht er im achten Buche bei der Röstung die Bemerkung, der Schwefel schade dem Eisen am meisten. Basilius Valentinus sagt von dem Eisenerz in bezug auf das darzustellende Eisen: „Eisenstein nimmt die höchsten Metalle an sich, Gold, Silber, Kupfer, Zinn und Blei, davon es spröde und ohnartig wird, aber Gold und Silber schaden ihm nichts, die machen es geschmeidig; welches nur kupferflössig oder mit geringen Metallarten vermischt ist, das zerfällt auch leichtlich.“
Der Stahl wurde im allgemeinen als ein gereinigtes Eisen angesehen. Am ausführlichsten erklärt dies Albertus Magnus. Er sagt: Der Stahl ist keine andre Art Metall als das Eisen, nur feiner, indem die wässerigen Teile des Eisens durch Destillation von dem Eisen abgeschieden sind, dadurch wird es härter und dichter infolge der Kraft des Feuers und der Feinheit seiner Teile, welche härter werden, so oft man sie glüht. Er wird weißer durch die größere Abscheidung des Erdigen, und wenn er zu sehr gehärtet wird, zerspringt er und lässt sich unter dem Hammer zerkleinern wegen seiner zu großen Austrocknung.
Dies war auch die Ansicht derjenigen Metallurgen, welche, wie Agricola und Biringuccio, sich nicht so ganz auf den Boden der überlieferten Theorien des Aristoteles und der Alchimisten stellten. Von dem Standpunkte der letzteren aus war diese Läuterung leicht zu erklären. Nach Monardos Ansicht wurde durch die fortgesetzte Behandlung des Eisens im Feuer ein Teil des erdigen Schwefels ausgetrieben. Die hellere, silberähnliche Farbe des Stahls galt als ein Beweis der Reinigung. Cäsalpinus sagt, dass man dieselbe noch weiter (also wohl bis zum reinen Silber) fortsetzen könne, dass man dies aber nicht tue, des großen Abbrandes wegen und weil das Eisen in dem unvollkommenen Zustande der Läuterung für viele Zwecke am geeignetsten sei.
Aus dieser Mischung von Schwefel und Quecksilber in unreinem Zustande erklärte man auch die medizinischen Wirkungen von Eisen und Stahl, die in den Schriften der Metallurgen des 16. Jahrhunderts, welche fast alle Ärzte waren, eine hervorragende Rolle spielen. Schon Galen hatte das Eisen für kalt und trocken erklärt, weshalb es als Medikament trocknend und zusammenziehend wirken musste. Man teilte damals die Körper nach ihrer arzneilichen Wirkung in zwei Klassen: in solche, die kühlend, trocknend und beruhigend, und in solche, die wärmend, lösend und belebend wirkten. Das Eisen und seine Verbindungen spielten aber schon im hohen Altertum eine hervorragende Rolle als Arzneimittel. Es galt im allgemeinen als kalt und trocken, aber seine Anwendung war eine so vielfältige, dass es auch in Fällen angewendet wurde, wo wärmende und lösende Mittel geboten waren, deshalb erklärten es viele, wie schon Galen und Avicenna, für warm und trocken. Monardo gibt sich in seinem angeführten Gespräch Mühe, diese Widersprüche zu lösen, indem er auf die Zusammensetzung der Materie des Eisens selbst zurückgeht. Er sagt: das Eisen bestehe aus dem hitzigsten Schwefel und dem kältesten Quecksilber. Des Quecksilbers Natur sei wässerig und irdisch, dieses herrsche im Eisen vor, deshalb wirke dieses kühlend, trocknend, die Hitze des Schwefels aber bedingte seine lösende Wirkung. Da nun der Stahl mehr von Schwefel gereinigt sei, so wirke dieser mehr kühlend und trocknend, während das ungereinigte Eisen mehr wärmend und lösend wirke.
Agricola hält sich von diesen theoretischen Spekulationen im ganzen fern, dagegen behandelt er wiederholt die mineralogisch wichtige Frage, ob das Eisen in gediegenem Zustande in der Natur gefunden werde. Im allgemeinen verneint er dies, wie die meisten Naturforscher dieses Jahrhunderts, doch gerät er bei dieser Frage in Widersprüche, weil er das meteorische Eisen nicht von dem terrestrischen unterscheidet. In seinem Werke, dem Bermannus, spricht er sich noch für das Vorkommen von gediegenem Eisen aus. Er sagt: „Es ist sicher, dass reine Massen von Eisen, sowie auch kleine Körner davon gefunden werden, wie dies schon Albertus wusste“, und wiederholt diese Behauptung an einer andern Stelle. Dagegen sagt er in seinem späteren Werke De natura fossilium: die Alten hätten nirgends über das Vorkommen von gediegenem Eisen berichtet und die Körner, welche seine Farbe hätten und zuweilen im Sande der Flüsse gefunden würden, seien so unrein, dass sie erst geschmolzen werden müssten, um sie zu verwenden. Da er sie mit Zinngraupen vergleicht, so dürften hier Magneteisenkörner, die sich oft in Seifenwerken finden, gemeint sein. Meteoreisen kennt Agricola nur aus den Schriften des Avicenna. Er verhält sich aber skeptisch gegen den außerirdischen Ursprung der Meteorsteinfälle und will dieselben lieber von vulkanischen Wirkungen herleiten. Encelius behauptet dagegen bestimmt, dass gediegenes Eisen in der Erde gefunden werde. Nach ihm „ist das Eisen zweierlei Art, entweder natürliches oder geschmolzenes. Das natürliche ist rein und wird in Bergwerken in Körnern oder Klumpen gefunden; die Deutschen nennen es „gediegen Eisen“.
Georg Fabricius führt einen beglaubigten Meteoreisenfall in Sachsen an, den er folgendermaßen beschreibt: Verschiedene versichern es, dass eine Eisenmasse, ähnlich einer Schlacke, aus der Luft niedergefallen sei in den Waldungen von Neuhofen bei Grimma, diese Masse sei von großem Gewicht gewesen, so sehr, dass man sie wegen ihrer Schwere nicht fortbringen konnte, noch ließ sich ein Wagen an die Stelle bringen, wegen der Unwegsamkeit des Ortes. Dies ereignete sich aber vor dem sächsischen Bürgerkriege, den die blutsverwandten Fürsten gegeneinander führten. Ebenso berichtet Scaliger von dem Fall einer meteorischen Eisenmasse.
Über die Oxide des Eisens hatte man, dem damaligen Stande der Wissenschaft entsprechend, sehr unklare Vorstellungen. Der Eisenrost galt allgemein als eine Krankheit des Eisens, welcher das Eisen verzehre. Agricola nennt ihn ein vitium metalli, von der das Eisen durch die Feuchtigkeit wie von einem Ausschlag befallen werde. Im Schosse der Erde werde er ebenso selten gefunden, wie das gediegene Eisen. Schon Plinius unterscheidet ferrugo und rubigo und Agricola sagt, manche nennen ihn rot, manche schwarz. Doch wird der Hammerschlag, das Eisenoxiduloxid, welches beim Schmieden des Eisens abfällt, nicht als etwas dem Rost Verwandtes, sondern als ein Rückstand der Verbrennung, als eine Asche (cinis) angesehen, die mehr den Schlacken (ramenta oder recrementa ferri) verwandt war. Kentmann unterscheidet Frischschlacke, Stockschlacke und Hammerschlag. Monardo schildert den Eisenrost als eine Krankheit, die man auch als solche behandeln müsse und gibt Mittel gegen das Verrosten an. Er sagt: „Es hat das Eisen seine Krankheit, welche dasselbe verzehrt, nämlich den Rost, aber dawider sind viele Arzneien erfunden, also dass man dasjenige, so aus Eisen gemacht, sauber, ohne Staub und in trocknen Orten behalte, dasselbe oft gebrauche, mit Gold oder Silber überziehe, blau anlaufen lasse, mit Baumöl, Hirschwachs, Spieke, Fett von Geflügel, Cerusin mit Essig versetzet u. s. w. einschmiere. Wenn’s aber verrostet, ist nichts bequemer, denn mit der Feile darüber her dasselbe abgefeilt, in Essig gelegt und durch ein Feuer gezogen, so bringt man den Rost hinweg, es wäre denn schon ganz angefressen und verzehret, da kann keine Arznei mehr helfen.“ Cardanus spricht sich noch genauer über die Ursache und das Wesen des Rostes aus. Er setzt klar auseinander, dass dasselbe nicht durch die Luft allein, sondern wesentlich durch das Wasser bei Zutritt von Luft entstehe. Deshalb bestreiche man Sachen, die nicht rosten sollen, mit Öl, welches die Feuchtigkeit abhält. „Dieweil denn das Öl den Rost weret und das Wasser solchen machet, vermerkend, wiewol dass der Rost weder von der Kälte noch von der Feuchte entstehet. Denn das Öl ist an ihm selbst kalt und mag auch feucht werden oder an ihm selbst sein. Darum wird der Rost von einer faulenden Wärme, es faulet aber das Wasser, darum ist dieses Ding ein Gift.“ Obgleich man annahm, dass beim Verrosten der Metalle etwas verzehrt werde, also eine Gewichtsverminderung eintreten müsste, war man doch mit der Tatsache, dass die Metalle bei ihrer „Verkalkung“, d. h. Oxidation, an Gewicht zunehmen, schon früh bekannt. Geber wusste dies schon vom Blei und vom Zinn. Ganz bestimmt sprach es Paul Eck von Sulzbach um 1490 aus, aber die Alchimisten nahmen keine Notiz davon. Cardanus, der dieselbe Beobachtung bei dem Blei gemacht hatte, erklärte die Erscheinung in seinem Werke De rerum subtilitate aus der Entweichung der himmlischen Wärme, der er also ähnlich wie die Chemiker des vorigen Jahrhunderts eine negative Schwere zuschrieb. Skaliger verdunkelt diese Idee des Cardanus nur, indem er ausführt, es würde das Metall durch Reduktion von in ihm eingeschlossener Luft schwerer, wobei er spezifisches und absolutes Gewicht verwechselt.
Die Erze betrachtete man als Mineralien, die unmittelbar aus der Hand der Natur hervorgegangen seien und deshalb als die einfachen, elementaren Stoffe, die sich beim Schmelzen durch Zutritt von irgendetwas in Metalle verwandelten. Die Mineralien waren nach Aristoteles ebenfalls aus irdischen Ausdünstungen gebildet, und zwar die Steine aus trockenen, die Metalle aus feuchten, weshalb die Steine unschmelzbar und zerreiblich, die Metalle schmelzbar oder dehnbar wären. Diese Einteilung war indes nur so lange haltbar, als man nur die alten sieben planetarischen Metalle: Gold, Silber, Elektrum, Kupfer, Eisen, Blei und Zinn kannte. Schon Geber sah sich gezwungen, die Metalle in edle und unedle zu trennen und zu letzteren auch einige Halbmetalle zu rechnen. Im 16. Jahrhundert unterschied man bereits folgende Halbmetalle: Quecksilber, Antimon, Arsen, Kobalt, Wismut und Zink, die dadurch gekennzeichnet waren, dass sie sich unter dem Hammer nicht strecken ließen. Die Steine teilte schon Aristoteles ebenfalls in zwei Gruppen ein, von denen die der einen aus fetten, die der anderen aus mageren Dünsten entstanden waren; die erste umfasste die brennbaren Fossilien, wie Schwefel, Auripigment, die Bitumina, wozu auch die Kohlen gehörten, sowie noch einige andere Mineralien; die zweite Gruppe umfasste alle übrigen Steinarten. Agricola nahm schon vier Klassen an: Gemeine Steine, Edelsteine, Marmorarten und Felsarten.
Die Eisenminer, nämlich Magneteisenstein, Hämatit und Glaskopf, gehören zur ersten Klasse. Agricola beschreibt die mineralogischen Kennzeichen derselben ausführlich, jedoch nicht als Eisenerze. Eisenerz ist kein mineralogischer, sondern ein hüttenmännischer Begriff. Eisenerze nennen wir diejenigen Steine, aus denen Eisen mit Vorteil gewonnen werden kann. Es gibt sehr eisenreiche Mineralien, wie Magnet- und Schwefelkies, die, weil sie diese Bedingung nicht erfüllen, keine Eisenerze sind. Wenn wir die Eisenerze in die fünf Hauptgruppen: Magnet-, Rot-, Braun-, Spat- und Toneisensteine teilen, so ist dies ebenfalls eine praktische und keine mineralogische Einteilung, wenn auch jede dieser Erzarten durch ein besonderes Eisenmineral charakterisiert ist. Die mineralogische Einteilung der oxidischen Eisenverbindungen, um die es sich hier allein handelt, ist unabhängig von der hüttenmännischen. Man muss deshalb beide nebeneinander betrachten.
Agricola in seinen mineralogischen Schriften unterscheidet die oxidischen Eisenverbindungen am genauesten, ohne indes von ihrer chemischen Zusammensetzung irgendwelche Kenntnis zu haben. Er beschreibt zunächst den Magnetstein, sodann die Hämatite und den „Schistos“, indem er darin der Einteilung und Bezeichnung des Plinius folgt. Sie gehören alle zur ersten Klasse der Mineralien, zu den „eigentlichen oder gemeinen Steinen“.
Was Agricola vom Magnetsteine berichtet, ist auszugsweise bereits mitgeteilt worden. Er hält ihn nicht für ein Eisenerz, sagt aber, dass er die Farbe von poliertem Eisen habe und auch zumeist in Eisensteingruben gefunden werde, wo er entweder in kleinen Stücken im Erze eingesprengt oder in mächtigeren, größeren Mitteln vorkomme. In Deutschland führt er die folgenden Fundorte an: im Harze jenseits Harzburg, sieben Steine (Meilen) von Goslar entfernt, wo es aus einem besonderen Schachte gefördert werde: in den meißnischen Bergen in Eisenerzlagern nicht weit von Schwarzenberg und von Eibenstock, vornehmlich in der Grube, welche man die Magnetgrube nenne; ferner nicht weit von dem Orte Pela, da, wo man zur Rechten in das reiche Joachimsthal herabsteigt, welches Eisenbergwerk von seinem Entdecker Burkart und dem steilen Orte seinen Namen erhalten hat; im Gebiete der Franken; in Böhmen gleichfalls in den Eisenbergwerken des Lessawaldes, der zwischen der Stadt Schlackenwert und deren Warmbad Karls IV. (Karlsbad) gelegen ist. Agricola weis zwar, dass gebrannter Magnetstein dem Hämatit gleiche und als solcher verkauft werde, mit keiner Silbe aber erwähnt er seine Verwendung als Eisenerz. In Deutschland wurde zu jener Zeit Magneteisenstein nicht als solcher benutzt und die Beimengung von Magnetstein in den Erzen galt sogar als der Güte des Eisens nachteilig.
Die von Plinius überkommene Einteilung der übrigen Eisenerze in Hämatite und Schistos ist eine wenig glückliche.
Der eine Name ist von der Farbe, der andere von der Form abgeleitet; nach unserer Bezeichnungsweise würden wir sie mit Blutstein und Glasköpfe übersetzen müssen, dies entspricht auch Agricola, in dem von ihm selbst aufgestellten Wörterverzeichnis, doch sagt er bei dem undefinierbaren Worte „Schistos“ selbst: „Glasköpfe oder Blutstein, denn viele Deutsche unterscheiden ihn nicht von dem Hämatit“. Es ist dies auch gar nicht möglich, da der rote Glaskopf Blutstein ist und der faserige Blutstein Glaskopf, ja, die Deutschen bezeichnen mit dem Namen Blutstein vorzugsweise den roten Glaskopf. So bleibt denn auch Agricolas Beschreibung, die wir oben bereits im Wortlaute mitgeteilt haben, trotz ihrer Ausführlichkeit, unklar, namentlich ist das, was er unter dem Namen Schistos beschreibt, vom mineralogischen Standpunkte aus ein wahres Sammelsurium. Es ist eigentlich eine Schilderung der gebräuchlichen Eisenerze, der Rot- und Brauneisensteine, von deren technischer Verwendung der Verfasser aber nicht spricht.
Eine weniger wissenschaftliche, aber mehr praktische Einteilung und Beschreibung der Eisenerze gibt uns Vanuccio Biringuccio.
„Wie zuvor erwähnt“, schreibt er, „wird das Eisenerz in den rauesten Bergen gefunden, und dieses wird von den Alchimisten unedel genannt, weil es grobe, erdige Bestandteile mit sich führt, woher es kommt, dass das Eisen in der Glut des Feuers mehr erweicht als schmilzt, auch wegen seiner schlechten Beimengungen und großen Porosität leicht rostet und, wenn man es verarbeitet, sich verzehrt, indem es sich in Schlacke verwandelt.
(Wie gute Erze beschaffen sind: Die Eisenerze zeigen sich, wie gesagt, verschiedener Art. Das gute soll hell und schwer sein, von festem Korn und rein von Erde und Gangart, wie von jeder Metallbeimischung. Diejenigen von brauner Farbe und die, welche schwarz sind oder die Farbe der Trauer (calamita — des Magnetes?) haben, sind nicht viel wert, weil sie fast alle Spuren von Kupfer enthalten.
Mir sind vier verschiedene Arten bekannt. Die erste ist jene helle (chiara), von der ich Euch sagte, dass sie vollkommen ist, wenn sie schwarz ist; die zweite jene glänzende (lucente) von kleinem Korn, welche leicht zerreiblich und nicht sehr gut ist. Die (dritte) schwarze, von großem Korn hat wenig Wert, weil sie fast immer Kupfer und andere Metallbeimischungen mit sich führt. Die vierte ist schwarz, von kleinem Korn und mehr oder weniger gut, je nach dem Gestein, in dem sie sich findet. Die Erze, welche eine metallische Beimischung, wenn auch nicht viel, haben, kann man nur durch langandauernde und starke Feuer reinigen, denn es sind verdorbene Materien, die auf andere Weise voneinander kaum zu trennen sind. Von diesen macht man deshalb, da man sie nicht zur vollkommenen Weichheit bringen kann, weil sie sich aber leicht schmelzen lassen, Artilleriekugeln und andere Gusswaren, welche, je nach der Menge der Verunreinigung, auch mehr oder weniger zerbrechlich sind. Diese Erze erzeugen sich, wie der Augenschein lehrt, in allen Gesteinsarten in den Bergen, aus welchen das beste, reinste Wasser hervorbricht, und wo die Luft gut ist. Oft erzeugt es sich in einem weißen Gestein, ähnlich dem Marmor, wenn es aber, mit diesem verbunden, geschmolzen wird, so wird das Eisen selten weich. Es findet sich ferner für sich in einer gewissen losen, roten Erde, dieses ist sehr zerreiblich und zeigt schwarze Flecken und gelbe Linsen. Ähnlich findet es sich auch in einer gewissen gelben Erde, die fast so leicht ist wie Schlamm, aber ich rate Euch nicht, bei diesem Eure Zeit zu verlieren, weil es nicht rein ist. Ihr werdet dies noch genauer beurteilen können, wenn Ihr dabei grün oder blau gefärbte Steine findet, oder beim Zerbrechen gelbe Körper wie Knöpfe oder schwarze wie Kohlen.“ Nachdem Biringuccio weiterhin auseinandergesetzt hat, wie man auf chemischem Wege die Verunreinigungen der Erze nachweisen kann, worüber wir an anderer Stelle sprechen wollen, fährt er fort: „Dasjenige Erdreich (mergola), an dem man erkennen kann, wo gutes Eisen sich findet, ist der Bolus oder eine andere erdige Substanz, rot, weich und fett, welche, wenn man sie mit den Zähnen zermalmt, kein Knirschen wie von Erde zeigt, denn hierin erweist sich nach der Meinung der Praktiker ein sehr vollkommenes Erz. Dieses ist aber nicht in Gängen (filone) geordnet.
Um endlich zu erzählen, von welcher Art sich außerdem noch Eisenerz findet, so ist das meiste von der Sorte, welche die Eisenrostfarbe (color ferruginoso) zeigt, das, nach meinem Wissen, nicht sehr gut ist. Hiervon, wie von einer anderen schwarzen Sorte, habe ich viele im Gebiete von Siena, im Tal von Boccheggiano, sowie an vielen anderen Plätzen gesehen . . . .“
Encelius unterscheidet die nutzbaren Eisenminer in Eisenerz und in Eisenerde, ersteres findet sich in den Gebirgen und wird bergmännisch gewonnen, wie z. B. in seiner Heimat bei Saalfeld, letzteres findet sich im Flachlande, unter dem Ackerboden als eine rote Erde, die vom Roste gewissermaßen angesteckt ist, wie in Schlesien und in Brandenburg. Es ist dies das Wiesenerz oder der Raseneisenstein, der in ganz Norddeutschland auf Eisen verschmolzen wurde, den Kentmann als Torgauer Erz, von lebergelber Farbe und schwammartig, „darauss man vil eysen rennet“, aufführt. Lazarus Erker gibt folgende Beschreibung: „Der Eysenstein der ist braun, vnd zeucht sich seine farb dahin, das er im gemeyn fast einem verrosten Eysen gleich sihet. Der beste und gar reiche Eysenstein aber, der frisch ist, des Farb ist blawlecht (bläulich), was vergleicht sich einem gediegen Eysen. Etliche Eisenstein seyn magnetisch, die durch jre Natur das Eysen sichtiglich zu sich ziehen, welches wie auch hernach berichtet wirdt, aus ihrer beyder verborgner hitz herkommt . . . . . Der Stahelstein aber, der ist dem Eysenstein an seiner farb gar vngleich. vnd sihet etlicher gleich wie eine gelblichter spart . . . . .“
Die Entstehung der Erzlager schreibt Cardanus den Gestirnen zu, von denen die Sonne den mächtigsten Einfluss hat. Deshalb seien die Erze nach den Breitengraden verschieden verteilt, und wegen der größeren Sonnennähe habe Potosi so viel Silber, Italien dagegen so wenig, aber viel Eisen, weil es nicht gar zu warm, aber auch nicht ganz kalt ist.
Die Eisenerze wurden meist durch Tagebau gewonnen. An manchen Orten, wo reiche Erzlager zu Tage ausstrichen, wurde das Erz aufgelesen, oder es wurden im Herbste, nachdem die Ernte eingetan war, Schurfgräben aufgeworfen und das Erz oberflächlich ausgegraben. So geschah es in alter Zeit im Siegerlande und in der Herrschaft Sayn-Altenkirchen, und da hierbei oberflächliche Gänge und Erdhaufen entstanden, die denen der Maulwürfe („Moll“) ähnlich waren, welche „Mollhügel“ hießen, so nannte man diese Art der Erzgewinnung „moltern“ und das Erz Moltererz. Diese Art der Gewinnung stand dem Grundbesitzer frei und war nicht von einer Belehnung oder Mutung abhängig. Nachdem auf einem Grundstück der Molterstein gewonnen war, wurden die Gräben zugeworfen und der Acker wieder bestellt. In ähnlicher Weise geschah die Gewinnung der Rasenerze in Norddeutschland, Holland u. s. w. Agricola berichtet, dass man bei der Gewinnung der Wiesenerze in Schlesien zwei Fuß tiefe Schurfgräben aufwerfe. Tiefer dürfe man wegen dem Grundwasser nicht niedergehen, doch wüchse das Erz nach, so dass es nach zehn Jahren von neuem gegraben werden könne.
Wie das Seeerz in Schweden gewonnen wurde, haben wir ausführlich im ersten Bande beschrieben. Wo mächtige Erzlager waren, entstanden größere Tagebaue, wie schon in ältester Zeit auf der Insel Elba, am Erzberg bei Eisenerz, zu Hüttenberg in Kärnten u. s. w. Aber auch durch regelmäßigen Gangbergbau wurden schon im Mittelalter die Eisenlager ausgebeutet, und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nahm der Bergbau einen so allgemeinen Aufschwung, dass auch viele größere Eisenerzlager durch regelrechte Stollen, Schächte und Strecken erschlossen und abgebaut wurden.
Die Anwendung von Wasserrädern als Bewegungsmaschinen für kräftige Pumpwerke ermöglichten erst den eigentlichen Tiefbau, den Abbau unter der Stollensohle.
Die Eisensteinbergwerke wurden indes zu Anfang des 16. Jahrhunderts meistens noch ausschließlich nur über der Talsohle mit Stollenbetrieb abgebaut, Tiefbau war für den geringpreisigen Eisenstein damals noch zu kostspielig. — Regelmäßiger Streckenbergbau auf Eisenerze fand besonders in Gebirgsgegenden statt. Im Harz ist er sehr alt. Als man im Jahre 1795 den alten Stollen der Vollmergrube zwischen Elbingerode und Wernigerode, der winkelig, eng und nur durch Schrämmarbeit hergestellt war, aufräumte und erweiterte, fand man die Jahreszahl 1227 im Gestein eingehauen. An den mächtigsten und bekanntesten Erzstöcken ging man schon früh vom Tagebau zum Stollenbau über, so außer am Harz im Stahlberg bei Müsen im Siegerlande, am Erzberg bei Eisenerz, in Sulzbach und an vielen andern Orten.
Auch das Feuersetzen kam bei der Gewinnung der Eisenerze hier und da in Anwendung; so geschah dies noch Ende des vorigen Jahrhunderts zu Frauenberg im Erzgebirge, wo man den Magneteisenstein auf diese Weise gewann und an dem beschwerlichen Verfahren festhielt, weil dadurch zugleich das Erz eine teilweise Röstung erfuhr. Es würde zu weit führen, alle im 16. Jahrhundert betriebenen Eisenbergwerke aufzuführen; wir werden bei der Geschichte der Eisenindustrie der einzelnen Länder Gelegenheit haben, die wichtigsten derselben namhaft zu machen.
Das geförderte Erz wurde in Haufen auf der Halde aufgefahren, und zwar in der Weise, dass der Neunte oder Zehnte, welcher als Abgabe gewöhnlich dem Landesherrn zu entrichten war, für sich gestürzt wurde.
Wenn das Erz keiner besonderen Aufbereitung bedurfte, so war es jetzt zum Verkauf oder zum Verschmelzen fertig und konnte die Probe genommen werden.
Das Probieren der Eisenerze geschah, wie das Probieren der Erze überhaupt, auf trockenem Wege. Die „trockene Erzprobe“ war bereits im 16. Jahrhundert zu einer Vollkommenheit entwickelt, dass dieser Zweig der Chemie bis zu unserer Zeit wenig Änderungen und Verbesserungen erfahren hat. Die metallurgische Chemie, die unter dem Namen der Probierkunst begriffen wurde, war eine in sich abgeschlossene Wissenschaft oder nach der Ausdrucksweise der Alten „eine Kunst“. Sie zeichnete sich sehr vorteilhaft vor den geheimnisvollen Operationen der Alchimisten und Adepten durch Einfachheit und Klarheit aus. Bei ihr bildete die Waage bereits das wichtigste Instrument; sie war die einzige Form der chemischen Analyse. So ist die Probierkunst, obgleich fast ausschließlich von Berg- und Hüttenleuten für ihre praktischen Bedürfnisse gepflegt, in gewisser Beziehung der Ausgangspunkt der modernen Chemie geworden; denn erst dadurch, dass man mit der Waage in der Hand alle chemischen Vorgänge prüfte, entstand die exakte chemische Wissenschaft.
Die Operationen des Probierers waren im Wesentlichen die Operationen des Hüttenmannes bei der Zugutemachung der Erze auf den kleinen Raum des Laboratoriums mit seinen Tiegeln, Kapellen, Muffeln, Windöfen und Handblasebälgen reduziert.
Wie die Ausschmelzung der Eisenerze ein einfacher Vorgang war, so war es auch das Probieren derselben auf ihren Gehalt. Es war dies eine einfache Tiegelprobe. Das gepulverte Eisenerz wurde in einem Tiegel mit Kohlenpulver gemengt zu einem Regulus, König, oder Probierkorn geschmolzen. Das Schmelzen geschah im Schmiedefeuer oder in einem Probierofen, bei dem der Schmelzherd durch einen eisernen Ring ersetzt wurde. In diesen wurde der Tiegel eingesetzt, die Kohlen eingetragen und mittels eines Doppelbalges von drei Werkschuh, also etwa einem Meter Länge, das Feuer angefacht. Fig. 1 gibt die Abbildung eines Probierofens nach Agricola.
Die Ermittlung des Eisengehaltes der Erze war der Hauptzweck der Probe, doch konnte man dasselbe Verfahren auch anwenden, um die vorteilhafteste Zusammensetzung von Erzen und Zuschlägen, den sogenannten „Möller“ zu ermitteln. Man nannte dieses „die Beschickungsprobe“. Diese war indes im 16. Jahrhundert noch kaum in Anwendung. Zur richtigen Schmelzprobe gehörte das richtige Probenehmen. Denn da der Zweck der Probe darin bestand, den richtigen Durchschnittsgehalt an Eisen zu ermitteln, so war es unzulässig, ein einzelnes Erzstück zur Probe auszusuchen, man schöpfte vielmehr mit einer Schaufel von verschiedenen Stellen des Erzhaufens kleine Mengen, bildete aus diesen ein kleineres Haufwerk, von dem man in gleicher Weise wieder die Probe nahm, die dann zerkleinert und gut gemischt den möglichst richtigen Durchschnitt ergab. Das Erzpulver setzte man dann nach gehöriger Vorbereitung mit dem nötigen „Fluss“ in die „Tute“ ein. Ehe wir dies näher beschreiben, wollen wir das erwähnen, was die Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, die über die Probierkunst geschrieben haben, mitteilen. Es sind dies besonders Georg Agricola und Lazarus Erker. Was ersterer im siebenten Buche De re metallica darüber gesagt hat, haben wir oben (S. 45) bereits angeführt. Er röstet das Erz, zieht die eisenhaltigen Teilchen mit dem Magnet aus, sammelt diese, mischt sie mit einem Fluss und schmelzt sie in einer Tute im Schmiedefeuer. Der Eisenkönig wird gewogen.
Auch Lazarus Erker bedient sich bei der Eisenprobe des Magnetes und gibt in seinem Probierbuche (p. CXXXI) fast die gleiche Vorschrift, nur etwas weitläufiger, wie Agricola. Unter der Überschrift „wie man probieren soll, ob ein Eysenstein reich an Eysen sei“ schreibt er: „Solche und dergleichen Eysensteine kann man durch kein andere weiß leichtlicher und bass probiren, dann durch den Magneten. Darumb so du denselben versuchen wilt, so röst ihn (wiewohl ihn etliche ungeröst nehmen), reib ihn klein und nimb einen guten Magneten, welze oder zeuch den darinnen herumb, so hangt sich der gute Eisenstein alle an den Magneten, den streich mit einem Hasenfuß herab und hebe wiederumb mit dem Magneten den Eysenstein auff, so viel du aufheben kannst und so zuletzt was liegen bleibt, dass sich nit aufheben will lassen, dass ist taub und nicht guter Stein. Hiemit kannstu sehen, ob eine Bergkart Eysen hat, oder ob ein Eysenstein reich oder arm an Eysen sey, dann wie gemelt, so hebt der Magnet kein ander metal auff, dann allein Eysen und Stahel.
Der Stahelstein aber, der ist dem Eysenstein an seiner farb gar vngleich und sihet etlicher gleich wie ein gelblichter spart, den hebt der Magnet roh, wie auch etliche Eysenstein, gar nicht auff, so man aber den Stahelstein röstet, so ferbt er sich, dass er dem reichen Eysenstein an der farb gleich ist, dann hebt der Magnet denselben gar gern und noch ehr und lieber als den Eysenstein . . . . .
So durch solche Prob durch den Magneten befunden wird, dass der Eysenstein gut und reich ist, so können dann die Hammerschmid mit ihren zuschlegen denselben im großen fewer ferner probiren und versuchen . . . . .“
Charakteristisch für die alte Eisenprobe ist die Vorbereitung der Erze, besonders das Rösten oder Brennen derselben und das Ausziehen mit dem Magnet. Aber auch die Schmelzung wich in mancher Beziehung von der jetzt gebräuchlichen ab. Die Tiegel waren zwar, wie die Abbildungen bei Agricola und andern beweisen, dieselben wie heutzutage. Es waren die sogenannten „hessischen“ Tiegel oder Tuten von Großalmerode, die am Boden rund, am oberen Rande dreieckig ausliefen. Dieselben wurden erst mit einem Gemenge von Kohle und Lehm etwa 3 mm dick an den Wänden ausgeschlagen. Die Mischung bestand gewöhnlich aus 2 Tln. Kohlenpulver und 1 Tl. Lehm. Dann wurde dies kohlenreiche Gemisch, welches die Reduktion bewirkte und aus 3 Tln. Kohlenstaub und 1 Tl. Lehm hergestellt war, eingetragen. Man drückte dieses fest ein, so dass nur eine kleine Öffnung in der Mitte zum Einsetzen der Probe verblieb. Die Probe bestand aus dem Eisensteinpulver und dem Fluss, welche zuvor in einem Mörser gehörig gemischt worden waren. Als Fluss gibt Agricola nur Salpeter an. Jedenfalls wendete man Flussmittel an, welche die beigemengten Silikate leicht verschlackten und ein flüssiges Glas gaben, während man in späterer Zeit auch solche Zuschläge als Flussmittel gab, welche der Beschickung in Hochöfen entsprachen, also Kalk, Ton und Kieselerde. Es lässt sich vermuten, dass man bei kalkhaltigen Erzen schon damals neben dem Salpeter auch noch Glas zugab.
Die Schmelzung geschah in der Regel in einer Schmiedeesse vor dem Winde. Die Tiegel wurden mit Lehm befestigt und durch ein Stück Holzkohle, das zu einem Deckel geformt war, verschlossen. Auf diesen Deckel wurde dann zum weiteren Schutze vor dem Winde noch etwas Kohlenstübbe aufgedrückt. Man gab anfangs gelindes, dann heftiges Feuer. In etwa einer Stunde war die Probe fertig. Das Gewicht des Eisenkornes gab das Ausbringen an Roheisen aus dem untersuchten Erze an. Aus dem Aussehen der Schlacke und des Regulus, sowie aus dessen Verhalten konnte man auf die Güte und Beschaffenheit des Eisensteines schließen.
Eine Eisenprobe auf nassem Wege gab es damals noch nicht. Nur qualitativ ließ sich Eisen durch flüssige Reagenzien nachweisen. Schon Plinius erwähnt die Galläpfeltinktur als ein Reagens auf Eisen, und Paracelsus wies damit das Eisen in den Mineralwässern nach. — Interessant ist die Art, wie Biringuccio die Verunreinigungen der Eisenerze auf nassem Wege nachweist. Er schreibt: Man kann auch die Reinheit der Erze auf die Weise erkennen, dass man die Masse in eine starke Lauge (liscia forte — jedenfalls Scheidewasser) einträgt, und sie, indem man sie herausnimmt, über ein gut unterhaltenes Feuer bringt, wobei es auf die Farbe des Rauches ankommt, der sich entwickelt. Wenn sie längere Zeit in der Lauge gewesen ist, wobei man mit einem Blasebalge oder einem andern Rohre langsam hineingeblasen hat, so erkennt man an den Blasen, die sich bilden, an der Verschiedenheit der Farben ihre Verunreinigung, welche vom Kupfer herrührt.
In Nürnberg gab es schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine öffentliche Probieranstalt, die sich ganz besonders mit Erzproben beschäftigte.
Aus dem Eisengehalte ließ sich die Schmelzwürdigkeit und der Wert des Erzes bestimmen. Nur gutartige und reiche Erze ließen sich mit den unvollkommenen Hilfsmitteln jener Zeit mit Vorteil verwenden, und viele Eisensteine, die jetzt gesucht und geschätzt sind, wurden damals als zu arm oder zu schwer schmelzig verworfen. Da man nur reiche, gut schmelzige Beschickungen verwenden konnte, war man gezwungen, die Erze durch vorbereitende Behandlung, durch Waschen, Rösten u. s. w. zu reinigen und anzureichern. Diese Vorbereitung der Erze musste weit sorgfältiger geschehen, als heutzutage, und bildete deshalb einen viel wichtigeren Teil der hüttenmännischen Praxis, als dies jetzt der Fall ist.
Agricola schreibt, man müsse die unreinen und schwer schmelzbaren Erze so sorgfältig rösten, wie die Erze anderer Metalle. Zur Vorbereitung sollte man sie erst unter einem Trockenpochwerk zerkleinern, sodann sie rösten, damit die schädlichen Säfte sich verflüchtigen und sie dann waschen, damit alles, was leicht ist, von ihnen geschieden werde. Die Größe der Erzstücke, die man aufgibt, soll nicht über Nussgröße betragen. — Das Zerkleinern der Erze ist die erste und wichtigste Vorbereitung der Erze für den Schmelzprozess. Es ist einleuchtend, dass auf kleinere Stücke, infolge der größeren Oberfläche, die reduzierenden Gase und die Hitze intensiver einwirken, und dass die gleichmäßige Größe der Erzstücke einen gleichmäßigen Ofengang bewirkt. Biringuccio sagt, dass diese Zerkleinerung des Erzes zu Nussgröße die einzige Vorbereitung sei, deren die Erze von Elba bedürften; dagegen müssten unreinere Eisenerze ausgelesen, geröstet, nochmals gut sortiert und verwaschen werden. — Die Handscheidung war diejenige Art der Aufbereitung der Erze, welche, wegen ihrer Einfachheit und Billigkeit, auch bei den geringeren Erzsorten gebräuchlich war. Man konnte dazu Frauen, Kinder und Greise, die zu anderer Arbeit nicht mehr zu gebrauchen waren, verwenden. Das Scheiden mit der Hand bestand in dem Zerklopfen der Erzstücke mit einem Handhammer oder „Fäustel“ auf einem Stein oder einem Stück Eisen (Amboss) als Unterlage, „den Bocken“, und dem Auslesen, „Ausklauben“, der tauben, unhaltigen oder unreinen Teile, „denn unnütz Erz mit dem nützen zu verschmelzen ist schädlich“, sagt Agricola. Es geschah dies meistens schon auf der Halde. War das Erz mit Ton stark gemengt, lettig oder lehmig, so musste dieser erst ausgewaschen, die unhaltigen Stücke ausgeklaubt werden. Die über nussgroßen Erzstücke wurden zerkleinert.
Das Auslesen, „Ausklauben“, geschah auf großen Tischen, den Klaubtischen.
Fig. 3 zeigt einen Scheider mit dem Scheidehammer C und dem Erzfass E bei der Arbeit. Fig. 4 ist ein Klaubtisch, an dem Mädchen arbeiten (aus Agricola). Biringuccio hebt die Wichtigkeit des Sortierens der Eisenerze ebenfalls besonders hervor: „Wer aber das Eisen weich machen will durch die Güte des Eisenerzes selbst, abgesehen von der Behandlung und den Kohlen, der muss einen geschickten und erfahrenen Sortierer haben, der genau das Reine und das Unreine auswähle und sie durch das Urteil seines Auges und dadurch, dass er sie zerbricht, voneinander sondert.“
Zuweilen geschah das Zerkleinern der Erze unter einem großen Hammer mit platter Bahn, der durch Wasser bewegt wurde. Die Anwendung des Bock- oder Pochhammers, der in seiner Konstruktion dem Stabeisenhammer ähnlich war und nur durch die flache Hammerbahn und den plattenartigen Amboss abwich, fand im Norden, namentlich in Schweden, mehr Eingang, während in Mitteleuropa die Stempelpochwerke gebräuchlicher waren. Agricola beschreibt nur die letzteren bei der Erzzerkleinerung; dieselben waren seiner Zeit im Erzgebirge bereits in allgemeiner Anwendung, während sie in den übrigen europäischen Ländern erst später Eingang fanden. So bediente man sich in Frankreich noch ausschließlich der Mörser und Siebe zur Zerkleinerung der Erze und erst im Jahre 1579 soll das erste Pochwerk aufgestellt worden sein.
In Deutschland waren dagegen die Trockenpochwerke schon im 15. Jahrhundert in Anwendung. Sie gehörten zu denjenigen Arbeitsmaschinen, welche, wie die großen Schmiedehämmer, infolge der Benutzung des Wassers als bewegende Kraft erfunden wurden. Wahrscheinlich pochte man zuerst nur mit einem Stempel, später dann mit drei oder noch gewöhnlicher mit vier. Auch das Nasspochwerk, durch welches erst eine rationelle Aufbereitung der fein eingesprengten Erze ermöglicht wurde, ist in Deutschland erfunden worden, und geschah dies bereits in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts.
Der sächsische Edelmann Sigismund von Maltiz ließ im Jahre 1505 oder 1507 die ersten Nasspochwerke zum Pochen der Zinnerze erbauen. Agricola schreibt: Maltiz habe das Nasspochwerk erfunden, und im Jahre 1512 die ersten zu Dippoldiswalde und Altenberg erbaut. In Joachimsthal baute einige Jahre später Paul Grommestetter, aus Schwarz gebürtig, daher Schwarzer genannt, das erste Nasspochwerk zur Aufbereitung der Silbererze. 1521 wurde dann ebendaselbst ein großes Pochwerk, um über den Plan zu waschen, angelegt, welches große Ersparnisse brachte. 1525 baute Hans Pörtner das erste Nasspochwerk zu Schlackenwalde. Außerhalb Sachsen und Böhmen scheinen damals Pochwerke noch nicht im Gebrauch gewesen zu sein. Wenigstens wurde das erste Trockenpochwerk im Harze, welches nur mit einem Stempel arbeitete, erst 1524 unter der Regierung Heinrichs des Jüngeren von Peter Philipp zu Wildemann angelegt. Während bei dem Trockenpochwerk die an Stempeln befestigten Pocheisen auf eine offene Pochsohle, welche aus einem mit Eisenblech beschlagenen Eisenklotz hergestellt war, aufschlugen, war die Pochsohle bei dem Nasspochwerke mit einem starken Kasten umgeben, in dessen einer Wand ein Gitter oder ein Sieb eingesetzt war, durch welches das Wasser mit dem Pochmehle ausströmte.
Zum Zerkleinern der Eisenerze wendete man das Nasspochwerk nicht an, weil dies zu kostspielig gewesen wäre, man auch die Zerkleinerung des Erzes nicht bis zur Pulver- oder Schliegform. sondern nur bis zur Nussgröße erstrebte. Fig. 5 zeigt ein Trockenpochwerk mit vier Stempeln nach einer der zahlreichen Abbildungen in Agricolas De re metallica. Es werden immer zwei Pochstempel durch Daumen an der Welle gleichzeitig gehoben. In Fig. 6 sind Wasserradwelle mit Daumen (a), Pochstempel mit und ohne Pocheisen (b, c), Pocheisen (d) für sich, Spannring (e) und ein Hebedaumen (f) für sich dargestellt. Ausführlichere Angaben über die Konstruktion der Pochwerke jener Zeit findet man im achten Buche De re metallica.
Das Verwaschen der Erze geschah in Schlämmgräben oder Schlammgerinnen, wie es Agricola in Fig. 7 darstellt. In der Regel war bei den Eisenerzen nur ein Abwaschen der lettigen Beimengung nötig. Ein Verwaschen durch Siebe kam bei Gangerz kaum vor, wohl aber bei den Wiesenerzen oder Raseneisensteinen.