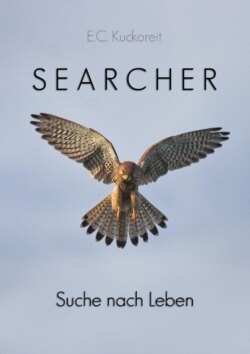Читать книгу Searcher - E.C. Kuckoreit - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auf Suche
ОглавлениеSchwer atmend hob sie ihren Kopf. Das strähnige, leicht feuchte Haar fiel ihr ins Gesicht. Sie richtete ihren Blick über das Dickicht hinaus auf das nun sonnendurchflutete Tal. Der endlose Himmel spannte sich über die weite, spärlich bewachsene Ebene, die bis zu dieser Stadt am fernen Horizont reichte. Der Glanz klarer Farben beruhigte ihr aufgebrachtes, keuchendes Ich.
Mit der Zunge fuhr sie sich über die Lippen. Die Wohltat frischen Wassers genießend. Ganz gebannt von der Intensität des strahlenden Blau blinzelte sie auf die jenseits des Tales liegende Hügelkette, über der neue Wolken orangefarben aufflammten. Sie versuchte ihre Gedanken zusammenzuhalten.
Dies war die vierte Regenzeit in ihrem Leben, in der es tatsächlich regnete. Die Feuchtigkeit erfüllte die Luft mit unzähligen ungewohnten Gerüchen. Und sie hatte das Gefühl, nicht in der Lage zu sein, dieses Glück ausreichend zu würdigen.
Die vor ihr liegende Aufgabe nahm ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch.
Wie sollte es ihr gelingen? Wie sollte sie über den stetig noch weiter anschwellenden Fluss kommen? Die Stadt lag noch weit dahinter - wie eine Festung. Dort musste sie hinein.
Wie sollte sie sich dort bewegen, ohne sofort als Fremde wahrgenommen zu werden? Und das waren nur die ersten, unlösbaren Probleme. Mehrfach schluckte sie gegen den Kloß und die Enge in ihrem Hals an, schloss die Augen und sprach sich selbst lautlos Mut zu. Sie würde sich den Problemen stellen. Im Moment brauchte sie eine Pause.
Das Gesicht zum Himmel gerichtet, überließ sie sich der Erinnerung an die Zeit, in der sie nur eine Sorge gekannt hatte: die Sorge, kein Wasser zu finden.
Sie blieb sitzen, schob die Gegenwart beiseite und dachte zurück an das Leben, das hinter ihr lag.
Genauso hatte sie damals, aus einem bedrückenden Gefühl heraus, ihren Kopf gehoben.
Damals, als sie halb verdurstet in das gnadenlos strahlende Blau geblickt hatte. Damals, als sie schon lange ein erfahrener Searcher war, eine Wassersucherin. Dennoch eine unerfahrene, junge Frau, fast noch ein Mädchen. Frei und stark!
In der stillen, kalten Zeit kurz vor Morgengrauen war sie damals heimgekehrt. Erschöpft von ihrer langen Wanderung hatte sie nach dem Wasserschlauch neben dem Eingang gegriffen und die letzten darin befindlichen Tropfen begierig in ihre ausgedörrte Kehle rinnen lassen. Dann hatte sie sich in die freie Hängematte vor der Hütte gelegt und war sogleich in einen traumlosen Schlaf gefallen. Die winzige, unscheinbare, wie in der endlos weiten, kargen Sandlandschaft verlorene Grasmattenhütte, war ihr Zuhause. Ein Zuhause für kurze Zeit.
„Ich hab euch gehört.“
Sie erwachte. weil ein kleines, kugelartiges Ding hart in ihr Gesicht traf. Die gleißende Sonne stand bereits wieder brennend am Himmel. Ihr Mund fühlte sich schon wieder trocken und rau an. Ohne sofort die Augen zu öffnen, waren ihre Sinne geschärft. Gleich darauf spürte sie krabbelnde, winzige Beinchen auf der rissigen, trockenen Haut. Unwillkürlich strich ihre Hand über die Stelle. Ein zweites und drittes Kügelchen traf ihren Körper. Entschlossen schlug sie ihre Lider auf.
Ein dicker, runder Käfer mühte sich, beinahe direkt vor ihrer Nase, durch das lockere Geflecht ihrer Hängematte. Zwei weitere schillernde Käfer liefen über ihren Bauch und ihre Brust.
„Igitt!“, schrie sie und schwang sich so schnell auf, dass sie fast aus der Matte gefallen wäre.
Ganz in ihrer Nähe ertönte glockenhelles, mehrstimmiges Gekicher. Drei blitzende, dunkle Augenpaare lugten hinter einem großen Sandsteinbrocken hervor und warteten auf ihre Reaktion.
„Na wartet, wenn ich euch kriege ...“, rief sie den Kindern lachend zu, die darauf, johlend vor Freude, in alle Richtungen davonrannten.
Erst lächelte sie, dann blickte sie in den wolkenlosen, azurfarbenen Himmel und die Sorge kehrte in ihr Gesicht zurück. Yambi kam aus der Hütte geschlurft. In einem flachen Korb trug sie drei duftende, kleine, handgeformte Brotlaibe. Mit strahlenden Augen bot sie ihr einen der kleinen Laibe an: „Hallo Shana. Schön, dass du wieder da bist! Ich habe deine Sandalen aufgehängt.“
„Danke, Yambi.“
Yambi, eine ältere Frau, gezeichnet von den Entbehrungen des Lebens in diesen wasserarmen Zeiten, teilte mit den Kindern und Shana das Schicksal der freien Wüstennomaden. Sie gaben sich, in dieser trostlosen Zeit, gegenseitig Halt.
Vorsichtig tastend schob Shana ihre Füße in den staubigen Sand unter der Hängematte, die geschützt zwischen der Hütte und einem längst verdorrten Baum aufgespannt war. Ängstlich darauf bedacht, ja keinen der glänzenden Chitinpanzer unter den Füßen krachen zu fühlen. Sie ekelte sich zu sehr vor diesem Gefühl, mit bloßer Haut eines der herumkriechenden Insekten zu zertreten. Aber der Anblick des trockenen, harten Bodens brachte ihre Gedanken schnell wieder von den widerlichen Dingen dieses Lebens fort.
Seufzend stand sie vollends auf und ging zum offenen Eingang der Hütte. Die beiden Jungen hatten heute schon Wasser geschöpft. Der Wasserschlauch war wieder gefüllt. Mit tiefen Zügen trank sie von der sandig schmeckenden Brühe. Wie gut das tat.
Die Welt, rund um die Hütte, war in den letzten Jahren gänzlich grau bis rötlich-braun, einfach komplett sandfarben geworden. Nur der wolkenlose Himmel erstrahlte meist in gleißendem Blau. An den kahlen Zweigen eines weiteren verdorrten Akazienbaumes hingen ihre Sandalen und sie beeilte sich, die flachen Sohlen unter ihre Füße zu binden.
Yambi, tatkräftig, temperamentvoll, kam erneut aus der Grasmattenhütte und sah sie unverwandt an. Der Blick machte Shana verlegen. Sie senkte den Kopf und fühlte den Kloß in ihrem Hals. Ihr war zum Heulen zumute. Denn jetzt nahte der Zeitpunkt, an dem sie ihren Misserfolg eingestehen und die enttäuschten Gesichter ihrer Familie ertragen musste.
„Ich war erfolglos“, stieß sie leise hervor.
„Ehn.“
Dieser Seufzer war Yambis einzige Reaktion. Mit wehendem Schleier drehte sie sich um und ging wieder ins schattige Innere. Shana sollte ihre Verzweiflung nicht sehen. Egal wie schwierig es war oder noch werden würde, sie würden zusammenhalten. Für Shana wollte sie Stärke zeigen.
Das hätte sie nicht tun brauchen. Shana wusste, wie hart ihre Nachricht wirkte und sie schämte sich sehr. Ihre Familie hatte immer gut gearbeitet. Und nun?
Vor längerer Zeit hatte Shana dieses Fleckchen Erde gefunden, an dem damals karges, aber grünliches Gestrüpp die Wasserstelle anzeigte. Seitdem lebten sie hier. Ungewöhnlich lange für das freie Volk. Dies war ihnen nur möglich, weil sie das Wasserloch ab und zu tiefer gruben. Ihre Brüder mussten dazu mittlerweile in den Schacht hinabsteigen. Beim Graben waren sie stets der Gefahr ausgesetzt, von sich über ihnen lösenden Teilen der Wände, verschüttet zu werden. Früher war es leichter gewesen. Auch im Sommer konnte man an der Wasserstelle, nach ein wenig Graben, noch immer einen glänzenden Wasserspiegel erkennen.
Und dann hatte ihnen sogar das Glück gelacht.
Yambi hatte sich damals auf ihrer Suche nach Nahrung sehr weit von der Hütte entfernt. Dabei war sie einer kleinen Karawane begegnet. Einer der Männer war verletzt und sie hatte erfolgreich die Wunde des Mannes behandeln können. Aus Dankbarkeit hatten die Karawaniers ihr einen Sack Hirse geschenkt und respektiert, dass sie ihnen keine Auskunft gab, woher sie kam und wohin sie gehen wollte.
Mit dem so erworbenen, unglaublichen Nahrungsvorrat und dem noch nicht versiegten Wasserloch, konnten sie länger als üblich an dem jetzigen Ort überleben. Eine seltene Annehmlichkeit.
Seit einiger Zeit war es nötig, zum Wasserschöpfen das Wasserloch jedes Mal noch tiefer zu graben. Bald würde es zu gefährlich und auch vergebens sein, denn selbst in der Jahreszeit, die eigentlich die Regenzeit hätte sein sollen, stieg der Wasserspiegel nicht mehr.
In absehbarer Zukunft würde das Überleben hier nicht mehr möglich sein. Länger schon reichte das Wasser nur noch zum Trinken und Kochen. Für alles andere, durfte kein Tropfen verschwendet werden. Bis sie weiterziehen würden, mussten die beiden jüngeren Brüder Yambi helfen. Jeden Tag brauchten sie zusätzliches Wasser. Die Brüder mussten also täglich zu jeder noch so kleinen Wasserstelle, die Shana in der Nähe fand, laufen, um die Wasserschläuche aufzufüllen und so für das notwendigste Wasser zu sorgen.
Shana unternahm derweil ihre weiten Wanderungen allein - immer auf der Suche nach der neuen Wasserstelle, die endlich einen Lagerwechsel ermöglichen würde. Und ihre Wege wurden immer länger, das durchstreifte Gebiet immer größer. Aber gleichgültig wie müde sie war, sie gab nicht auf. Die Sorge, nichts mehr zu finden, wurde mit jedem Mal stärker, doch das würde sie nicht davon abhalten, ihre Aufgabe zu erfüllen.
Eigentlich hätten sie die Hütte ja längst aufgeben sollen ...
In ihrem kurzen Leben hatte sie oft genug, die Opfer des Mangels vorgefunden, wenn sie von einer Wanderung zurückkam. Diesmal waren es nur die enttäuschten Augen der Kinder, die sie mit lautlos bettelndem Blick verfolgten. Die großen, dunklen Augen in den kleinen, ausgezehrten Gesichtern, die trotzdem jedes Mal freudestrahlend aufleuchteten und ihr lachend entgegenkamen. Für sie, war Shana bereit alles zu geben. Wie gerne wollte sie ihnen endlich eine gute Nachricht bringen!
Als sie sich jetzt zum erneuten Aufbruch vorbereitete, wusste sie, wenn sie bei der kommenden Suche keine ergiebigere Stelle fand, würden sie alle aufs Geratewohl losziehen müssen. Die Sorge erdrückte sie und sie fragte sich, ob es nicht sinnvoll sei, sich von dem Sandland des Westens abzuwenden.
„Yambi, wie weit ist es bis zum Ostgebirge?“, fragte sie in den kleinen, dunklen Raum, während sie zögernd eintrat.
„Warum in aller Welt willst du das wissen? Im Osten lauern größere Gefahren auf uns, als der Durst. Das hat jedenfalls dein Vater immer gesagt. Das Sandland ist hart, aber sicher.”
„Yambi, ich finde im Sandland keine Wasserstellen mehr“, erwiderte sie mit müder, ermattender Stimme und atmete hörbar aus. Sie glaubte, Yambis Augen in dem dämmrigen Licht aufblitzen zu sehen.
Die ältere Frau richtete sich zu ihrer vollen Größe auf. Noch immer war sie eine schöne, würdevolle Erscheinung, die keinen Zweifel daran aufkommen ließ, dass sie die kleine Sippe beschützen würde. Einen Augenblick lang sah sie Shana stumm an, dann sagte sie mit Nachdruck: „Shana, hör mir zu: Ich habe weder dich noch deine Geschwister oder meine Tochter aufwachsen sehen, um mitzuerleben, wie ihr alle in die Sklaverei geht. Das ist genau das, was uns im Osten erwartet. Und glaube mir, dich wird es am schlimmsten treffen. Du hast das Erbe des alten Volkes. Du weißt, dass deine helle Haut nicht der Segen ist, den dein Vater darin sah. Mir und den Kindern würde kein so viel schwereres Leben drohen. - Aber du? Alleine deine Haare zögen jedes Mal die Aufmerksamkeit auf sich, wenn es jemanden bräuchte, den man benutzen kann. Und deine Haare könnten wir scheren, doch was willst du gegen deine Haut tun? Diese würdest du im wahrsten Sinne des Wortes stets zu Markte tragen. Schnell wärst du vollkommen rechtlos. Und mit 'vollkommen' meine ich vollkommen! Nichts und niemand würde dich schützen. Also vergiss solche Gedanken vom Osten. Setz dich, iss und geh dann nach Südwesten.“
Shana stopfte eilig etwas Brot in ihren Mund, nickte Yambi zu, griff ihre Wasserbeutel und die Provianttasche und marschierte los. Hätte sie auch nur geahnt, dass es das letzte Mal war, an dem sie ihre Sippe sah, wäre sie nicht so leicht davon gegangen.
Seit sie ihr Grasmattenlager an diesem Ort aufgeschlagen hatten, war Shana in Richtung Norden aufgebrochen. Seitdem ging sie bei jeder Wanderung ein wenig weiter nach Westen los. Jetzt führte der Weg schon südwestlich. Dorthin, wo sich der Sand erstreckte, soweit ihre Augen schauen konnten.
Stets ging sie von ihrem Lagerplatz startend, geradeaus in die ausgesuchte Himmelsrichtung. Wenn sie nach drei bis vier Tagen kein Wasser fand, ging sie einen halben Tagesmarsch zur bisher eingehaltenen Linie nach links und dann genau Richtung Lager zurück. So kam sie wieder zur Hütte, bevor ihre Wasservorräte gänzlich aufgebraucht waren. Auf diese Weise suchte sie die gesamte Gegend, um die Hütte herum, strahlenförmig ab.
Ihr Vater, Rodas, hatte sie lange gelehrt, wie man die Richtung wirklich einhalten konnte und wie der Stand der Sonne und der Sterne als Markierung dienten. Immer wieder hatte er dies mit ihr geübt, sie bei den geringsten Fehlern korrigiert. Liebevoll, aber konsequent. Auch die winzigen Unterschiede in der Farbe des Sandes, der Größe der Körnung, hatte er sie lesen gelehrt. Jetzt gab ihr der Sand wertvolle Hinweise auf dem Weg. Ein Searcher, der seine Augen und Ohren nicht optimal ausnutzte, war dem Tod geweiht und damit auch die jeweilige Sippe. Rodas hatte sie bei jedem Aufbruch erneut gewarnt: „Wir verlaufen uns nur ein einziges Mal in unserem Leben.“
Wie versprochen, wandte sie sich wieder ein wenig weiter nach Südwesten. Vor ihr lag die weite, unwirtliche Ebene, deren Anblick jedem vernünftigen Menschen einen Schrecken eingejagt hätte. Doch Shana war nicht vernünftig. Welche Herausforderung es war, genau in dieser lebensfeindlich wirkenden Einöde nach winzigen Fleckchen zu suchen, die ein karges, auf das notwendigste reduzierte Leben ermöglichten, kam ihr gar nicht in den Sinn. Was jedem anderen Bewohner der Gegend als vermeidbarer Wahnsinn erschien, war für sie die einzig denkbare, nicht in Frage zu stellende, gewohnte Lebensform. Das freie Volk, hatte unsichtbar für den Rest der Welt zu existieren. Nur dann konnten sie frei bleiben. Aber darüber hatte sich Shana ebenfalls noch nie Gedanken gemacht. Was sie hier tat, war alles, was sie kannte, war für sie wie die Existenz der kleinen Tiere, mit denen sie diesen Lebensraum teilte, einfach da, so selbstverständlich wie Atem holen.
Schritt für Schritt setzte sie voran. Bald brannte die Glut des Sandes an ihren Fußsohlen, zwang die sengende Hitze sie anzuhalten. Obwohl ihre Füße mit einer dicken Hornhautschicht bedeckt waren, entschloss sie sich, die ledernen Strümpfe zum Schutz vor dem gnadenlos glühenden Boden anzulegen. Das Atmen fiel schwer, obwohl der Gesichtsschleier verhinderte, dass die heiße Luft direkt in ihren Rachen strömte und mit jedem Atemzug ihre Lungen verbrannte. Jetzt war der eigene Kopf der ärgste Feind. Wenn sie ihren Gedanken auch nur kurze Zeit erlaubte, Zweifel am möglichen Erfolg ihrer Mission zu schüren, war sie verloren.
Für ein paar Schritte schloss sie die Augen, sperrte das Bild der zitternden Luft aus, lauschte konzentriert auf den Klang des knirschenden Sandes. Der Untergrund änderte sich. Statt des fein geriffelten, festen Bodens betrat sie ein Feld mit einer zunehmend dickeren, weit lockeren Sandschicht. Sie änderte ihren Gang. Schob die Füße schlurfender voran und spähte durch halb gesenkte Lider vor sich. Noch gewährte der Sonnenstand ihr eine längere Strecke. In seinem Zenit würde sie sich einfach niederkauern, den weiten Umhang über den Kopf legen und sich darunter reglos verbergen, bis die ärgste Glut nachließ. Alles deutete darauf hin, dass der Wind stärker werden würde. Gegen den Wind würde sie mehr Kraft brauchen, doch er würde die Hitze scheinbar lindern.
Die Entfernung von ihrem Lager war noch viel zu gering, als dass sie sich die geringste Hoffnung machen konnte, bereits Anzeichen eines unterirdischen Wasserlaufes zu entdecken. Dennoch durchforstete ihr Blick den vor ihr liegenden Boden mit voller Konzentration. Die Tücke der heutigen Wegstrecke lag in ihrer Eintönigkeit. Diese Strecken wurden mit jedem Dürrejahr länger.
Am zweiten Tag erreichte sie den Punkt, der vom Lager aus nicht mehr zu sehen war. Er lag jenseits des Horizontes für die Hüttenbewohner.
Auch wenn Shana nach dem letzten Marsch vermutet hatte, bei ihrem nächsten Gang die leicht hügeligen, sandigen Ebenen zu verlassen, so hatte sie dennoch nicht angenommen, die sich nun vor ihr erstreckende Landschaft schon dieses Mal zu erreichen.
Sie erblickte die Sandberge. Überwältigt schaute sie auf jene Landschaft, deren leuchtende Farben, rotgoldene, sanfte Hügel vor ewigem Blau, wie eine Verheißung erschienen und die doch lebensfeindlicher war als die meisten anderen Orte. Die Dünen stellten an einen Searcher ganz andere Herausforderungen als die weite Ebene.
Hohe, weit geschwungene Sandberge und tiefe Schluchten, in sich stetig langsam verändernder Form, eine gewaltige Landschaft, die auf eigene Art Respekt einflößte. In ihrer Nähe war der Mensch selbst nur wenig mehr als ein Sandkorn. Nichts an der glatten Sandwand einer Düne verriet, was sich hinter dem scharfen Kamm verbarg. Mal war dort nichts als Sand, Sand und nochmals Sand. Mal begegnete man einem spärlichen Bewuchs, eine erwünschte Unterbrechung der Eintönigkeit. Pflanzen waren immer ein ersehnter Hoffnungsschimmer. Wo sie waren, musste Wasser nah genug unter die Oberfläche kommen.
Ein solcher Hinweis auf Wasser würde auf ihrem Weg hilfreich sein. Wenn es auch nicht dem entsprach, was sie finden musste. Allenfalls könnte sie graben bis der Sand feucht wurde, dann noch tiefer und schließlich könnte sie mit Mühe ihre Schläuche auffüllen und damit ihren Suchradius vergrößern.
Würde sie aber eine solche Stelle, die sich zwischen den Dünen verbarg, ihrer Sippe zeigen wollen, so wäre sie wahrscheinlich kaum mehr auffindbar, selbst wenn sie mit ihrem Bruder genau den gleichen Punkt wiederfinden würde. In der Zwischenzeit hätte die Düne den Zugang bestimmt wieder mit einer viel zu dicken Schicht Sand überlagert. Diese Bewegung machte die Dünen faszinierend und gefährlich zugleich.
Dennoch gab ihr jetzt der Anblick dieser riesigen rötlich-braunen Wellen neuen Mut. Tief aus ihrem Inneren drang ein Jubelschrei …
Hier war schon eindeutig Hathaigebiet. Aber Angehörige des Stammes der Hathai waren selten im Sandland unterwegs. Auch störten sie sich nicht an Angehörigen des freien Volkes, die sich in ihrem Gebiet aufhielten. Die beiden Völker ließen sich gegenseitig in Ruhe. Obwohl die Hathai dieses Gebiet als ihr Territorium beanspruchten, lebten sie hauptsächlich in ihren östlicher gelegenen Oasen, ihre Jagdgebiete erstreckten sich in der gleichen Richtung, dort, wo die großen Karawanenstraßen ihre Gebiete kreuzten.
Shana wusste nicht wirklich viel über Gebietsgrenzen. Sie hatte gelernt, sich sowohl von den sesshaften Arkani als auch von den Hathai möglichst fernzuhalten. Auch wenn beide Völker keine wirkliche Bedrohung für die Freien waren, für eine Hellhäutige war es immer besser, unentdeckt zu bleiben. Das jedenfalls hatten Yambi und ihr Vater ihr immer wieder und wieder gesagt.
Aus Shanas Sicht, war das gesamte westliche Sandland die Heimat, in der ein Searcher nach Wasser suchen konnte - unabhängig von Stammesgrenzen.
In ihrem bisherigen Searcherdasein war sie selten zwischen Sanddünen gewandert. Die zum Teil steilen Anstiege forderten Kraft und Aufmerksamkeit. Feste Sandfelder wechselten mit kaum vorhersehbaren Stellen, an denen der Sand bei der leichtesten Berührung ins Rutschen kam, in die Tiefe floss, als wäre er Wasser.
Wenn der Wind nur ein wenig stärker wurde, führte er die obersten Sandschichten mit sich. Der Boden wurde dann von einer feinen Schicht sandigen Nebels verdeckt. Jeder Schritt musste mit doppelt großer Sorgfalt und Bedacht gesetzt werden und gleich tausend feiner Stiche bohrten sich winzige Sandkörner zwischen die Falten des Stoffes, fanden jeden noch so kleinen Spalt, prasselten auf die Haut.
So gefährlich und kräftezehrend diese Gegend war, das Bild, das sich ihr bot, betörte Shanas Herz. Sie verspürte eine Art Glück und Geborgenheit wie an kaum einem anderen Ort. Dies hatte nichts von der Trostlosigkeit einer endlos erscheinenden Ebene, vielmehr durchströmte ein Gefühl der Erhabenheit ihren Geist. Trügerisches Paradies. Die Tatsache, dass die Dünen einen Menschen und vieles andere wie ein Geheimnis verbergen, sogar verschlingen konnten, machten zum Teil ihren Reiz aus.
Shana sog die Luft mit geschlossenen Augen ein und beschloss, ihre Richtung ein wenig zu ändern. Sie wollte den Weg am Saum der Dünen entlang nehmen, entgegen der Zugrichtung der Sandberge. So würde sie am schnellsten auf deren Rückseite kommen und vielleicht geschähe das Wunder, vielleicht fand sie eine neue Wasserstelle für die ihren.
Um sich eine kurze Weile zu sammeln, hockte sie sich hin. Wurde beinah unsichtbar. So sehr verschmolzen ihre Konturen in den Farben des Sandes.
Ein paar Augenblicke später huschte am Rande ihres seitlichen Blickfeldes ein Schatten durch den Sand. Ohne zu denken, schoss sie in einer fließenden Bewegung auf den Punkt und erfasste eine Maus. An dem Tier war nicht viel dran, aber es würde ihre Vorräte aufstocken. Ein fester Griff und sie hatte dem kleinen Wesen das Genick gebrochen. Danach befestigte sie es an ihrer Tasche.
Eingestimmt auf die bevorstehende Aufgabe, erhob sie sich bedachtsam. Die ersten Schritte gingen leicht bergab. Fast war sie versucht, sich herunterrollen zu lassen. Doch dafür kannte sie die Düne nicht gut genug. Hinter der nächsten Kuppe veränderte sich der Geruch der Luft. Jedes der folgenden Sandtäler hatte seine Eigenheiten. Außer in der Zeit des Sonnenzenits gab es sogar schattige Stellen.
Am späten Tag überschritt sie einen relativ kleinen Hügel. Was sie auf der anderen Seite sah, ließ sie vor Freude fast aufschreien. Im hinteren, leicht östlich gelegenen Teil verwandelte sich der Boden an einer Stelle zu festerem Geröll. Dazwischen reckten sich ein paar Pflanzen der feindlichen Umwelt entgegen. Eines war sicher, dieser Platz würde heute ihr Nachtlager werden.
Sie betrachtete die Färbung des Bodens auf das Genaueste, dann wusste sie, wo sie graben musste.
Mit Hilfe ihrer Schale arbeitete sie sich armtief in den Boden. Ab Ellbogentiefe spürte sie die Feuchtigkeit. Kurze Zeit später sammelte sich Flüssigkeit am Grund des gegrabenen Loches. Noch zwei Schalen und sie würde das Versprechen auf Leben ans Tageslicht holen. Dieses Gefühl übertraf, wie jedes Mal, alles - alles, was sie sich vorstellen konnte.
Sie tauchte die Schale ein, ließ sie auf dem Grund liegen und rollte sich selbst ein wenig zur Seite, die Augen gerade in die unendliche Höhe des ewigen Himmels gerichtet. Zweimal zehn tiefe Atemzüge verharrte sie, dann hob sie die Schale heraus. Da ihre Wasservorräte noch reichlich waren, hatte sie keine Eile. Sie ließ die Schale stehen, wartete bis sich der Sand abgesetzt hatte und die Flüssigkeit sich klärte.
Und dieser Ort versprach noch mehr für heute Nacht. Ganz in ihrer Nähe entdeckte sie einen längeren, trockenen Ast. Es war nicht ersichtlich, wo er herkam. Aber an solchen Plätzen war es möglich, alte Überreste von längst abgestorbenen Bäumen zu finden, die der Sand viele Jahre bedeckt hatte und die dann vom Wind eines Tages wieder freigelegt wurden. Das Holz reichte für ein kurzes, kleines Feuer. Gerade genug, einen einzelnen Brotfladen zu backen. Solch ein Glück war ihr nun mehrere Suchen nicht widerfahren.
Das Wasser hatte lediglich einen leicht sandigen Beigeschmack, deutete aber darauf hin, dass hier eine unterirdische Wasserader nahe an die Oberfläche kam. Sie würde heute an diesem Ort bleiben und morgen in Ruhe ihre Schläuche auffüllen können.
Der Schlaf fand in dieser Nacht leicht zu ihr, mit Träumen von lachenden Gesichtern und Kindern, die genug Wasser hatten, um es in ihre Gesichter zu spritzen.
Gegen Morgen weckte sie ein schleifend schabendes Geräusch ganz in ihrer Nähe. Sie blinzelte. Vor ihren Augen bewegte sich ein schimmerndes Prachtexemplar einer Dornschwanzagame.
Instinktiv reagierte Shanas Körper. Jede Faser ihrer Muskulatur machte sich bereit. Bei einer solchen Gelegenheit, gab es nur einen Versuch. Sie war eindeutig noch nicht wach genug. Es war besser zu warten und das Tier zu beobachten. Daher entspannte sie sich mit einem tiefen Atemzug wieder. Sie musste eine andere Haltung einnehmen, damit sie eine Chance hatte, die Agame wirklich zu erwischen. Ihre Muskeln waren von der nächtlichen Kälte noch zu steif. Vor Erregung kribbelte es unter ihrer Haut. Ein wenig später würde die Situation günstiger sein.
Die Agame entfernte sich eine kleine Strecke. Sie fraß genüsslich an einem niedrigen Gestrüpp in der Nähe. Mit sehr geschmeidigen, geräuschlosen, langsamen Bewegungen erhob sich Shana in eine kauernde Stellung, näherte sich der Echse und sprang.
Die Gegenwehr des Tieres war unerwartet stark und Shana musste zweimal nachsetzen, um den sich windenden Körper sicher auf den Boden drücken zu können. Sie griff nach ihrem Dolch, schickte ihren Dank an das Leben und die Ahnen, schnitt rasch und sicher die Kehle ihres Opfers durch.
Bei dem Kampf blieb ihr Überwurf im Gestrüpp hängen und zerriss. Unwichtig, angesichts des Fangs! Das Fleisch des beinah armlangen Tieres reichte sicher für die gesamte Suche. Shana konnte ihr Glück kaum fassen. Mit einem Hochgefühl, Wasser und Nahrung für mehrere Tage, setzte sie kurze Zeit später ihren Weg fort.
Zum ersten Mal seit längerem veränderte sie ihre Richtung während des Marsches grundlegend. Sie hatte eine Spur. In den nächsten Tagen folgte sie den winzigen Hinweisen auf die Wasserader. Beflügelt von der Hoffnung entging ihr kein Detail. Selbst wenn sie diesmal die eigentliche Wasserstelle noch nicht finden würde, so viele gute Zeichen hatte sie lange nicht gesehen.