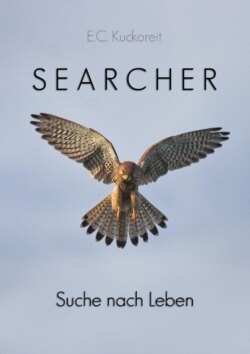Читать книгу Searcher - E.C. Kuckoreit - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hathailager
Оглавление„Neiiiiin!“ Ihr Schrei gellte in ihren eigenen Ohren und vertrieb den Schlaf.
„Ist ja gut, ist ja gut! Beruhige dich, Mädchen. Hier bist du in Sicherheit!“
Kari, eine zierliche Frau mittleren Alters, hielt das Mädchen fest und wiegte es zur Beruhigung. Wie so oft war es aus dem Albtraum aufgeschreckt, den es mittlerweile seltener, aber immer noch zu oft, durchleben musste. Selbst jetzt am späten Nachmittag, wo sie nur ein wenig gedöst hatte, jagten die Geister der Vergangenheit ihr im Schlaf nach.
„Komm, Mädchen. Steh auf und hol Wasser. Das bringt dich auf andere Gedanken.“
Seit Beginn dieses Mondlaufs war Shana im Lager der Hathai. Ihre Haut war gut verheilt, ihre Augenlider nicht mehr entzündet und ihr Blick nicht mehr getrübt. Sie begann, ihre Umgebung mit weit aufgerissenen Augen genauer zu betrachten und stellte Kari Fragen, über all die ungewohnten Dinge, die sie hier sah. Sie fühlte sich zunehmend kraftvoller und richtete ihre Gedanken langsam wieder auf das, was in der Zukunft lag. Yambi hatte ihr zwar beigebracht, dass sie jetzt leben und denken müsse. Aber Shana hatte es nicht lassen können und immer darüber nachgedacht, was wohl einmal käme.
Vor ein paar Tagen hatte Shana beobachtet, wie der Ziegenbock bei der Ziege aufritt. Bestürzt hatte sie Kari gefragt, warum der Bock sich denn tragen lassen wolle, ob er zu alt sei, um selbst zu stehen. Kari hatte bei dieser Frage nur den Kopf geschüttelt und, nachdem sie sich tapfer das Lachen verkniffen hatte, geantwortet: „Nein, Shana, der Bock will nur kleine Ziegen machen!“
Das Mädchen hatte sie verständnislos angeblickt und sich hastig eine andere Beschäftigung gesucht.
Während sie jetzt an der Quelle die Krüge füllte und sich gerade darüber Gedanken machte, wann sie das Lager verlassen würde, bemerkte sie eine kaum wahrnehmbare, sich rasch nähernde Staubwolke am westlichen Horizont. Ihre jahrelange Konzentration auf solche Zeichen und die gelernte Vorsicht versetzten sie sofort in erhöhte Aufmerksamkeit.
„Werra, schau dort hin! Wird jemand erwartet?“
Werra, Karis älteste Tochter, hob den Kopf. Sie brauchte lange, bis sie in der gewiesenen Richtung überhaupt etwas erkennen konnte.
Entweder hatte die Kleine mit ihren neuneinhalb Jahren noch nie einen Überfall erlebt und die Sicherheit, die alle hier behaupteten, entsprach den Tatsachen oder die Angst verlangsamte dem Mädchen schlicht den Verstand. Anders konnte Shana sich diese lahme Reaktion nicht erklären.
„Nö. Außer Karas und so“, verkündet die Kleine völlig gelassen und beschäftigte sich weiter mit den Käfern, die sie hier am Wasser entdeckt hatte.
Shana füllte die Krüge gewissenhaft bis zum Ende, ehe sie zum Zelt zurückging. Sie wollte die Kleine nicht verängstigen. Gleichzeitig blinzelte sie unentwegt gegen die tiefstehende Sonne. Ihre Augen suchten immer wieder die sich nähernde Staubfahne. Wenigstens ein paar andere Bewohner des Lagers mussten sie mittlerweile bemerkt haben. Doch keiner schien darauf sonderlich reagieren zu wollen.
Ohne weiter zu zögern, trat sie ins Zelt ein, stellte den Wasserkrug ab und suchte ihre Sachen. Wenn Gefahr drohte, wollte sie wenigstens vorbereitet sein. So wie sie aber bemerkte, dass sie nach wie vor die Einzige war, die auf die sich nähernde Gefahr reagierte, bezwang sie ihre Instinkte und versuchte ebenso ruhig zu bleiben, wie die Übrigen.
Als Kari das Zelt betrat und Shana ganz ruhig fragend ansah, brach sich Shanas Anspannung ihren Weg.
„Was tut ihr? Es nähern sich Reiter dem Lager und ihr tut alle, als ob es vollkommen normal sei!“, schimpfte sie laut.
Ihr Gesicht war verzerrt vor Angst, sie kämpfte sichtlich gegen die aufkommenden Tränen an.
Kari eilte zu ihr, schlang die Arme um sie, streichelte über ihren Kopf und wiederholte in stetigem Singsang: „Ist ja gut! Es ist alles in Ordnung!“, und dabei hielt sie Shana erneut wie ein kleines Kind.
Tatsächlich fasste sich Shana dadurch schnell wieder: „Verzeih!“
„Ist schon gut. Du hast Schlimmes erlebt, aber hier bist du in Sicherheit.“
Diese Sätze hatte Shana jetzt schon so oft gehört und doch begriff sie sie nicht wirklich.
Hier, an diesem Ort, hatten die Hathai keine Angst vor Feinden. Warum dies so war, war für Shana einfach nicht zu verstehen. Den Grund sollte sie erst lange Zeit später begreifen.
Das Lager schmiegte sich an den südlichen Saum eines größeren Dattelpalmhains, unter dessen Schatten sich ein kleiner Teich erstreckte, der von einer Quelle gespeist wurde, die zwischen ein paar Felsbrocken hervorsprudelte. Die Zelte waren großzügig in einem Oval aufgestellt, an dessen nördlicher Seite sich ein größerer, sandiger Platz anschloss, hinter dem sich unter wenigen Bäumen eine Wand aus halbhohem, dichtem Dornengestrüpp befand. Auf diesem Platz hielten die Männer ihre Ratsversammlungen ab. Genau gegenüber, gewissermaßen beim Eingang des Lagers, befand sich ein größerer Pferch im äußersten Schattenbereich der Palmen.
Von der Quelle aus blickte man zwischen dem Pferch und Handars Zelt hindurch auf die große Sandwüste des Westens. Aus dieser Richtung näherten sich gerade die Reiter, deren Hufschläge bereits zu hören waren. Shana beunruhigte das Geräusch; daran änderten auch Karis abwiegelnde Worte und Gesten nichts.
Kari bemerkte es und ein resignierendes Lächeln überzog ihr Gesicht. Sie nahm ihr jüngstes Kind und forderte Shana mit fröhlichem Ton auf: „Na komm schon, lass uns nachschauen, wer da kommt!“
Erleichtert stellte Shana fest, dass nun doch einige Lagerbewohner vor den Zelten standen und den Reitern entgegen blickten. Da drang aus Karis Mund ein heller, lang gezogener, freudiger Triller.
Fünf zwar offensichtlich prächtig gekleidete, aber mit Sandstaub überzogene Reiter zügelten vor dem Lager die Pferde und ritten in gemächlichem Schritt zwischen die Zelte. Die dunklen Tücher, die ihre Köpfe und Gesichter verbargen, leuchteten in der untergehenden Sonne. Es waren ausnahmslos Männer, die eindeutig zu den Hathai gehörten, die Gesichter hinter dem Schleier verborgen. In dem schmalen Streifen zwischen dem Stoff, der ihre Stirn und ihre Nasen bedeckte, funkelten ihre dunklen Augen hervor. Mit stolzer, aufrechter Haltung und gleichzeitiger Lässigkeit näherten sie sich verschiedenen Zelten.
Vor ihren Sätteln lagen je zwei mittelgroße, prall gefüllte Säcke, die sie den Wartenden hinunterreichten. Einer der Reiter hielt genau vor Kari, aber statt abzusteigen oder ein Wort des Grußes zu sagen, starrte er nur auf Shana, die sich die ganze Zeit hinter Kari gehalten hatte. Shana stand aufrecht und blickte dem jungen Mann geradewegs in die dunklen, glitzernden Augen.
„Karas, was ist los? Willst du deine Mutter nicht begrüßen oder mir wenigstens das Salz reichen? Weißt du nicht mehr, was sich gehört?“, gluckste Kari mit gespielter Entrüstung. „Nun sieh dir diesen Kerl an. Kaum erblickt er eine junge Frau, kann er sich nicht mehr bewegen oder sprechen! Komm endlich runter und mach den Mund zu, sonst denkt Shana noch, sie wäre ein Wunder und du ein Kamel.“
Der Angesprochene bewegte sich immer noch nicht. Er saß wie gelähmt auf seinem Pferd und glotzte. Kari nahm die Säcke einfach selbst vom Pferd, drückte sie Shana in die Hände und schob sie damit in das Zelt zurück.
Shana hörte, wie der junge Mann umständlich vom Pferd stieg und sie vernahm die Stimme der kleinen Werra, die jetzt ebenfalls von der Quelle zurückgekommen war, um den Ankömmling zu begrüßen. Ihre helle Stimme plapperte in ihrer üblichen, unbekümmerten Art: „Karas. Karas, hast du mir etwas mitgebracht? Karas, stell dir vor, Papa hat eine Freie gefunden. Er ist gejagt worden und musste sich verstecken. Da hat er sie einfach mitgebracht. Sie ist ganz hell. Ganz hell, überall!“
Die letzten Worte hatte das Mädchen nur kichernd ausgestoßen und Shana bemerkte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss, obwohl sie im Zelt war. Sie konnte sich selbst nicht recht erklären, warum ihr dieses Geplapper so peinlich war. Denn an das Erstaunen, welches ihr Aussehen auslöste, war sie ja inzwischen gewöhnt. Hier im Lager war sie in den ersten Tagen ständig angestarrt worden. Schließlich war sie sogar in ihrer eigenen Familie die einzige Hellhäutige nach ihrer Mutter gewesen.
„Nein, du versorgst erst das Pferd und klopfst den Staub ab, bevor du hier rein kommst!“, befahl Kari mit lautem und strengem Ton. Und es war klar, dass sie ihren Sohn damit meinte, der sich geräuschvoll dem Zelteingang genähert hatte. Der grunzte unverständliche Laute, bevor er fluchend das Pferd zum Pferch führte.
Der Klang seiner Stimme war ungewöhnlich dunkel und volltönend, obwohl er sehr leise zu fluchen schien.
Zu Shana gewandt sagte Kari lächelnd und gleichzeitig ernst: „Das hab ich noch nicht erlebt, du hast dem Kerl total den Kopf verdreht! Aber hüte dich vor ihm!“
Mit diesen Worten ging sie scheinbar ungerührt weiter ihren Tätigkeiten nach, reichte Shana das Salz und Mehl aus dem einen und öffnete den anderen Sack. Während Shana die Lebensmittel an ihren Platz brachte, fischte Kari einen roten Umhang und einen blaugrünen, durchscheinenden Stoff aus dem zweiten Sack hervor, ebenso einen weiteren Beutel mit trockenen Früchten, dazu kamen noch ein paar Bündel, in denen sich Nadeln und Garn befanden. Außerdem beförderte sie etliche goldene Schmuckstücke zutage, die achtlos in den Sack geworfen worden waren und einen umso sorgfältiger in ein dickes Tuch eingeschlagenen, rechteckigen Gegenstand.
Das Nächste, was Shana direkt wieder auf den jungen Mann aufmerksam machte, war die Tatsache, dass er draußen über eines der Spannseile stolperte und im Zelt die kunstvoll gestapelten Körbe mit der Kleidung ins Wanken gerieten.
„Karas, du Tollpatsch, schau gefälligst, wohin du deine Füße setzt. Man muss auch laufen können, nicht nur reiten.“ An dem lachenden Tonfall Karis war deutlich zu hören, wie sehr sie ihren Sohn liebte, selbst wenn er ihre sorgfältig gehütete Ordnung gefährdete.
Shana fühlte sich zunehmend unbehaglich. Als der junge Mann endlich ins Zelt kam, wagte sie es kaum sich zu bewegen, vermied es strikt, in seine Richtung zu sehen. Ihr war noch heißer als gewöhnlich. Wieder verharrte er offensichtlich mitten in der Bewegung und starrte sie nur an.
Da betrat Ra'un hinter ihm das Zelt. „Nanu, Brüderchen, endlich zurück? Was machen die Karais? Ich hoffe ihre Märkte erholen sich wieder von eurem Besuch.“
Nun richtete Karas seine Aufmerksamkeit auf seinen Bruder. Laut lachend warfen sich die beiden in die Arme. Drückten einander herzlich, bis Ra'un, der etwas kleiner als sein jüngerer Bruder war, gespielt nach Luft rang und ausstieß: „Bitte, bitte lass mich am Leben, kleiner Bruder!“
Ra'un erfasste gleich, was seinen Bruder zuvor so fasziniert hatte. Er deutete leicht mit dem Kopf auf Shana, die ihnen immer noch den Rücken zukehrte, und sprach mit gesenkter Stimmte: „Tja, ein schönes Fundstück, nicht wahr? Und sie ist wirklich überall so hell!“
Shana fühlte, wie ihr das Blut heiß in den Ohren rauschte. Sie errötete erneut von Kopf bis Fuß. Bisher hatten sie diese Reden nie gestört, niemals. Auf einmal war es anders. Sie fühlte den Blick der funkelnden Augen wie brennende Pfeile auf ihrem Rücken, fühlte sich nackt, obwohl sie vollständig bekleidet war. „Das ist unverschämt“, schoss es durch ihren Kopf. „Nein, nein, er - er ist unverschämt.“
Ra'un zog Karas unterdessen zu den Kissen und Werra stellte ein kleines Kohlebecken für die Teezubereitung vor die Brüder, dabei plapperte sie unentwegt auf die beiden ein, erzählte von den Käfern, von merkwürdigen Blättern und anderen Belanglosigkeiten. Sie plapperte und plapperte, bis Karas sie näher zu sich zog und durchkitzelte. Dies war seine erste, halbwegs normal wirkende Handlung, seit er Shana erblickt hatte, aber selbst dabei wanderte sein Blick immer wieder verstohlen über ihre Gestalt.
Hier im Zelt wickelten die Brüder mit lässiger, geübter Geste ihre Gesichtsschleier ab, um ihren Tee zu schlürfen. Ein entrücktes Lächeln umspielte die vollen Lippen des Jüngeren, wann immer er Shana mit seinen Augen verschlang.
Als sie so nebeneinander saßen, verglich Shana die beiden jungen Männer miteinander. Ihre ebenmäßigen Gesichter wurden von den gleichen halblangen, schwarzen Locken eingerahmt. Große dunkle Augen, kräftige schwarze Brauen, gerade Nasen und wie Handar ein kantiges Kinn - die Hathai waren ein schönes Volk und sie wussten es.
Obwohl Karas nur wenige Jahre älter sein konnte, als sie selbst, wirkte er sehr männlich. Sein Bruder war nicht nur nicht ganz so muskulös, sondern auch sein Gesicht war nicht ganz so kantig in seiner Erscheinung. In Ra'uns Augen lag eine freundliche Besonnenheit, seine Bewegungen waren ruhig und zielgerichtet. Er war eindeutig der Reifere. Karas war lauter, lebhafter und sein Gesichtsausdruck wechselte rascher. Die Lebendigkeit saß unter seiner dunkel bronzefarbenen Haut und das harmonische Spiel seiner Muskeln zeigte sich in jeder Bewegung. So wie er jetzt da saß, war es kaum vorstellbar, dass er ein Zelt leise und unbemerkt betreten konnte.
Als Handar von seiner täglichen Beratung der älteren Männer zurückkehrte, glätteten sich seine Züge vor Freude. Karas beeilte sich, aufzustehen und seinem Vater respektvoll entgegenzutreten. Doch selbst jetzt stolperte er fast und bei der folgenden Umarmung starrte er zwischendurch wieder auf Shana.
Dabei hatte sie sich, seit dem Zusammentreffen der Brüder im Zelt, ganz in eine hintere Ecke zurückgezogen, saß lautlos und unauffällig an ihrem Platz und nähte an der Decke weiter, die sie nach Karis Vorgabe seit einigen Tagen fertigte.
Das Essen fiel an diesem Abend reichhaltiger aus. Karas war aufgefordert zu erzählen. Er berichtete, wie seine Gruppe auf die Spuren einer Truppe Karais gestoßen war und ihnen bis zu deren Dorf gefolgt war. Dort waren die Hathai wohl auf dem Markt gewesen. Der größte Teil der Waren, die sie heute mitgebracht hatten, stammten aus dem Dorf. Aber die Worte, mit denen Karas davon berichtete, beinhalteten einige merkwürdige Umschreibungen, die Shana nicht ganz eindeutig zu deuten wusste und es beschlich sie der Verdacht, dass die Hathai keinen normalen Handel betrieben hatten.
Nachdem sich alle zum Schlafen auf ihre Lager in und außerhalb des Zeltes zurückgezogen hatten, lag Shana lange wach. Sie horchte. Es dauerte eine kurze Weile und gleichmäßiges Atmen durchzog das Zelt. Shana aber verspürte den Drang, noch einmal hinauszugehen. Sie hatte bewusst gewartet, bis alle im Zelt schliefen, denn sie wollte keine Aufmerksamkeit erregen. Sie bewegte sich wie stets, nahezu lautlos.
Die Luft war in diesem Teil der Oase nur unmerklich kühler als tagsüber. Ein sanfter Wind ließ Shana diverse Gerüche intensiver wahrnehmen. Keiner dieser Gerüche war wie Zuhause. Hier mischten sich aufdringliche Düfte verschiedener Blüten mit dem Geruch weidender Tiere. Dies war eine andere Welt. Freundlich, aber immer noch fremd. Allerdings hatte sie sich, seit sie hier war, schon lange nicht mehr so fremd gefühlt wie heute Nacht. Ständig liefen vor ihr die Bilder des erlebten Tages ab: Karas bewegungslos auf dem Pferd. Karas, der stolpert. Karas, der mit seiner melodiösen dunklen Stimme leise und doch volltönend von seiner Reise berichtet. Sein warmes Lachen. Und immer wieder seine Augen. Sein gebannter, brennender Blick.
„Oh, nein!“, stöhnte sie und als ihr klar wurde, dass sie angespannt war, als ob sie auf etwas oder jemanden wartete, ärgerte sie sich noch mehr über sich selbst. Das fehlte noch, dass sie von diesem jungen Hathai von ihrer eigentlichen Aufgabe abgelenkt wurde. Sie musste ihre Kräfte sammeln und möglichst bald Handar mitteilen, dass sie daran dachte, seine Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch zu nehmen. Bisher hatten die von den Albträumen zerrissenen Nächte sie davon abgehalten zu gehen.
Ihre Schritte führten sie zu den Pferden. „Welch robuste Tiere. Mit so einem Tier könnte ich wohl schneller die Spuren meiner Sippe finden und dann ...“, sie wagte nicht weiter zu denken, kalte Furcht kroch an ihr empor und nur ganz langsam registrierte sie, dass sie lautlos weinte. Hastig wischte sie mit ihrem Handrücken die Feuchtigkeit von ihren Wangen. „Sei nicht töricht!”, schalt sie sich selbst, straffte ihren Rücken, wartete einige Atemzüge, bis sie wieder vollkommen ruhig war; dann ging sie mit festen Schritten zum Zelt zurück.
Ebenso lautlos, wie sie es verlassen hatte, glitt sie wieder hinein, fand im Dunkeln ihren Platz und wickelte sich in ihre Decke. Endlich nahm der Schlaf sie in seine beschützenden Arme.
In der Nähe der Feuerstelle hatte Karas sich in seine Decken gerollt, ohne wirklich Ruhe im Schlaf zu finden.
Angespannt und bewegungslos hatte er ihr Hinausschleichen und auch ihre Rückkehr beobachtet. Als er jetzt ihre leisen, gleichmäßigen Atemstöße vernahm, wagte er sich selbst zu bewegen. Er griff sich mit seiner rechten Hand an die Brust und rieb gegen diese einem Schmerz ähnliche Beklemmung an, die er dort verspürte. Noch nie war ihm dies widerfahren. Nicht einmal bei Rubea. Dieses bleiche Wesen, welches im Schutz seiner Eltern, doch ganz in seiner Nähe schlief, raubte ihm fast die Selbstbeherrschung. Seine sonst so klaren Gedanken liefen wild durcheinander. Sie verwirrten sich immer wieder, sein Atem stockte, seine Knie waren seltsam kraftlos, weich und dieses unangenehme Kribbeln im Bauch ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Er wälzte sich herum, suchte nach Schlaf und trotz seiner körperlichen Müdigkeit, gelang es ihm nicht, die grausame Unruhe der heutigen Nacht zu besiegen.
Wieder fühlte er ihren herausfordernden, schamlosen Blick auf seinem Gesicht. Wer war sie? Er hatte sich nicht gewagt, danach zu fragen. Viele Worte waren am Abend gewechselt worden, doch nur wenige über das helle Mädchen. Was hatte Werra gesagt? Sein Vater hätte eine Freie mitgebracht? Und sein Bruder sprach von einem Fundstück. War diese Fremde also eine von jenen Freien, die dort draußen in lebensfeindlicher Wildnis und ohne richtige Stammeszugehörigkeit lebten? Diese kleinen, stetig wandernden Gruppen, die sich von allem fern hielten, weil sie ihre Lebensform gegen alles und jeden verteidigten? Sie gehörte offensichtlich zu den Wesen, die aufgrund ihrer Haut- und Haarfarbe begehrte Sklaven der Meeresstädter waren und für die unglaublich hohe Preise verlangt und bezahlt wurden.
Einmal war er selbst vor langer Zeit in einer dieser Meeresstädte im Osten gewesen. Die Bilder der Erinnerung tauchten auf. Sie verdrängten sogar für kurze Zeit das Bild des hellen Mädchens. In den Städten war das Leben voller fremder, lärmender Anforderungen und so voller Hektik, dass er froh war, als er wieder zu seinem Wüstenleben zurückkehren konnte, das seinesgleichen schon seit hunderten von Jahren führte.
Wieder wanderten die Gedanken zu der Fremden, der Freien.
Im Gegensatz zu diesen Freien, zog sein Stamm auf festen Routen und zu festen Zeiten von Oase zu Oase. Die Hathai verteidigten ihre Lebensform gegen die anderer Stämme, wie die der Karais, die häufiger in Städten siedelten. Aber auch deren Städte hatten wenig Ähnlichkeit mit den großen lauten Städten am Meer. Sie waren sehr viel kleiner, mit rotbraunen Lehmhäusern und es gab nur einige Maschinen dort. Dafür waren sie Zentren des Wüstenhandels. Alle möglichen Waren wurden von durchziehenden und ansässigen Händlern angeboten und manchmal fand man bei den Händlern, die sehr alte Dinge feilboten, sogar Bücher. Bücher, in denen Karas schon von hellhäutigen Menschen mit goldenen Haaren gelesen hatte.
Außerdem wurden Vieh- und Pferdemärkte im Schatten dieser Städte abgehalten und dort handelten die Hathai dann auch mit den Karais. Aber nur dort.
Karas hatte vor langer Zeit von seiner Großmutter lesen gelernt und sie hatte ihm von längst vergangenen Zeiten erzählt, in denen die Technik bis zu den Wüstenvölkern gekommen war. Sie wusste vieles von solchen Dingen, denn trotz ihrer Zugehörigkeit zu den Nomadenstämmen hatte sie als ganz junges Mädchen eine Zeit lang in einer der Wüstenstädte gelebt und eine Schule besucht. Daher wusste sie auch, dass es viele Generationen vor ihr zu gewaltigen Katastrophen auf der Erde gekommen war, die einen großen Teil ihrer Welt verändert hatten.
In den Gegenden, in denen ihre Vorfahren lebten, hatte es erst kurze Zeit vorher große Umwälzungen gegeben. Die Völker der Region hatten nach vielen Jahren eines Lebens, in dem es eine reiche Herrscherschicht gab und viele Menschen, die in Armut und der ständigen Gefahr des Hungers lebten, nach mehreren Jahren mit anhaltenden Zeiten großer Dürre, die die Armut des größten Teils der Bevölkerung noch verstärkten, die alten Traditionen überwunden und einen Aufstand gewagt. Der war wie ein Leuchtfeuer von einem Gebiet in das andere vorgedrungen. Daraufhin hatten die Menschen sich überall erhoben, sich auf ihre eigenen Fähigkeiten besonnen. Forderten mutig, neue Gedanken zu wagen und die Verantwortung auf viel mehr Schultern zu verteilen. Mit neuen und traditionellen Wegen war es ihnen gelungen, die Lebensgrundlagen der ganzen Region innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu verbessern. Der Lebensstandard und das kulturelle Schaffen erlebte in weiten Teilen eine neue Blütezeit. Dann kamen die Katastrophen weit oben im Norden. Doch sie erschütterten die ganze Welt. Probleme, die die Menschen längst überwunden glaubten, tauchten wieder auf. Die Versorgung und die Möglichkeiten der damaligen Welt brachen zusammen.
Großmutter hatte ihm erzählt, dass die schwerwiegendste Folge der Katastrophenzeit die große Wasserknappheit war, die nun überall auf der Erde herrschte. Und Völker, die nicht wie seine Vorfahren schon immer in der Wüste, sondern im Überfluss grüner Länder gelebt hatten, starben in ihrem zerstörten Lebensraum, wenn sie ihn nicht verließen. In manchen Ländern wurden riesige Städte aufgegeben, weil die Flüsse immer weniger oder verseuchtes Wasser führten und die großen Regenfälle ausblieben, riesige Gebiete verdorrten. Der Norden verlor seine Wälder und damit seine Wasserspeicher und die fruchtbaren Ebenen. Die Bevölkerung, die klug genug war, die Unwiederbringlichkeit der Zeit vor dem Wandel zu erkennen, wanderte von dort aus nach Süden.
Großmutter hatte gesagt: „Stell dir vor Junge, noch hundert Jahre zuvor wanderten die Menschen unserer Gebiete nach Norden, weil dort ein Leben im Überfluss herrschte. Aber nach den zehn Dürreperioden in ihrem Land wollten diese Nordleute hierher. Denn unsere Gebiete waren ja kurze Zeit zuvor zu neuem, selbstbewussten Leben erwacht. Doch auch hier hatte sich das Wetter und damit vieles andere verändert. Die alten Energiequellen versiegten rascher als erwartet. Es dauerte nicht lange und der Einfluss der einwandernden Völker veränderte unsere Region abermals. Die großen Kriege um die Meeresstädte begannen, vieles wurde zerstört und nur sehr, sehr wenige helle Menschen blieben übrig.
Das Beste, was in dieser Zeit geschah, war die Vermischung und Neuordnung der Völker. Vorher haben sich die Menschen auch wegen ihrer Hautfarben bekämpft. Seit der Vermischung der Völker gab es das so nicht mehr. Na ja, fast nicht mehr. Und etwas anderes Wunderbares kam mit der Völkerwanderung aus dem Norden: Der erneute Aufschwung der Literatur in unserem Teil der Erde. Der erste Wohlstand nach den Kämpfen um die Meeresstädte brachte eine große Zeit der Kultur zurück.“
Sie erzählte ihm von der Geschichte seines Volkes, der Schönheit der Poesie und der Tatsache, dass sie noch viele Bücher in ihrer Kindheit hätte lesen können, in denen Geschichten von vielen Völkern standen oder wunderschöne Gedichte und Lieder abgedruckt waren. Und meist traurig seufzend endete sie mit den Worten: „Leider, leider hat man dies heute schon beinahe wieder vergessen. Als die Meeresstädter erneut anfingen, sich gegenseitig zu bekriegen, vergaßen die Menschen die schönen Dinge, wie die Literatur, wieder sehr schnell. Diese Techniker brauchten Rohstoffe und technisches Wissen. Mit ihren Maschinen haben sie die Städte zu lauten, plärrenden Orten gemacht, in denen nicht mehr viel gelesen wird. Und Nomaden haben seit jeher wenig Bücher. Da wir die Städte und ihre Technologien seit jenen Entwicklungen wieder meiden, ist uns der Zugang zu den übrig gebliebenen Büchern stark erschwert. Ich weiß nicht, ob es in den Städten noch jemanden gibt, der ihren Wert heute noch schätzt.“
Mit solchen Erzählungen hatte sie den Kindern Verständnis für ihr Leben und die Vergangenheit ihres Volkes beigebracht.
Am schönsten fand Karas, wenn sie ihm abends alte Gedichte vortrug. Seine Großmutter besaß sogar ein paar Abschriften von Büchern aus dieser Zeit und weil Karas immer wieder darum bat, holte sie bald jeden zweiten Abend ihre Schätze hervor. Diese hütete sie als ihren wertvollsten Besitz und mit ihnen lehrte sie ihren Enkel die unnütze Kunst des Lesens.
Die anderen Mitglieder seiner Familie hielten nicht ganz so viel von diesem seltsamen Zeitvertreib. Uralter Kram, den niemand mehr brauchte.
Karas aber liebte es, mit den Büchern seiner Großmutter in ferne Zeiten einzutauchen. In ihm erwuchs damals eine tiefe Sehnsucht, die Grenzen seiner Welt zu überschreiten.
Diese Freie erinnerte ihn seltsamerweise an seine Großmutter. Diese großen wachen Augen, die mehr gesehen zu haben schienen.
Von ihren Erzählungen und den Reden auf den Clantreffen wusste er, dass helle Menschen als sonderbar oder exotisch galten und als äußerst kostbar.
Bis heute hatte Karas selbst noch nie einen hellen Menschen gesehen, doch ihm war klar, dass sie auf dem Markt der Karais sehr, sehr viel für dieses helle Mädchen eintauschen konnten.
Für die Hathai kam das nicht in Frage und Karas war immer stolz darauf gewesen, dass sie nicht zu den Menschenhändlern gehörten. Es gab nur wenige Regeln, die nie von den Hathai verletzt wurden, dazu gehörte die Gastfreundschaft. Sie war hier draußen, am Rande der Wüste, unantastbar. Aus diesen Gründen war nicht daran zu denken, diese Freie auf den Markt zu bringen. Außerdem war da etwas, etwas in ihren seltsam hellen Augen, die ihn so herausfordernd ansahen, etwas, das Karas so verwirrte und seinen Verstand beinahe lahm legte.
Der Morgen begann bereits am Horizont emporzukriechen, als er endlich ruhiger wurde und mit einem Gemisch aus seinen Erinnerungen und Gedanken einschlief. So verpasste er den Zeitpunkt, an dem Shana das Zelt verließ, um an die Quelle zu gehen und danach ihren Teil zum Leben im Lager beizutragen.
Shana hatte bei ihrem Erwachen beschlossen, Handar zu fragen, ob es ihr irgendwie möglich wäre, sich so bei ihm verdient zu machen, dass sie ein Pferd bekommen könne. Sie wusste, dass ihre Kenntnisse der Heilkunst von den Hathai sehr geschätzt wurden. Yambi hatte ihr öfters erzählt, die Hathai würden die Freien wegen dieses Heilwissens schätzen. Wenn Shana nun Werra lehrte, welche Pflanzen und Dinge des Sandlandes nützlich für die Heilkunst waren, könnte sie den Hathai einen Gegenwert für ein Pferd bieten und dann …
Aber Handar brach an diesem Morgen mit einigen anderen Männern sehr früh auf und Shana bekam keine Gelegenheit, mit ihm über ihren Plan zu reden.
Die Männer wollten zu einer der Meeresstädte. Das war jedenfalls das, was Shana verstanden hatte. Shana begriff nicht warum, keiner redete weiter darüber und so kam es ihr nicht in den Sinn, danach zu fragen. Sie half einfach, wie schon an den vorhergehenden Tagen, Kari und Werra.
Diesmal war Ra'un mit den Männern geritten. Karas lag noch schnarchend im Schatten des Zeltes, als der Staub der Reiter bereits nicht mehr am Horizont zu sehen war. Niemand schien sich an seiner Faulheit zu stören.