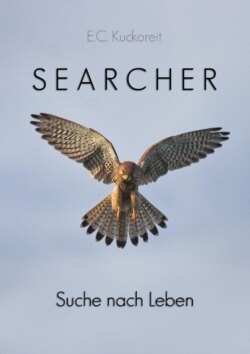Читать книгу Searcher - E.C. Kuckoreit - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Begegnung
ОглавлениеNach vier Tagen begegnete sie ihm.
Gerade als sie beschloss, von nun an nur noch zurückzugehen, erregte eine wehende Staubfahne am oberen Teil der großen Düne ihre Aufmerksamkeit. Instinktiv kauerte sie sich so nah wie möglich auf den Boden und beobachtete die Szene.
Ein einsamer Reiter preschte den Dünenhang herunter, als ob der Teufel hinter ihm her sei. Er schien die Gefahrenstelle der Düne genau zu kennen, denn er ritt trotz des Tempos sehr geschickt um sie herum. In der Talsenke zügelte er sein Pferd und sprang ab, dabei gab er dem Tier einen leichten Schlag auf die Flanke, so dass es in westlicher Richtung davonlief. Sich selbst warf er flach auf den Boden und bedeckte sich mit einer großen, sandfarbenen Decke. Nun war er nicht mehr wirklich zu erkennen.
Während sie sein Tun weiter beobachtete, zog Shana ihren Umhang und den Gesichtsschleier fest zu, folgte seinem Beispiel und presste ihren Körper flach auf den Boden. Ihren Kopf hielt sie weiterhin ganz leicht angehoben und spähte in die Richtung, aus der der Reiter gekommen war. Dann sah sie erschaudernd die eigentliche Gefahr. Die Gefahr, vor der wohl auch der Reiter floh.
Männer mit einer dunklen Fahrmaschine, größer als ein Kamel, erschienen am oberen Rand der Düne. Sie hielten an und verließen das Fahrzeug. Mit mehreren Waffen behangen, trugen sie auch noch eine merkwürdige Kleidung. Das mussten Sklavenjäger sein.
Unbeweglich blieb Shana liegen, alle Stoßgebete Yambis schossen ihr durch den Kopf. Wäre sie nicht durch das Verhalten des Reiters gewarnt und jetzt noch aufrecht gewesen, wäre es um sie geschehen.
Die Sklavenjäger schienen vollkommen auf ihre ausgewählte Beute fixiert zu sein. Sie hatten ihn zwar aus den Augen verloren, aber seine Richtung gut eingeschätzt. Einer von ihnen wollte der Pferdespur folgen, rutschte aus, schlitterte haltlos die Düne herab. Er geriet in den Treibsand. Nach den stürmischen Winden der letzten Tage war dieser ohnehin gefährliche Boden zu einer tödlichen Gefahr geworden. Sein Gefährte beobachtete den Fehltritt. Er schien die Lage richtig einzuschätzen, denn er versuchte nicht einmal zu helfen. Stattdessen drehte er sich um, warf einen langen, dunklen Gegenstand in das Fahrzeug und stieg selbst wieder hinein. Er ließ den Motor aufheulen. Das Geräusch dröhnte bis in Shanas Ohren. Doch er fuhr nicht vorwärts, sondern ließ das Fahrzeug rückwärts rollen und war verschwunden.
Shana bewegte sich trotzdem nicht, genauso verhielt sich der unbekannte Reiter. Beide blieben reglos unter ihrer Tarnung. Vielleicht versuchte der Sklavenjäger sein Opfer zu täuschen und tauchte unvermutet wieder auf. Lange harrte Shana wie erstarrt aus. Dann sah sie das Pferd zurückkehren. Von den Sklavenjägern aber war keine Spur mehr zu sehen, weder von dem Mann im Treibsand noch von dem Fahrer. Zögernd richtete sie sich wieder auf und wartete hockend, für eine kurze Dauer, bevor sie den Abstieg wagte. Mit ruhigen, bedachten Schritten tastete sie sich in die Nähe der Stelle, wo sie den Reiter noch immer vermutete. Der leichte Wind hatte hier in der Talsenke den Mann mit einer dünnen Schicht Sand bedeckt und gänzlich unsichtbar werden lassen. Tatsächlich stieß sie auf ihn, bevor sein Pferd zwei Pferdelängen von ihm entfernt stehen blieb. Erst jetzt hob er den Kopf.
Im Gegensatz zu den Sklavenjägern war er schon von seiner Kleidung her ein Angehöriger des Wüstenvolkes. Er gehörte zum Stamm der Hathai. Die vielen Lagen seiner Gewänder und die Art wie er seinen Kopfschleier gebunden hatte, waren in dieser Beziehung eindeutig. Yambi hatte Shana die feinen Unterscheidungsmerkmale der Wüstenstämme erklärt.
Sie begrüßten einander mit dem gebührenden Respekt, wissend, dass sie nichts voneinander zu befürchten hatten. Shana verneigte sich mit ihrem ganzen Oberkörper und sagte deutlich: „Meinen Gruß – Fremder.“
Der Hathai hob dagegen die Hand bis zum Herz und dann zur Stirn: „Sei gegrüßt, Searcher.“
Wie Shana rasch bemerkte, unterschied sich der Dialekt ihrer Sippe anscheinend nur wenig von der Hathaisprache, so dass sie sich mit ein wenig Mühe verständigen konnten. Sorgfältig und langsam formulierte sie ihre Frage: „Wer waren deine Verfolger?“
Der Hathai starrte zum Treibsand hinüber und sagte: „Ortsunkundige!“, wobei sein Blick auf den ruhigen Treibsand fiel. Sie hörte, dass er bei den nachfolgenden Worten grinste: „Sonst hätten sie mich längst erwischt.“
„Sklavenjäger aus dem Osten?“
„Ja und sie haben mich heute Morgen zu ihrer Beute erklärt.“
„Respekt! Nur wenige schaffen es so lange, nicht erlegt zu werden.“
„Dir meinen Respekt, Searcher. Du scheinst sehr jung zu sein und ich habe gesehen, dass du sehr erfahren bist.“
Er ließ seinen Blick über die Dünen und den Horizont schweifen: „Die Nacht kommt. Willst du noch weiter?“
Shana folgte mit den Augen seinem Blick und meinte, es würde sich nicht mehr lohnen. Es war die Zeit kurz nach Neumond und damit viel zu dunkel, um bei Nacht sinnvoll unterwegs zu sein. Der Fremde schien dies ebenso zu sehen. Bei aller Vorsicht, die geboten war, fühlte sie sich von ihm nicht bedroht. Dabei wusste sie genau, wie leichtsinnig eine solche Haltung sein konnte. Denn, traf man jemanden hier draußen, so war es nie klar, ob man eine Nacht in seiner Nähe verbringen konnte, ohne befürchten zu müssen, am nächsten Morgen ausgeraubt oder gar tot zu sein. Daher mieden Searcher selbst solche Begegnungen.
Jedoch diesmal war etwas anders. Dieser Hathai war allem Anschein nach allein unterwegs. Ein merkwürdiger Umstand. Bevor sie sich von ihm entfernte und ihm damit den Rücken zukehren oder gar trauen konnte, wollte sie den Grund für sein alleiniges Auftauchen erfahren. Wenn er sie töten wollte, hätte er es wahrscheinlich schon getan. Er konnte es allein auf ihr Wasser abgesehen haben, denn an die Sklavenjäger würde er sie bestimmt nicht ausliefern. Für diese Annahme hatte sie zwei Gründe. Erstens war sie vor den Hathai stets gewarnt worden - es hieß, sie seien plündernde Horden, aber ihnen ging auch der Ruf voran, Feinde der Menschenhändler zu sein – und zweitens war dieser hier selbst verfolgt worden.
„Ich will weder dein Wasser, noch dein Leben“, sagte er, als habe sie ihre Gedanken laut ausgesprochen.
„Was willst du dann?“, gab sie zurück.
„Nun, diese Sklavenjäger haben mir eine Richtung aufgezwungen, die ich nicht vorhatte. Von der Gefährlichkeit der großen Sifadüne wird an unseren Lagerfeuern immer wieder erzählt und ich erkenne Treibsand, wenn ich ihn suche. Als ich die Dünen vor mir sah, dachte ich, es sei einen Versuch wert. Aber ich weiß nicht genug von dieser Gegend. Ich weiß nicht genau, ob die Dünen eher westlich oder östlich von Rmadar liegen, nur dass sie weiter nördlich sind. Kannst du mir sagen, in welche Richtung ich mich halten muss? Für heute Nacht bleibe ich allerdings gerne in deiner Gesellschaft und teile meine Vorräte und mein Wasser mit dir.“
Sie blickte ihm prüfend in die Augen. Er hielt dem Blick stand und sagte: „Mein Name ist Handar.“
Ihr Kopf sank verlegen nach vorne und sie schüttelte ihn leicht: „Verzeih mein Misstrauen. Man begegnet nur selten einem einzelnen Reiter. Würdest du allerdings etwas Übles vorhaben, so könnte ich es wahrscheinlich sowieso nicht mehr verhindern. Ich nehme deine Einladung an. Mich ruft man Shana.“
„Shana?“, der Hathai gab sich nicht einmal die Mühe, seine Verblüffung zu verbergen, „Du bist eine Frau!“
Searcher kleideten sich zweckmäßig für die Wanderungen und das Überleben in der Wüste. Sie trugen einheitliche Gewänder, die dem Stil der übrigen männlichen Wüstenbewohner ähnelten, doch diesem Hathai schien das nicht geläufig zu sein.
„Verzeih! Darf ich dir meinen Schutz anbieten?“
„Nein“, lachte sie und fuhr mit ernsthafterer Stimme fort, „und es gibt auch nichts zu verzeihen. Du bist noch nicht vielen Searchern begegnet?“
Nun war es an Handar zu lachen: „Wohl wahr. Ich dachte, Searcher sind ein Mythos. Nur weil du mir vollkommen unbekannt erschienst und ganz offensichtlich nicht zu den Karais zählst, allein und ohne Reittier unterwegs bist, keinerlei Waffen, stattdessen aber gleich zwei Wassersäcke geschultert trägst, habe ich auf deinen Stand geschlossen. Es ist mir eine große Ehre, dir zu begegnen.“
Sie hatte darauf keine Antwort.
Nachdem sie sich auf diese Weise ein wenig bekannt gemacht hatten, suchten sie sich gemeinsam einen Platz, an dem die Düne sich bog und sie von dem aufkommenden Ostwind abschirmte. Obwohl die Nacht hier draußen sehr kalt werden würde, beschlossen sie, kein Feuer zu machen. Die Gefahr eventuell doch weitere, suchende Sklavenhändler auf sich aufmerksam zu machen, erschien ihnen einfach zu groß.
Es entstand ein sonderbares Vertrauensverhältnis zwischen ihnen. Shana beschloss, zum ersten Mal entgegen Yambis Warnungen zu handeln. Nachdem sie mit diesem Fremden geredet hatte, konnte sie auch einige Zeit mit ihm zusammen verbringen. Was geschehen sollte, würde geschehen!
Gebannt hörte sie an diesem Abend seiner Geschichte zu.
„Ich bin vor drei Tagen mit zwei Gefährten aufgebrochen. Wir wollten Getreide besorgen. Das gehört zu den Dingen, die es in unserer Oase nicht gibt. Also beschlossen wir, in Richtung Rmadar zu ziehen, ein friedliches Arkanistädtchen in genau der richtigen Entfernung zu unserem Lager.“
„Du gehörst zu dem Hathailager östlich vor dem großen Sandland?“
„Sandland? Ach ja, ihr Freien nennt die große Sandwüste des Westens so. Ja, dort lebt mein Clan“, nickte er. Dann fuhr er fort: „Wir begegneten schon nach einem Tag einer Karawane, die uns Getreide abgab. Meine Begleiter hatten damit, was sie wollten. Das Lager wartet auf die Vorräte, deshalb sind sie zurückgeritten. Ich will aber noch auf den Pferdemarkt von Rmadar, dort soll ein Tier aus einer mir bekannten Zucht zum Verkauf angeboten werden, auf das ich schon lange ein Auge geworfen habe. Also trennten wir uns heute Morgen. Aber ich war nicht vorsichtig genug. Als ich die Staubfahne gesehen habe, war es fast schon zu spät. Die Fahrzeuge der Sklavenhändler sind schneller als alle Reittiere. Leider ähneln ihre Staubfahnen denen einer großen Schar galoppierender Reiter. Als ich sie erkannte, kamen sie schon in meine Richtung. Ich habe meinen Weg verlassen und bin einfach geradewegs in das Dünengebiet geritten, in der Hoffnung, mich dort vor meinen Verfolgern verstecken zu können. Dabei musste ich viele kleine Täler hinter mich bringen, bis ich sicher war, dass der Abstand zu den Fahrmaschinen und die Höhe der Düne ausreichen würde, um Zeit genug zu finden, mich unsichtbar zu machen. Den Rest der Geschichte kennst du.“
„Warum jagen sie Hathai?“
„Sie gehören zu dem Volk, das an den Küsten des Meeres lebt. Ihnen fehlen die traditionellen Kenntnisse zum Überleben in der Wüste. Sie können trotz ihrer Maschinen und Techniken nicht genug Wasser finden, um sich in der Wüste sicher zu bewegen. Ich will mich nicht mit euch Searchern messen, aber die Hathai überleben auch seit Jahrhunderten in dieser Wüste. Es sind unsere Fähigkeiten zu überleben, die für sie interessant sind.“
„Yambi sagt, ich sei zu hell für die Welt und müsse jeden Fremden meiden. Warum genau, hat sie mir nie verraten. Sie sagte, ich würde nicht mehr ruhig schlafen können, wenn ich die Gefahr zu genau kenne.“
„Wohl wahr! Die Frau tut recht daran, dich vor solchen Dingen bewahren zu wollen. Aber vielleicht ist es nun, da du der Gefahr so nah kommst, wirklich besser für dich, zu wissen, worum es geht. Diese Leute wollen dich versklaven.“
„Was heißt 'versklaven'?“
„Sie nehmen dir deine Freiheit. Du musst tun, was dir jemand anderes sagt und kannst nie selbst entscheiden, was du tun willst. Du kannst auch nicht entscheiden, wohin du gehst. Es heißt, dass dein Herr mit dir machen kann, was er will, wann er will, wo er will und wenn er dein Leben will, dann nimmt er es sich.“
„Sind sie Götter?“
„Nein, eher das Gegenteil.“
Shana erbleichte. Sie schluckte gegen das erstickende Gefühl an, welches in ihrem Hals entstand. Sie hatte zu wenige Kenntnisse über das Leben jenseits ihrer eigenen Erfahrungen. Yambi hatte wohl Recht gehabt: Sklaverei war schlimmer als tot sein. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, fragte sie den Hathai nach seinem Pferd. Sie wies mit dem Kopf auf das Tier und fragte: „Sind diese Tiere alle so groß?“
Handar lächelte: „Nein, einige sind noch größer. Meine Stute aber ist das klügste und treueste Tier, das je in der Zucht meiner Väter gelebt hat. Ich würde sie nicht gegen ein schnelleres oder größeres Tier tauschen.“
„Aber du willst doch auf dem Markt tauschen.“
„Nein, nein! Ich will nicht tauschen. Ich will einen Hengst für sie kaufen. Feela gäbe ich niemals her. Sie soll Fohlen haben, die für meine Kinder und Enkel den Augapfel ihrer Herden bilden werden.“
Handar schien so viel zu wissen, viel mehr als Yambi. Alles, was sie selbst wusste, wusste sie von ihrem Vater und Yambi. Sie kannte die Zeichen der Wüste und des Wassers, des Windes und der Sonne, des Sandes und der Savanne, aber sie wusste nichts über Pferdeherden oder Städte. Sie stellte Handar noch viele Fragen und er gab ihr bereitwillig Antwort. Wahrscheinlich, weil er erkannt hatte, dass sie niemals eine Gefahr für ihn und die seinen sein würde.
Als die Nacht vorüber war, zeigte sie Handar die Punkte in der Landschaft, an denen er sich orientieren musste, um schnell nach Rmadar zu kommen. Da sein Weg fast an ihrer Hütte vorbeigehen würde und sie dorthin zurück musste, weil ihre Vorräte knapp geworden waren, beschlossen sie, einen Teil der langen Strecke gemeinsam zu ziehen.
Einen halben Tagesmarsch von der Hütte entfernt trennten sie sich. Alles andere wäre Shana zu leichtsinnig vorgekommen. Soweit durfte man Fremden nicht trauen. Auch nicht, wenn man sie seit mehreren Nächten kannte.
Nachdem sie sich verabschiedet hatten, wartete sie, bis sie Handar nur noch als kleinen Punkt am Horizont sah. Dann schlug sie den Weg nach Hause ein. Es dauerte nicht lange, da stand sie vor der Senke mit der kleinen Ebene auf der ihre Grasmattenhütte stand oder besser gestanden hatte.