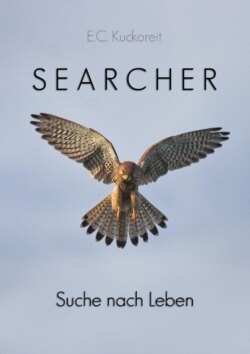Читать книгу Searcher - E.C. Kuckoreit - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pferde
ОглавлениеAls Karas am späten Tag erwachte, war er schlecht gelaunt, räkelte und streckte sich ächzend und langsam, bis er einen riesigen Krug Wasser leerte und sich mit Brot vollstopfte, das Werra ihm serviert hatte. Dann verließ er wortlos das Zelt, schritt aufrecht und stolz zu den Bäumen in Quellnähe, anscheinend nur, um sich im Schatten wieder ungestört niederzulassen. Ab da lag er halb sitzend an einen Baum gelehnt und beobachtete Shana bei jedem Schritt. Es war augenscheinlich. Sie spürte es, auch wenn sie nicht darauf achtete. Es war ihr so unangenehm, dass sie sich gar nicht auf ihre eigentlichen Tätigkeiten konzentrieren konnte. Erst als Kari, die alles genau registrierte, ihm zurief, er solle sich um die Pferde kümmern, verließ Karas grummelnd seinen Beobachtungsposten. Zögerlich stand er auf. Ging ein paar Schritte in Richtung der grasenden Tiere, aber ohne dabei den Blick von Shana zu wenden. Stolperte, stoppte und drehte um.
Nun kam er direkt auf Shana zu und fragte, ob sie ihm Gesellschaft leisten würde. Das heißt, in Wirklichkeit stammelte er etwas Unverständliches zu ihr. Es sollte wohl wie „Kommst du mit, ich zeige dir unsere Pferde?“ klingen, aber hörte sich viel barscher an, eher ein geknurrtes „Komm!“
Kari nickte Shana, die sich verständnislos umsah, aufmunternd zu. Lachend ergänzte sie: „Wenn du nicht mitgehst, wird er wahrscheinlich heute vorne und hinten bei den Pferden nicht unterscheiden können. Außerdem weiß ich, dass du gerne reiten lernen würdest.“
Shana starrte sie daraufhin verblüfft an: „Woher...?“
„Ich das weiß?“, Kari schmunzelte nur und ergänzte ihre Behauptung: „Sonst gäbe es doch wohl keinen Grund für dich, seit Tagen um die Pferde herumzulaufen und jeden Reiter genau zu beobachten. Karas könnte es mit ein wenig Aufmunterung vielleicht schaffen, dir zu zeigen, wie man reitet. Er ist einer der besten und schnellsten Reiter unseres Clans. Wenn er auch gerade scheinbar kaum vernünftig gehen kann, reiten kann er wohl noch!“
Kari war kaum mit ihrer Rede fertig, da griff er schon fest nach ihrer Hand und zog sie mit sich zum Pferch. Mit selbstsicherer Haltung schritt er aus, so dass dieses Mal Shana ins Stolpern kam, was ihn gänzlich unberührt ließ.
Erst vor dem kräftigen braunschwarzen Tier, auf dem er gestern geritten kam, blieb er stehen und ließ Shanas Hand los. Das Pferd begrüßte ihn, als habe es den ganzen Tag darauf gewartet, endlich seinen Kopf anstupsen zu können. Er war von einem Moment zum anderen mit seiner ganzen Aufmerksamkeit bei dem Tier. Alle Unsicherheit, die er in der Unterhaltung mit Shana gezeigt hatte, fiel von ihm ab.
„Leila, meine Liebste“, säuselte seine Stimme klar, melodiös und weich. Es klang wie ein Liebeslied. Kribbelte unter der Haut.
Während er das herrliche Fell mit einer Hand streichelte, löste er mit der anderen schnell und geschickt den Riemen von ihren Vorderbeinen. Über Nacht waren einige der Tiere so gefesselt, dass sie sich langsam und in kleinen Schritten bewegen, aber nicht davonpreschen konnten, wenn sie erschreckt wurden oder ihnen einfach der Sinn danach stand. Die Hathai pflegten solche Fesseln ihren Pferden nach langen Ritten anzulegen, weil sie glaubten, dass die Pferde sich sonst, aus der Gewohnheit der vergangenen Tage, zu weit vom Lager entfernen würden.
Shana bewunderte das große muskulöse Tier aus gehörigem Abstand. Die Stute war kräftiger als Handars Pferd, hatte aber einen kleinen zierlichen Kopf. Sie schien sehr temperamentvoll zu sein, bewegte sich rasch und beäugte Shana von allen Seiten. Leise, um sie ja nicht zu erschrecken, traute sich Shana nach einer Weile zu fragen: „Darf ich sie streicheln?“
„Wenn sie dich lässt. Komm her!“, kam die Antwort sehr schnell, sanft und ohne jedes Stottern zurück.
Und Leila ließ sich streicheln. Karas beobachtete sie verwundert. Mit lächelnden Augen stellte er fest: „Sie mag dich.“
Seine Stimme klang jetzt eher brummig, aber seine Augen schienen hinzuzufügen: ebenso wie ich.
Plötzlich riss Leila den Kopf heftig empor, so dass Shana erschrocken zurückwich und gegen Karas fiel. Der fing sie schnell und geschickt auf und hielt sie länger fest, als wirklich nötig. So nah vor ihm, musste sie ihren Kopf in den Nacken legen, um ihm in die Augen sehen zu können. Augen, die sie verschlingen wollten. Sie spürte seine gezügelte Kraft, die Sicherheit seiner Bewegungen ...
Wie lange sie so zwischen den Pferden standen und dabei vergaßen, was sie dort eigentlich wollten, hätten sie nicht sagen können. Erst als sich eine andere Stute zu Leila drängen wollte und sie zur Seite schob, begannen sie sich wieder vom Fleck zu bewegen. Rasch überprüfte Karas nun, ob es Leila und den übrigen Pferden an etwas mangelte. Ohne lange zu überlegen oder zu fragen, half Shana ihm mit den richtigen Handgriffen, so dass er nachher leicht ungläubig fragte: „Du hast vorher nie mit Pferden zu tun gehabt?“
„Nicht wirklich”, antwortete sie. Den Ritt auf Handars Feela rechnete sie nicht, da sie damals kaum etwas bewusst wahrgenommen hatte. Ihre Stimme war sogar für sie selbst überraschend fest und es schwang freudige Erregung darin, als sie sagte: „Aber sie sind herrlich. So herrlich, dass ich gerne reiten lernen würde.“
„Okay“, gab Karas knapp zurück. „Vorher musst du einige Dinge über die Tiere wissen.“
Er führte sie an den Rand des Pferches. Dort setzten sie sich und er erklärte, langsam und ruhig, wie die einzelnen Körperteile eines Pferdes bezeichnet wurden und wie sie im besten Falle auszusehen hatten. Während er sprach, breitete sich eine angenehme Vertrautheit zwischen ihnen aus, dann aber sprach er zunehmend stockender. Schließlich hielt er immer wieder inne, sah sie kurz und stumm musternd an. Ihre unbefangene Art sich zu bewegen, ihre ungewöhnlichen, hell strahlenden Haare, die er so gerne berührt hätte und die unter dem einfachen Frauenschleier äußerst nachlässig verborgen waren, alles an ihr faszinierte, verwirrte ihn.
„Was wird sie tun, wenn ich sie einfach in den Arm nehme und ihr Gesicht küsse?“, dachte er, während er versuchte, sie nicht unentwegt anzustarren. Wellen der Erregung jagten durch seinen Körper. Der traditionelle Gesichtsschleier verbarg zwar nicht alle seine Empfindungen, doch bot er ihm einen angenehmen Schutz. Gegen seine aufgewühlten Gefühle ankämpfend, versuchte er sich zu sammeln und sprach leise weiter über Pferde mit ihr.
Irgendwann aber stockte er, fixierte ihre Augen. Im nächsten Augenblick ließ er sich von seinen Impulsen überwältigen, dachte nicht weiter über sein Tun nach, fasste sie an den Schultern und drückte sie sanft auf den weichen Boden nieder. Shana wehrte ihn instinktiv sehr heftig ab. Heftiger, als sie es selbst beabsichtigte, schlug sie auf ihn ein. Ihr Puls raste, sie rang nach Atem. Ernüchtert setzte er sich auf und stammelte: „Was hast du?“
Die Frage kam ihr nur noch seltsamer vor und barsch fuhr sie ihn an: „Was tust du? Wie kommst du dazu, mich zu packen? Du, du ...“ mit diesen gestammelten Worten sprang sie auf, drehte sich um und rannte zurück zum Zelt.
Karas schüttelte langsam seinen Kopf, als wolle er sich von einem festen Schlag erholen. Mit dieser Reaktion hatte er nicht gerechnet. Er hätte nicht sagen können, was ihm die Kühnheit gegeben hatte. Ihm war klar, dass er versucht hatte, sie zu küssen. Seufzend schloss er die Augen und dachte: „Ärger. Das bedeutet Ärger.“
Shana schlüpfte derweil hastig ins Zelt und warf sich in ihre Ecke. Sie wusste nicht, warum sie schluchzte, aber es war, als wolle aller Schmerz, den sie bei dem Anblick des zerstörten Lagers und der zerstreuten Sachen ihrer Familie empfunden hatte, ausgerechnet jetzt aus ihr herausbrechen.
An jenem Tag war sie, nachdem sie sich von Handar getrennt hatte, zur ihrer Hütte gegangen. Aus großer Entfernung bemerkte sie schon, dass etwas nicht stimmte.
Was dort geschehen war, konnte sie nur vermuten. Die Hütte musste überfallen worden sein. Wie, war nicht klar. Nur eines war sicher: Yambi und die Kinder waren verschwunden.
Damals war sie nicht in der Lage gewesen, ihrem Schmerz über das Vorgefundene Ausdruck zu geben. Stumm und ausgetrocknet, panisch die Leere in ihrem Leben spürend, war ihr keine Zeit geblieben, sich einen genaueren Überblick zu verschaffen, denn eine Staubwolke am Horizont hatte sie sofort wieder zur Flucht auf die nächstgelegene Erhebung getrieben. Von dort aus hatte sie schockiert beobachtet, wie Stadtmenschen mit Fahrmaschinen zur Hütte kamen und die Überreste durchsuchten. Für die Fremden war anscheinend klar, dass hier eine Sippe des freien Volkes gelebt hatte und diese Beute nicht wiederkehren würde. Sie fuhren nach ergebnisloser Suche einfach wieder davon.
Aber Shana traute sich nicht mehr zurück. Stattdessen versuchte sie, in einem weiträumigen Bogen um die Hütte Spuren zu finden, die ihr erzählten, wohin Yambi, deren Tochter und ihre eigenen Brüder verschwunden waren.
In ihrem Schmerz über den Verlust hatte sie aufgehört, wirklich auf sich selbst zu achten. Der Durst raubte ihr bald den Verstand. Sie riss den Gesichtsschleier ab, stolperte orientierungslos durch den Sand, ihre Haut verbrannte und platzte auf, ihre Sicht war getrübt. Nach einem weiteren Tag des Herumirrens war sie völlig erschöpft und halb verdurstet von Handar, der auf seinem Rückweg von Rmadar wieder in der Gegend vorbeigekommen war, aufgefunden worden. Er nahm sich ihrer an.
Sie erwachte am nächsten Morgen von dem knarrenden Geräusch, das ein Sattel von sich gibt, wenn man ihn aufhebt. Sogleich begann sie zu frösteln. Vorsichtig blinzelte sie durch die verquollenen, fast geschlossenen Augenlider. Eine ganz feine, gleißend helle Linie am Horizont verriet ihr, dass der Tag noch sehr jung war. Der Hathai bewegte sich, trotz seiner mehrlagigen Gewänder und seiner Waffen, lautlos neben seinem Tier.
Wie sicher und sanft er es mit der Hand berührte, über den Rist strich und die Decke glättete, um dann mit einem Schwung und kontrollierter Kraft den schweren Sattel aufzulegen. Das Tier bewegte sich nicht und der Hathai senkte seine Stirn gegen den Hals des Pferdes. Nur einen Moment hielt diese Innigkeit, doch die Geste barg einen Hauch von Ewigkeit.
Shana richtete sich auf. Der Hathai fuhr herum. Seine Augen blitzten zwischen seinem Gesichtsschleier hervor. Sie fühlte sich bis auf die Haut durchschaut und zog instinktiv die Decke enger um sich und senkte den Kopf.
Er sah sie unverwandt an und sie hätte schwören können, dass er unter den vielen Lagen Stoff, die sein Gesicht verbargen, grinste, bevor er fragte: „Kommst du weiter mit mir?“
„Wenn dein Weg zum Wasser führt!“
Er nickte wortlos und griff nach dem Führungsseil seines Pferdes. Dann schritt er aus. Shana folgte ihm. Ein paar Schritte, dann gaben ihre Knie nach. Handar nahm sie auf, setzte sie vorsichtig auf sein Pferd und band sie sicherheitshalber am Sattel fest. Drei Tage waren sie gemeinsam unterwegs. Tagsüber schwiegen sie. Er führte sie täglich weiter nach Osten durch die schattenlose Einöde, bis die Sonne fast den Zenit erreichte. Dann errichtete er aus seiner Schärpe eine Art Zelt und sie verkrochen sich unter der breiten Bahn Stoff, um nicht in der stärksten Hitze durch ihre Bewegung noch unnötig Kraft zu verlieren.
Sie war zu geschwächt und er konnte ihr hier draußen nur wenig helfen.
Genauso ausgetrocknet, zerschunden und zerrissen wie ihre Lippen und ihre Haut hatte sich damals ihre Seele angefühlt. Aber erst jetzt weinte sie, als seien Dämme in ihrem Inneren gebrochen.
Kari, die sie zum ersten Mal im wachen Zustand so fassungslos vorfand, aber außer dem hemmungslosen Schluchzen keine Information aus ihr locken konnte, stellte mit unverhohlener Wut ihren Sohn zur Rede, als dieser sich dem Zelt näherte.
Das war kein Nachfragen, vielmehr eine Flut von Vorwürfen: „Was hast du getan? Geh rein, sieh dir das an! Habe ich dich nicht gelehrt, jeden Menschen mit Respekt zu behandeln? Musstest du dich wie ein Vieh verhalten?“
Für Kari schien fest zu stehen, dass er Schuld an dem haltlosen Schluchzen Shanas hatte. Sie wütete mit jeder Geste gegen ihn.
Er erwiderte nichts, sondern stand nur da und blickte betroffen auf das zuckende menschliche Bündel in der Ecke. Schließlich schlug seine Mutter ihm mit aller Kraft ins Gesicht und wandte sich Shana zu. Da ging er aus dem Zelt, steuerte mit raschen Schritten zu Leila, schwang sich auf ihren Rücken und preschte davon.
Shana konnte sich nur sehr langsam beruhigen. Sie versicherte Kari, dass Karas ihr nicht wehgetan habe. Sie wisse selbst nicht genau, was passiert sei und warum sie so außer sich gewesen war. Kari nahm sie wieder tröstend in die Arme und forderte sie auf, von ihren Erlebnissen zu erzählen: „Ich glaube, es ist Zeit, dass du die schrecklichen Bilder los wirst, die dich verfolgen! Mädchen, erzähl mir, was geschehen ist, bevor Handar dich fand. Es wird dir gut tun.“
Shana schüttelte heftig den Kopf und versuchte halbherzig Kari von sich zu schieben.
Mit leiser, krächzender Stimme antwortete sie: „Ich kann nicht.“
Gleichzeitig flammten in ihr die Bilder von der zerstörten Hütte und der schrecklichen Leere auf. Es war unmöglich zu beschreiben. Die fehlenden Spuren von Yambi und den Kindern, nicht einmal ihre Leichen hatte sie gefunden.
„Ich weiß nicht, wo sie sind“, war das Einzige, was sie klagend stammeln konnte.
Dann saßen sie da, in einer lautlosen Stille. Es dauerte und Shana gelang es mehr und mehr, die grausamen Bilder zu verdrängen. Stattdessen regten sich Gewissensbisse. Sie erinnerte sich an Karis Schlag in Karas Gesicht und jammerte: „Was habe ich nur getan? Wo ist Karas? Ich war so ungerecht! Er hat nichts Böses getan! Kari, wo ist er hin? Wie soll ich das nur erklären?“
Ihre Schuldgefühle ließen sich kaum stoppen. Sie wiederholte immer und immer wieder: „Kari, er hat nichts Böses getan. Er hat nichts Böses getan.“
„Ach, lass Kind. Der kommt wieder. Der kommt wieder, wenn er sich unschuldig fühlt“, tröstete Kari sie.
Und als Werra sah, dass Shana immer verzweifelter aussah, sagte sie: „Du musst dir keine Sorgen machen. Karas hat es doch versprochen. Er kommt immer zurück. Immer. So lange, bis ich groß bin.“
Da bemerkte Shana erst, dass sie Werra mit ihrer Angst einen echten Schrecken einjagte. Sie antwortete rasch: „Wenn das so ist, dann kommt er bestimmt!“, und nickte so aufmunternd, wie sie es eben vermochte.
Glauben konnte sie es nicht.
Tatsächlich kam Karas weder in dieser noch in der nächsten Nacht zurück. Shana wurde immer elender zumute. Sie brachte keinen Bissen herunter und alles Zureden von Kari half nicht. Ihre Augen brannten von der Anstrengung, mit der sie die ganze Zeit nach einem Zeichen seiner Rückkehr suchte. Sie verstand sich selbst nicht. Sein Gesicht, der Ausdruck seiner Augen, der ungewöhnlich tiefe Klang seiner Stimme, dies alles ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie sah ihn, wie er sie unverhohlen anstarrte; wie er strauchelte, weil er nur Augen für sie hatte; wie er liebevoll sein Pferd streichelte; hörte seine Stimme, ein warmes, wohliges Geräusch wie ein weiches, wärmendes Fell in eiskalter Nacht und fühlte wieder, wie seine Hände sie packten und sanft auf den Boden drückten. Egal was sie tat und wie sie es tat, ständig war er der Mittelpunkt ihres Denkens.
Sie ärgerte sich darüber und konnte es doch nicht verhindern. Seine Augen und sein Grinsen verfolgten sie. In ihrem Bauch krabbelten tausend Ameisen, beängstigend, lästig und aufwühlend. Jedes Hufgeräusch ließ ihr Herz schneller schlagen und sie erwischte sich, wie sie sich sofort beeilte, nur um zu erspähen, wer da ritt. Ständig fand sie einen Grund, warum sie zu den Pferden laufen konnte.
„Shana, Shana hörst du?“, ein um das andere Mal nervte Werra sie mit dieser Frage. Wie in Trance arbeitete Shana, fuhr beim kleinsten Geräusch erschrocken zusammen. Im Schlaf wälzte sie sich hin und her, aber ein angenehmerer Traum hatte ihren Albtraum verdrängt.
Sie verbrachte Zeit damit, ihre Haare zu kämmen und zu flechten, was ihr früher nie in den Sinn gekommen wäre. Am Tag darauf sah Kari sie nur seufzend an, weil sie mit zwei leeren Krügen zur Quelle gegangen war und mit einem leeren zurückkam. Daraufhin heulte sie los: „Kari, was ist das? Ich weiß nicht, was ich tue. Ich bin krank. Ich bin verrückt geworden.“
„Nicht doch, Kind. Das vergeht schon wieder, du wirst sehen.“
„Aber, aber du weißt nicht, was ich fühle“, schluchzte sie. „Mir ist schlecht, wenn ich aufstehe. Ich kann nicht essen, nicht denken. Vergesse, was ich tun wollte, während ich es tue. Ich glaub, ich muss sterben.“
„Wie kommst du denn auf diese verrückte Idee? Davon stirbt man nicht.“
„Doch Kari“, platzt sie energisch heraus. „In der Wüste stirbt man davon.“
„Kind, ich lebe auch in der Wüste und bin noch nicht tot, obwohl mein Kopf schon häufiger mit anderen Dingen beschäftigt war, als er sein sollte.“
„Das ist etwas anderes“, fuhr Shana hoch. Abrupt klang ihre Stimme sehr sachlich. Mit großem Ernst erklärte sie: „Wer Wasser sucht, stirbt, wenn er unachtsam wird.“
Dann sackte sie wieder in sich zusammen, ließ den Kopf hängen und scharrte mit ihrem Fuß unschlüssig im Sand herum. Die innere Unruhe wurde stärker und irgendwann ging ein Aufbäumen durch ihren Geist und Körper. Plötzlich wusste sie, was sie zu tun hatte. Sie richtete sich straff auf und verkündete hoch erhobenen Kopfes: „Ich bin schon viel zu lange euer Gast. Ich muss gehen.“
„Nein, nein“, jammerte Werra erschrocken auf. „Shana, du darfst nicht weggehen. Bitte, bitte bleib.“
Und auch Kari sah sie entsetzt an, nahm sie bei den Schultern, blickte ihr tief in die Augen und sagte: „Es ist keine gute Idee, jetzt zu gehen. Bitte, Kind, bleib.“
Dem konnte sie nichts entgegen setzen. Sie hatte keine Widerstandskraft. Die Spannung ihrer Muskeln ließ nach, zusammengesunken starrte sie schon wieder zum Horizont. Sie blieb hin- und hergerissen, ärgerte sich über sich selbst. Sie konnte nicht anders, sie wartete auf seine Rückkehr.
Zur Mittagszeit des übernächsten Tages kehrte Leila allein zurück. Aufgeregt rannten Werra und Shana um das Tier herum. Betrachteten es von allen Seiten. Gaben ihm Wasser und suchten nach irgendwelchen Hinweisen auf seinen Besitzer. Leila schien nur durstig zu sein, aber wies keine Spuren eines Kampfes oder Ähnliches auf.
Die Sonne war ein beträchtliches Stück weiter gerückt, als Karas selbst auftauchte. Er saß auf dem Rücken einer jungen fremden, grauen Stute. Ganz langsam, majestätisch aufgerichtet, näherte er sich dem Zelt. Stoppte, stieg ab und drehte sich zu den Frauen um. Er sah sie an und wirkte auf einmal ganz anders. Eher wie ein zu groß geratener, schuldbewusster, kleiner Junge, der nicht zu sprechen wagte. Kari und Werra, die mit Shana vor dem Zelt gesessen und gemeinsam Brot gebacken hatten, standen nach einer knappen, lächelnden Begrüßung auf. Kari schob die Kleine vor sich ins Zelt. Unterdessen trat Karas zögerlich auf Shana zu.
„Die Stute ist für dich“, sagte er sehr leise, dabei hielt er seinen Blick gesenkt. Kein Laut folgte, keine Regung. Erst nach einer ganzen Weile wagte er ihrem Blick zu begegnen. Fragend, als erwarte er, dass sie ihn anspringen und zerfleischen würde. Die Situation war peinlich.
Shana erhob sich, versuchte „Danke“ zu sagen, aber es kam kein hörbarer Ton aus ihrem Mund. Am liebsten wäre sie ihm um den Hals gefallen, stattdessen bewegte sie sich wie eine Puppe, steif und langsam auf der Stelle. Ihre Hände irrten ziellos in der Luft. Erst als das Pferd unruhig tänzelnd am Seil zog, gelang es ihr sogar, auf ihn zuzugehen.
Dann standen sie ganz nah voreinander. Beide ein Bild der Verlegenheit. Sie blickte kurz auf und senkte genauso schnell wieder ihren Blick. „Ehm ...“, setzte er an.
„Ja?“ Sie versuchte den freudigen Klang in ihrer Stimme zu unterdrücken.
Wortlos hielt er ihr das Führungsseil des Pferdes hin.
Sie konnte sich nicht rühren, starrte bloß vor sich in den Sand. Die Luft schien heißer zu werden. Die Stute begann heftig zu tänzeln. Sie sah, wie Karas Kraft aufwandte, das unruhige Tier zu halten und gleichzeitig seine Aufmerksamkeit bei Shana zu belassen.
„Verzeih ...“, flüsterten sie beinah gleichzeitig, dann hatte er sich gefangen. Langsam öffnete er den Gesichtsschleier, schob ihn bis unter das Kinn. Ein strahlendes Lächeln lag auf seinem Gesicht. Seine Augen blitzten sie an, dass ihr der Atem wegblieb und sie schwankte.
Das Gefühl der eigenen Unsicherheit brachte Shana vollends aus der Fassung. Im nächsten Augenblick warf sie sich gegen ihn, trommelte mit ihren Fäusten auf seine Brust und schrie: „Mach das nie wieder! Hörst du! Bleib nie wieder so lange weg! Du, du ... bringst du mich zum Heulen und dann verschwindest du. Was fällt dir eigentlich ein? Mach das nie wieder!“
Sein Lächeln wurde zu einem unverschämten Grinsen. Mit Siegermiene und hoch erhobenem Kopf trat er einen Schritt zurück, drehte sich scheinbar gelassen um und führte das schlanke, graue Pferd am Seil zu seiner Stute Leila. Er nahm sich Zeit. Schlang das andere Ende des Seils um den Hals von Leila, bevor er zu Shana zurückblickte, die ihm wie schlafwandelnd die halbe Strecke gefolgt war. Dann streckte er ihr eine Hand entgegen und winkte beinah unmerklich mit seinem Kopf. Sie wusste selbst nicht warum, aber sie folgte der wortlosen Aufforderung.
Als er ihre Hand ergriff, war das nicht ihre erste Berührung, doch sie ging durch ihren ganzen Körper. Es kribbelte bis in die Zehenspitzen und ließ heiße Wellen in ihr auf- und niederfahren. Ihr schwindelte.
Die warme, große, trockene Hand hielt sie wie ein kleines Kind, führte sie widerstandslos in den Palmenhain hinein. Weiter weg von den Blicken aus den Zelten.
Die folgende Nacht verbrachten die beiden nebeneinander sitzend, aber ohne weitere Berührungen, zwischen einer Felsengruppe am anderen Ende der Oase. Nach erstem langen, gemeinsamen Schweigen folgten, zunächst eher zögerlich, leise Worte. So viele Fragen waren entstanden. Es drängte sie beide, auf alle eine Antwort zu erhalten.
Erst fragte Shana Karas aus, dabei beobachtete sie gebannt seine Reaktionen. Er hatte so viele Gesichter. Ständig wechselte sein Ausdruck: von zärtlich, liebevoll zu siegessicher, zu gestrengem Ernst, zu Verlegenheit, Sorge und erneuter Zärtlichkeit. Immer wieder zeigte er sich amüsiert über ihre Art. Sein Lächeln und Grinsen kannte unendlich viele Spielarten. Seine tiefe, samtene Stimme, die zu einem grollenden Donnern werden konnte und alles Unheil der Welt zu versprechen schien oder das Gegenteil, ließ sie die Zeit vergessen. Wenn er eine Frage nicht beantworten wollte, wurde aus seinem Gesicht eine undurchdringliche Maske, dabei grinste er unerschütterlich und legte den Kopf ein klein wenig schief. Am meisten erstaunte Shana aber, wie schüchtern er sein konnte.
Dann begann er zu fragen. Manche Fragen verrieten pure Neugier, manche klangen eher beiläufig. Seine Anspannung wurde knisternd zwischen ihnen fühlbar. Immer wieder staunte er über ihre Antworten, protestierte barsch oder verlegen gegen ihre klare Sprache oder er sah sie wie ein Wesen von einem anderen Stern an. Sie hatte nie vorher so eine Scheu empfunden wie unter seinen Blicken und Fragen. Das Gefühl von Peinlichkeit, dass sie seit ganz frühen Kindertagen nicht mehr kannte, überfiel sie mehrfach. Jedoch verstand er es, sie schnell mit einer Geste oder einem honigsüßen Lächeln wieder zu beruhigen, ihr Sicherheit zu geben. Meist war es aber ihre Unbefangenheit, die ihn in Verlegenheit stürzte. Mit gesenkten Augenlidern, geöffneten Händen und angespannten Schultern saß er dann da, um nach einer Weile, die Augen aufschlagend, wie ein bettelnder Welpe zu blicken. Sie genoss diese Hilflosigkeit seinerseits sehr. Seine physische Überlegenheit bedeutete in einem solchen Augenblick nichts mehr, jedenfalls nichts Bedrohliches.
Gegen Morgen schwiegen sie wieder und lauschten den Stimmen der Oase. Als die Sonne über die Baumwipfel stieg, richtete sich Shana starr auf und setzte sich auf ihre Fersen.
„Ich muss meine Sippe suchen. Ich muss gehen“, flüsterte sie, lehnte sich ein wenig vor, legte die Hand auf seine Schulter und senkte den Kopf. Sein Duft stieg in ihre Nase, köstlich, betörend, Schauer unter ihrer Haut auslösend. Mit einem Mal wusste sie: wenn sie sich jetzt nicht losriss, würde es ihr nicht mehr gelingen. Ruckartig zog sie den Kopf zurück und flüsterte: „Sofort.“
Ihr Körper straffte sich, sie stand auf und – wurde von seiner Hand zurückgehalten.
„Nein!“, stieß er überrascht und doch bestimmend hervor. Sogleich setzte er mit weichem Flehen nach: „Nein, das macht keinen Sinn. Wenn deine Familie lebt, wird sie weiter leben, ohne dass du Hals über Kopf aufbrichst. Und du wirst sie eher wiederfinden, wenn du nicht wie ein aufgescheuchter Vogel hin und her flatterst. Andererseits … wenn sie ausgelöscht wurden, kannst du nichts mehr ändern.“
Er stockte, atmete hörbar ein und sagte dann: „Sie waren nicht in Kiur und auch nicht auf dem Weg dorthin, sonst wäre ich ihnen begegnet. Arkanis in Kiur wären uns aufgefallen! In die Richtung unseres Lagers sind sie ebenfalls nicht geflohen, sonst wäre mein Vater ihnen begegnet. Bliebe nur noch die offene Wüste oder Langdar ...“
„Nach Langdar würden sie niemals fliehen“, unterbrach sie ihn. „Es sei denn... Nein, das ist unmöglich, zu unwahrscheinlich. Yambi bringt die Kinder nicht in solche Gefahr.“
„Du hältst die offene Wüste wirklich für ungefährlicher als Langdar? Was für ein sonderbarer Gedanke!“ Versonnen schwieg er einen Moment, dann fuhr er fort: „Egal. Es gibt keinen Grund für dich, überstürzt aufzubrechen. Es sei denn ...“, und er sah sie aus Augen an, die vor Trauer matt und dunkler als je zuvor waren.
„Es sei denn … was?“, erwiderte sie verschreckt.
„Du hast meine Gesellschaft bisher nur ertragen, weil du das Pferd wolltest!“ Seine Stimme klang fast tonlos.
„Wie kannst du so etwas nur denken?“, empörte sie sich. „Das ist ... Du bist und bleibst einfach ...“
Er legte ihr sanft, aber bestimmt die Finger seiner Hand auf den Mund, griff mit der anderen ihren Arm, zog sie näher zu sich heran und sagte nur: „Bleib, bis mein Vater wieder da ist. Danach können wir gehen.“
„Was sagst du? - Was sagst du da? Du willst mit mir gehen?“
„Hast du etwas dagegen?“, fragte er beinah geflüstert.
„Du bist ein Hathai! Was hat ein Hathai mit dem freien Volk oder den Arkani zu tun? Mir ist nicht bekannt, dass ihr uns jemals geholfen hättet“, stieß sie erregt hervor.
„Nicht?“
Er hatte diese Frage noch nicht ganz ausgesprochen, da erschrak sie schon selbst über das, was sie gesagt hatte. „Nein, nein, natürlich stimmt das nicht“, stammelte sie, „ich habe euch sehr viel zu verdanken. Verzeih, ich wollte nicht … nicht undankbar sein. Es ist nur …“
„Was?“
„Ich bin das alles nicht gewöhnt.“
„Das alles?“
„Nun ja. Das Leben mit so vielen Menschen an einem Ort. Das, das Leben in einem Zelt, wo man so lange zusammen bleibt, wo sich das ganze Leben der Frauen abspielt. Männer, die herumsitzen und sich von Frauen bedienen lassen. Frauen, die verstummen, wenn ein Mann in ihre Nähe kommt. Und ihre Augen sind überall. Nie ist man wirklich allein ...“
Bis dahin hatte sie die Worte hastig hervor gestoßen. Sie schnappte kurz nach Luft, trat zwei Schritte zurück und fuhr mit fester Stimme fort: „Ich war mit meinem Vater unterwegs. Er machte mich zum Searcher. Solange ich denken kann, wanderte ich durch die Wüste. Der Wind und der Sand der Wüste sind mir vertraut. Sehr früh gingen wir dann getrennte Wege, weil es die Chancen verbessert. Meistens war ich … war ich allein. Ich esse und trinke was, wann und wie ich will. Ich bin nicht gewohnt, auf irgendetwas oder -jemand zu warten. Ich gehe meine Wege allein. Ich finde, was ich brauche. Und ich weiß nicht wirklich, warum ich überhaupt noch hier bin ...“
Jedes einzelne Wort betonend antwortete er: „Bleib! Versprich mir, dass du noch bleibst?“
„Wozu?“
„Versprich es!“
Sie sah ihm ins Gesicht, suchte etwas in seinen Augen. Ihr Herz schien es zu finden, denn sie hörte sich selbst, wie aus der Ferne, sagen: „Ich verspreche es.“
„Wirst du warten?“, mit diesen Worten griff er nach ihrer Hand und zog sie näher zu sich heran. Sie spürte, dass sein Herzschlag sich beschleunigt hatte. Selbst sein Atem ging eine Spur schneller.
Sie konnte es nicht fassen. Er kämpfte. Er kämpfte so offensichtlich mit seinen Gefühlen. Hatte sie Angst in seinen Worten gehört? Jetzt war es an ihr, verwirrt zu sein. Was wollte sie von ihm, was er von ihr?
„Ist das so schwer zu erraten?“, fragte er, als ob er ihre Gedanken gehört hatte.
Das brachte sie nun vollständig aus der Fassung. Tränen schossen in ihre Augen. Oh, nein, das war nicht möglich. Sie war nie eine gewesen, die geheult hatte. Wie viele Jahre war sie ein Searcher? Klar denkend, überlegt handelnd. Und er brachte sie in so kurzer Zeit ständig zum Weinen.
„Nein,“, hörte sie seine flehende Stimme, „weine nicht! Was kann ich tun? ... Wenn es so schlimm ist, lass ich dich gehen.“
Und diesmal war sie es, die seinen Mund mit den Fingern verschloss. Und plötzlich wurde ihr bewusst, wie nahe sie beieinander standen. Beide rangen mit zusammengepressten Lippen um Atem. Wieder heftete sie ihren Blick in sein Gesicht, wischte sich die Wangen trocken.
„Wenn du wirklich willst, dass ich noch bleibe, musst du aufhören mich dauernd zum Heulen zu bringen. Du bist einfach schrecklich!“, schniefte sie.
Er hob den Kopf, starrte durch das Blätterdach in den Himmel und hielt die Luft an, um seine Beherrschung nicht zu verlieren. Wie abwesend antwortete er mit einem bis dahin unbekannten Ernst. Diesen Ton hatte sie vorher in seiner Stimme noch nicht vernommen. „Du weißt nicht, wie Recht du hast!“
Plötzlich schien er in einer niederdrückenden Erinnerung gefangen zu sein, welche zu einem anderen, verborgenen Teil seines Lebens gehörte. Dunkle Schatten traten auf seine Stirn, seine Züge verhärteten sich zu einer undurchdringlichen, emotionslosen Maske.
Beängstigend.
„Genug!“, sagte sie rasch, bemüht diese furchterregenden Schatten zu vertreiben. „Ich bleibe noch, aber ich muss bald gehen!“
„Sicher. Trotzdem - ich ...“, er stockte und vollendete seinen letzten Satz nicht, sondern ging einen Schritt zurück. Alles an ihm wurde wieder weich. Seine fast schwarzen Augen blickten bis in die Tiefe ihrer Seele, dann fügte er mit klarer, leiser Stimme hinzu: „Ich will jeden Augenblick mit dir genießen.“
Sie spürte, dass dies nicht der ursprüngliche Satz war, den er zu sagen angesetzt hatte.
„Lass uns zurückgehen. Ich habe Hunger. Außerdem schau, da hinten kommt Werra, sie sucht dich bestimmt schon“, versuchte sie die Situation aufzulösen.
„Nicht gut!“, murmelte er.
„Warum?“, fragte sie verwirrt.
Es stimmte, Werra suchte sie. Karas hatte auf ihre letzte Frage nicht mehr geantwortet, stattdessen wandte er sich zu seiner Schwester. Das Mädchen schien wenig begeistert, sie beide auf einmal zu finden. Mit einem Ausdruck des Entsetzens auf dem Gesicht, starrte sie Karas an. Geradezu auffällig beeilte er sich, sehr eindringlich und beschwichtigend, „Es ist alles in Ordnung, Werra. Alles in Ordnung. Nichts ist passiert. Shana und ich kommen zum Zelt“, zu sagen.
Da war etwas, was Shana an seiner Reaktion rätselhaft vorkam, aber sie hätte nicht klar benennen können, was es war. Sie schüttelte lächelnd den Kopf, wie um die seltsamen Gedanken zu vertreiben, die aufziehen wollten und doch reagierte auch sie alarmiert. Schneller als nötig sprang sie zu Werra, packte ihre Hand und fragte: „Sollen wir Wasser holen?“
„Schon erledigt“, antwortete die Kleine mit noch immer schockiert wirkendem Blick und in strengem, missbilligenden Ton.
In der nächsten Zeit beeilte sich Shana, morgens rasch die alltäglichen Arbeiten im und ums Zelt zu erledigen, die sie mit der Zeit als ihre Aufgabe übernommen hatte. Danach suchte sie Karas Gesellschaft. Wie er versprochen hatte, lehrte er sie alles über den Umgang mit Pferden. So lernte sie eine gänzlich andere Seite an ihm kennen. Seine Bewegungen waren geschmeidig, zielgerichtet, meist mit sehr großer Ruhe ausgeführt und er konnte blitzschnell reagieren. Seine Hand war immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Er behandelte die Tiere mit sehr viel Ruhe, Einfühlungsvermögen und Zärtlichkeit; aber als Shanas Lehrer war er eher ungeduldig, fast grob. Er ging hart und rau mit ihr um. Die Kraft, mit der er zupackte, hinterließ Spuren. Dann aber, als sie glaubte, wirklich nicht mehr aufstehen zu können, nachdem sie vom Pferd gefallen war, zeigte er sich völlig zerknirscht und besorgt. Sobald sie jedoch wieder sicher auf den Beinen stand, wechselte sein Ton erneut.
„Ich glaube, du kannst nur nett sein, wenn du glaubst, dass ich hilflos bin“, zischte sie ihn einmal an, als sie nach einem üblen Sturz von ihm ganz behutsam ins Zelt getragen wurde.
Sie lernte, alleine auf ein Pferd zu steigen und oben zu bleiben. Bald bedeckten viele blaue Flecken ihren Körper, aber sie gab nicht auf. Als die Farben der Blutergüsse ins gelbliche wechselten, konnte sie reiten und sechs Tage später fühlte sie sich nicht mehr so wund zwischen den Schenkeln wie am Tag zuvor. Ihre Ausritte wurden länger und es stellte sich heraus, dass das graue Pferd schneller als Leila war. Shana gab ihm den Namen „Lalee“.
In der ganzen Zeit berührte Karas sie nicht mehr als unbedingt notwendig. Seine anfängliche Unsicherheit war nach der Nacht zwischen den Felsen schlagartig und gänzlich verschwunden. Seit er mit dem grauen Pferd ins Lager zurückgekehrt war, verbrachten sie viel Zeit miteinander, ohne dass er sie in irgendeiner Weise bedrängte. Wenn es nicht um die Pferde ging, half er ihr manchmal, indem er ihr schwerere Lasten abnahm, war freundlich und neckte sie gelegentlich. Sie wurde in ihrem Verhalten ihm gegenüber immer gelöster und liebte es, sich kleine Frechheiten gegen ihn herauszunehmen. Alles schien in bester Ordnung.
Allerdings behauptete Werra, ihre Stute sei genauso launisch wie Shana selbst und man wisse nie, was sie als nächstes tun würde. Karas kommentierte dies mit einem Lachanfall, da warf Shana mit Holzlöffeln nach ihm, bis er die Flucht ergriff.
„Ich glaube, ich habe Werra verletzt und ich weiß nicht womit. Sie ist so schnell beleidigt“, stellte Shana gegenüber Kari fest, als die Kleine offensichtlich absichtlich einen Krug mit Wasser über sie kippte. Den Krug hatte Shana gerade erst gefüllt, bevor sie Karas neckte.
„Sie ist bloß eifersüchtig“, antwortete Kari beiläufig.
Ganz begriff Shana nicht, was sie damit sagen wollte, aber es schien nicht so wichtig zu sein, denn Kari unterbrach nicht einmal ihre Arbeit.
In den folgenden Tagen ging Shana entweder mit Werra in den Saum der Sandwüste hinaus, um mit ihr Heilpflanzen zu suchen oder ritt mit Karas hinaus, um ihre Reitkünste zu verbessern oder einfach nur seine Gesellschaft zu genießen.
Bewundernd und stolz beobachtete sie ihn aus der Ferne, wenn sie selbst rund um das Zelt beschäftigt war und er mit den anderen jungen Männern zusammen die Zeit verbrachte. Gleichgültig was er tat oder wie leise die Gespräche der Gruppe waren, Karas Erscheinung stach in Shanas Augen immer aus der Gruppe hervor. Dabei waren die jungen Männer oft verschleiert und immer sehr ähnlich gekleidet. Trotzdem hörte sie sein Lachen heraus, erkannte seine Haltung und Gesten.
Bald musste sie sich eingestehen, dass sie Karas vermisste, sobald sie mal ein paar Tage ohne ihn verbrachte. Das waren Tage, an denen er früh aufbrach und allein fortritt. Wenn er zurückkehrte, erwähnte er mit keinem Wort, wo er in der Zwischenzeit gewesen oder was der Grund seiner Abwesenheit war.
An diesen Tagen dachte Shana häufiger und stärker daran, selbst das Lager zu verlassen. Ohne ihn erschien ihr das Leben zwischen den Zelten zu eng und eintönig. Der Gedanke an Yambi verschwand sowieso nie ganz aus ihrem Kopf. Nur ihr Versprechen, auf Handars Rückkehr zu warten, hielt sie zurück.
In den Zeiten dazwischen wurden ihre gemeinsamen Ausritte länger. Er zeigte ihr, was jenseits des direkten Einzugsbereiches des Lagers lag, erklärte ihr vieles von der Lebensweise der Hathai und machte ihr klar, dass es bei den Hathai Unternehmungen gab, die außerhalb des Lagers stattfanden, ausschließlich von den Männern ausgeführt wurden und über die nicht weiter gesprochen wurde. Dazu schienen vor allem die Handelstätigkeiten und Besorgungsritte zu gehören, die die Männer in kleinen Gruppen unternahmen.
Eines Tages stellte sie ihm die Frage, ob er ihr den Weg in ein Karaisdorf erklären könne. Seine erste Antwort war ein völlig entgeisterter Blick, so dass sie schnell erklärte, sie wolle dort nach Yambi und den Kindern fragen. Trotzdem antwortete er schroff ablehnend. Damit wollte sie sich nicht zufrieden geben und setzte nach: „Kann ich denn bei eurer nächsten Reise mitreiten?“
„Nein. Das ist zu gefährlich.“
Immerhin hatte er ihr diesmal eine Erklärung gegeben. Die reichte ihr aber nicht und sie fragte weiter: „Gefährlich? Was heißt das? Gefährlich für euch? Glaubst du, dass ich euch wegen meiner Hautfarbe gefährden würde?“
„Uns gefährden? Unsinn! Du gehörst dort nicht hin, basta!“
Der Ton sagte ihr sehr deutlich, dass sie nicht weiter nachfragen sollte und sie tat es auch nicht. Stattdessen verfiel sie in beleidigtes Schweigen und er wechselte das Thema.
In den meisten Gesprächen, egal, ob sie sie mit Kari, Werra oder Karas führte, ließ sie sich die Abläufe, die im Lager üblich waren, erklären. Sie wollte wissen, warum die Männer fast jeden Tag zusammen Tee tranken, die Frauen dies aber so gut wie nie taten. Die Antwort, Frauen hätten anderes zu tun, gefiel ihr genauso wenig wie die Einteilung in Tätigkeiten im Lager und solche außerhalb. Sehr oft erhielt sie zu ihrem Verdruss die Antwort, dass es den Regeln entspräche und Shana begriff, dass Regeln etwas sehr wichtiges sein mussten.
Eines Tages trat Kari zu Shana, nachdem sie von einem ihrer Ausritte mit Karas erst bei Sonnenuntergang zurückkehrten: „Shana, ich muss mit dir sprechen.“
„Wann immer du möchtest.“
„Dann komm. Wir gehen zur Quelle. Denn es gibt Dinge, die sind nicht für fremde Ohren bestimmt.“
Das Andeuten einer Heimlichkeit gab Shana ein ratloses Gefühl. Was konnte so schlimm sein, dass Kari es sogar vor der Familie nicht aussprechen wollte? Ob sie einen Fehler gemacht hatte? Ob Kari sie fortschicken wollte?
An der Quelle waren sie allein und hatten zudem einen freien Blick auf das ganze Lager.
Kari begann, schon während sie sich auf einen der größeren Steine setzte, ohne die übliche lange Vorrede über banale Dinge: „Shana, du bist mir lieb geworden wie ein eigenes Kind, deshalb muss ich dir auch Dinge erklären, wie ich sie meinen Kindern erkläre. Doch zuerst will ich wissen: Ist mein Sohn gut zu dir?“
„Ja. Ja, natürlich. Er bringt mir eine Menge bei. Alles von den Pferden und dem Land hinter der Oase.“
„Dann muss ich dich bitten, treib dich nicht zu viel mit Karas rum.“
„Wie bitte?“ Mit dieser Wende hatte Shana nicht gerechnet. Fassungslos, mit geöffneten Lippen und hochgezogenen Brauen, verfolgte sie die weiteren Worte Karis.
„Ich weiß, dass er sein Herz verschenkt und seinen Kopf verloren hat. Ständig übertritt er die Regeln unseres Zusammenlebens, darum will ich dir eines klar sagen: Du darfst nach Sonnenuntergang nicht mit ihm alleine zusammen sein. Es ist zu gefährlich.“
„Was ist daran gefährlich? Karas kennt sich doch hier aus und ich bin es gewohnt. Ich war schon viele Nächte alleine unterwegs.“
„Kind, verstehst du denn nicht. Es geht nicht um Gefahren, die euch von außen drohen.“
„Was meinst du? - Kari, ich begreife nicht, wovon du sprichst.“
„Ach herrje, bist du schwer von Begriff! Es ist wichtig, dass er nichts tut, was du nicht willst. Mein Sohn darf im Lager keine Frau berühren, die er nicht heiratet.“ Und weil Kari ahnte, welches Shanas nächste Frage sein würde, ergänzte sie: „Das heißt, mit der er nicht sein ganzes Leben und sein Zelt teilen will. Und für dich ist es auch nicht gut. Wenn du mit ihm alleine nach Sonnenuntergang gesehen wirst, bist eine Frau, die die Regeln nicht achtet.“
Shana verstand immer noch nicht. Sie schüttelte kurz ihren Kopf und fragte: „Was bedeutet das?“
„Kein Mann und keine Frau sollte solch einen Ruf haben.“
„Versteh ich nicht.“
„Oh, Shana. Ich muss es dir wohl anders sagen: Du darfst es nicht. Ihr dürft es nicht, es verstößt gegen Ehre und Regeln der Hathai. Beides darf nicht geschehen. Wer dies missachtet, wird bestraft.“
„Bestraft? Kari, was heißt das schon wieder?“
Shanas Stimme zitterte nun und sie sah aus, als ob sie gleich weinen würde. Kari sah wie verzweifelt sie versuchte, das Gesagte zu verstehen. Wie sollte sie es ihr nur begreiflich machen?
Unglücklich blickte sie die junge Frau an und versuchte es noch einmal, sich für Shana verständlich auszudrücken. „Schau Mädchen: wenn ein Mensch die Regeln verletzt, verletzt er meistens die Gefühle oder Rechte der anderen Menschen. Damit er spürt, was er getan hat, wird er zur Abschreckung zum Beispiel geschlagen. Ihm werden Schmerzen zugefügt. Das ist schlimm für alle Beteiligten. Doch dies ist nicht die einzige mögliche Strafe. Die schlimmste Strafe besteht darin, von einem Menschen zu verlangen, dass er das Lager für immer verlässt, weil es nicht mehr für alle anderen zumutbar ist, mit diesem Menschen im gleichen Lager zu leben.“
„Ah – so ist das.“
Trotz dieser Äußerung zweifelte Kari darin, dass Shana sie verstanden hatte. Dennoch nickte sie bestätigend und sagte: „Ja, so ist das.“
Sie blieb sitzen und wartete. Sie wusste einfach, dass Shana weitere Fragen hatte. Lange brauchte sie nicht zu warten.
„Meinst du, ich soll nicht so lange mit Karas ausreiten?“
„Ja, das meine ich.“
Jetzt setzte sich auch Shana hin. Sie dachte nach.
„Ich soll nicht zu weit mit ihm reiten? Ich meine so, dass wir erst am nächsten Tag wieder hier wären.“
„Richtig. Obwohl - was da draußen geschieht, geht das Lager nichts an.“
Erneut verharrten sie in Schweigen.
„Kari, ich muss und will meine Sippe suchen. Karas wollte, dass ich ihm verspreche, zu warten bis Handar zurückkommt. Muss ich mich bis dahin an diese Regeln halten?“
„Ganz besonders sogar.“
„Warum?“
„Weil Karas sonst die Ehre der Familie beschmutzt und Handar ihn bestrafen oder davonjagen müsste.“
„Oh. Das will ich nicht! Ich verspreche dir, ich werde bei Sonnenuntergang immer in deiner Nähe sein.“
„Gut so.“
Sichtlich erleichtert schlang Kari die Arme um Shana und drückte sie, bis ihr ganz warm ums Herz wurde, dabei murmelte sie: „Mein Liebes, ach mein Liebes.“
Als sie sich wieder voneinander lösten, sah Shana, dass Kari noch mehr bedrückte. Wartend legte sie den Kopf schief und blickte die ältere Frau auffordernd an. Lächelnd erkannte Kari, dass Shana verstanden hatte und fragte mit ernster Stimme: „Karas hat mir erzählt, dass du in ein Karaisdorf willst. Stimmt das?“
„Ja natürlich, ich will doch Yambi suchen.“
„Glaubst du wirklich, du kannst deine Sippe noch finden?“
„Würdest du sie nicht suchen?“, fragte Shana erstaunt.
„Ich hätte diese Wahl nicht.“
„Warum nicht?“
„Es wäre nicht meine Aufgabe, sondern die des Clans. Ich müsste mich dem Schutz des Clans anvertrauen.“
„Ich bin ihr Clan“, antwortete Shana betont nachdrücklich.
„Hm. Kann ich dich nicht überreden, bei uns zu bleiben und unserem Clan zu vertrauen? Sorgen wir nicht gut genug für dich?“
„Oh Kari, ihr sorgt so liebevoll für mich, doch das ist nicht genug.“
„So? Wie hätte denn dein Clan für dich gesorgt?“
„Eh? Oh, darum geht es nicht. Ihr habt mich aufgenommen, aber ich bin schon viel zu lange euer Gast. Schau: Du müsstest dir gar keine Sorgen um Karas machen, wenn ich rechtzeitig fortgegangen wäre. Stattdessen mache ich dir dauernd Sorgen. Es tut mir wirklich leid. Nun habe ich es aber versprochen, nicht eher zu gehen, als bis Handar zurückkommt. Und mein Vater hat gesagt, ein Versprechen soll man nur geben, wenn man nicht vorhat, es zu brechen. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, welche Schwierigkeiten ich euch damit bereite. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist.“
„Shana, du bereitest uns keine Schwierigkeiten. Du nicht! Ich habe nur Angst, dass dir dort draußen etwas passieren könnte.“
„Ich könnte verdursten“, erwiderte Shana sachlich. Mit ernstem Gesicht, aber gleichzeitig um einen unbesorgten Ton bemüht, fuhr sie fort: „Ist das wirklich so schlimm? Meine halbe Sippe ist verdurstet. Das ist unser Leben. Ich bin Searcher.“
Stolz durchströmte sie bei diesen Worten, kraftstrahlend und aufrecht sah sie Kari an.
„Du bist ein so gutes Mädchen. Wenn du gehst, wird mein Herz brechen, damit du einen Teil davon mitnehmen kannst.“
„So etwas darfst du nicht sagen. Das tut weh und ich bin schuld.“
„Nein, mein Kind. Die heiligen Mächte haben deinen Weg mit unserem gekreuzt und ich preise sie dafür. Ich glaube, es kommt noch alles in Ordnung.“
Mit diesen Worten stand Kari auf und nahm Shana an die Hand. Sie gingen gemeinsam ins Zelt zurück. Shana hatte vieles, worüber sie nachdenken musste.
Seit diesem Gespräch, fragte sie jedes Mal, bevor sie mit Karas ausritt. Sie beobachtete den Sonnenstand und drängte rechtzeitig auf Rückkehr. Außerdem versuchte sie zunehmend die Richtung dieser Ausritte zu bestimmen, denn sie fing an, gezielt nach Spuren zu suchen, die ihr einen Hinweis hätten geben können, was mit Yambi geschehen war. Sie ließ sich von Karas Entfernungen zu ihm bekannten Orten erklären. Fragte, welche Bewohner sich in welchem Gebiet aufhielten, wer Sklavenjäger war und wer nicht.
Auf ihren längeren, gemeinsamen Ritten näherten sie sich so manches Mal sogar der Gegend vor dem Gebirge im Osten und eines Tages erklärte ihr Karas, dass hinter diesem Gebirge genauso wie nördlich der Oase das Gebiet der Karais begänne und dieses sich fast bis zur Küste mit der Meeresstadt erstreckte. Von dort würden in den nächsten Tagen die übrigen Männer und damit sein Vater und sein Bruder zurückerwartet. Zu diesem Anlass und weil die Zeit sowieso gekommen sei, würde es ein Großfest im Lager Handars geben, zu dem auch Hathai aus anderen Lagern und Clans erwartet würden. Sein Vater aber würde sicherlich neue Einsichten zu der Frage bringen, was die Menschen der Meeresstadt veranlasst hatte, in der letzten Zeit verstärkt Jagd auf Sklaven zu machen.
„Woher weißt du das?“, fragte Shana erstaunt. „Seit dein Vater fort ist, ist doch kein Bote von ihm zurückgekehrt.“
„Nicht zu uns, aber zu dem Lager von Rihs altem Clan.“
„Du besuchst die anderen Hathailager während ich mit deiner Schwester unterwegs bin?“
„Tja, es ist meine Pflicht. Von einem Mann, der noch keine Gefährtin gewählt hat, wird das erwartet.“
„Du suchst dir eine Frau?“, Shana spürte einen furchtbaren Stich in der Brust.
„Ja und nein. Die Sitte verlangt es“, die Antwort klang sehr unbestimmt und verlegen.
Shana wollte nun nicht mehr reden. Sie hatte Mühe zu atmen, aber das wollte sie vor ihm verbergen. Sie senkte ihre Augenlider. Nach und nach sickerte die Botschaft seiner Worte in ihr Herz und dann wich jeglicher Ausdruck aus ihrem Gesicht. Ein paar Sekunden später, wirkte ihr Antlitz steinern, dagegen strafften sich die Muskeln ihres Rückens. Sie lenkte Lalee direkt zum Lager zurück und trieb das Pferd zu größter Eile an, ohne auch nur im Geringsten darauf zu achten, ob und wie Karas ihr folgte. Beim Zelt angekommen, hatte sie sich in einen starren Panzer aus Schweigsamkeit gehüllt. Alles an ihr verlief mechanisch, dennoch zuvorkommend und umsichtig. Auf Ansprache senkte sie den Blick und wich körperlich aus. Plötzlich schien eine unsichtbare Mauer um sie herum zu existieren.
Kari, die die Veränderung sofort bemerkte, zeigte ihrem Sohn wieder einmal stumm und nachdrücklich, dass sie ihn für Shanas Zustand verantwortlich machte und dies sehr missbilligte. Seltsamerweise wehrte sich Karas wieder nicht dagegen, wo er doch sonst nie etwas auf sich sitzen ließ. Aber vielleicht war ihm ja klar, dass er dieses Mal wirklich dafür verantwortlich war, wie elend Shana sich fühlte.
In ihren Gedanken aber überschüttete Shana sich selbst mit Vorwürfen: „Wie konnte ich nur so blöd sein? Wie konnte ich hoffen, dass er mit mir geht? Habe ich etwa gehofft, er richte sein Leben nach mir aus? Ich habe meine Sippe verraten, wegen ... wegen eines blöden Gefühls? Was habe ich mir eigentlich gedacht?“
Diese und ähnliche Fragen drehten sich immer und immer wieder in ihrem Kopf.
Tagsüber verrichtete sie diszipliniert ihre Aufgaben und in der Nacht wälzte sie sich unruhig hin und her. Sie hatte versprochen zu bleiben bis Handar zurückkehrte, aber sie würde keinen Tag länger bleiben. Oh, sie konnte es kaum erwarten zu gehen. Was musste sie Werra noch alles beibringen, damit sie nicht mehr in der Schuld der Hathai stand?
Im Geist ging sie jede einzelne Pflanze und ihre Heilwirkung durch. Sie verbrachte so viel Zeit wie möglich mit Werra, die das sehr genoss. Gleichzeitig versuchte sie Karas auszuweichen, wo es nur ging. Dabei hatte sie das Gefühl innerlich zu zerreißen.
Karas wurde von allen Frauen im Zelt so schlecht behandelt, wie es nur ging und jede hatte einen anderen Grund dafür. Shana bemerkte es. Sie fühlte sich daraufhin noch elender, aber es gelang ihr nicht, den anderen zu sagen, dass er nichts Unrechtes getan hatte, dass nur sie sich dummen Träumen hingegeben hatte, die nun der Wirklichkeit weichen mussten.
Nachtragend zu sein war für die Hathai ebenso unhöflich, wie die Gefühle des anderen nicht zu beachten. Viele der Regeln waren genau dazu da, so etwas zu vermeiden und jeder schien zu wissen, worauf man Acht geben musste, um es nicht dazu kommen zu lassen. Im Laufe der Zeit hatte Shana den Eindruck gewonnen, die wichtigste Antwort im Leben der Hathai sei: „Weil es so ist.“ Man nahm es hin und grämte sich nicht weiter.
Da Shana ihren Wall aus Schweigen und Rückzug nicht aufgab, fing Kari besorgt an, sie noch genauer zu beobachten. Sie bemerkte wie intensiv Shana die Näharbeit an der Decke wieder aufnahm und dass sie das Zelt nur noch verließ, wenn es notwendig war. Das Mädchen hatte ihre wenigen Sachen geordnet zusammengelegt und blickte beim Nähen nicht mehr auf, wenn jemand ins Zelt kam.
Karas hatte sich am ersten Abend vor sie gesetzt und sie ungewöhnlich höflich angesprochen: „Was verschließt dir den Mund und hält dich von mir fern? Habe ich etwas Falsches getan oder gesagt? Ich wollte und will dir nicht weh tun.“
Shana hatte nicht geantwortet, nicht aufgeblickt. Er entfernte sich nach einer Weile, ließ den Kopf hängen und verbrachte so viel Zeit wie möglich draußen. Auch das war der aufmerksamen Kari nicht entgangen und sie konnte sich keinen rechten Reim darauf machen.
Kurz bevor am zweiten Tag die Zeit nahte, wo alle sich ins Zelt zurückzogen, hielt sie es nicht mehr aus. Sie richtete sich direkt an Shana: „Karas versorgt Lalee gut, doch es ist dein Pferd und deine Aufgabe. Du bist unser Gast, aber ich hoffe du weißt, dass ich dich wie eine Tochter liebe, deshalb sage ich dir: Vernachlässige dein Pferd nicht, es ist an dich gebunden.“
Shana blickte auf und in ihren Augen schimmerten Tränen. Endlich brach sie ihr Schweigen, murmelte mit erstickender Stimme: „Es tut mir leid, ich will nicht undankbar sein. Auf keinen Fall. Kari bitte verzeih mir. Ich werde sofort tun, was du sagst.“ Und sie legte die fast fertige Näharbeit zur Seite.
Kari griff danach und warf einen prüfenden Blick darauf: „Du hast in den letzten zwei Tagen sehr viel gearbeitet und so schön. Es sind nur noch wenige Stiche zu tun. Du bringst alle deine Arbeiten zu Ende. Ich habe dir gerade gesagt, Karas versorgt Lalee gut, jedoch will ich wissen, wer Shana versorgt?“
Shana schluckte und dann ließ sie hilflos den Tränen freien Lauf und diesmal waren es stumme, schwere Tränen, voll tiefer Trauer. Doch als Kari ihr die tröstenden Arme bot, wendete sie sich ab und schüttelte langsam den Kopf. Damit schürte sie, ohne es zu wissen, in Kari einen Verdacht, den diese nicht wahrhaben wollte. Die Stille zwischen ihnen war so beredt, dass man meinen konnte, man höre ihre Herzen brechen.
In der Nacht vor der Rückkehr Handars hatte Shana einen furchtbaren, wenn auch neuen Traum: Sie stand an der Quelle, um ihren Wassersack zu füllen, bevor sie das Lager zum letzten Mal verlassen würde. Da kam Karas hielt ihre Hand fest und sagte: „Danach können wir gehen.“ Dann verstand sie seine Worte nicht mehr, bis er die Frage stellte: „Wirst du warten?“ Statt zu antworten, rannte sie los. Sie rannte und rannte, doch immer tauchte hinter dem nächsten Baum oder Fels Karas Gestalt auf und flüsterte: „Sei mein Schatten!“
Schweißgebadet wachte sie auf und blickte in Karis besorgtes Gesicht: „Was ist bloß los, Liebes? Was hat er dir bloß angetan? Warum schützt du ihn?“
Schluchzend warf sich Shana in Karis Arme: „ Nichts... nichts. Nichts, was gegen … die Regeln, die Ehre verstößt. Ich … ich … habe … ich habe mich … oh, Kari ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Wie kann ich ohne Karas leben?“, stieß sie hervor.
Erstaunt hielt Kari sie ein wenig von sich weg, nur um sie gleich fester in die Arme zu schließen: „Was sagst du da? Was sagst du, mein liebes, dummes Ding?“
Sie wiegte Shana bis sie ruhig wurde und dabei flüsterte ihr Kari beständig zu: „Dann wird ja alles, alles gut. Wenn er erst in deinem Schoß liegt, wirst du das alles vergessen. Du wirst sehen, morgen kommt Handar und alles wird gut.“
Shana begriff diese Worte nicht, aber da ihr Entschluss feststand, war das belanglos.