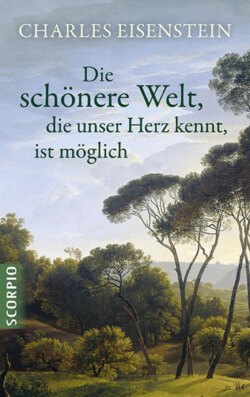Читать книгу Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich - Eisenstein Charles - Страница 13
Gewalt
ОглавлениеInterbeing ist ein verletzlicher Zustand; so verletzlich wie eine naive Altruistin, wie ein vertrauensvoll Liebender, wie die, die vorbehaltlos teilen. Um sich darauf einzulassen, muss man aus dem vermeintlichen Schutz eines Lebens heraustreten, das auf Basis von Kontrolle seine Schutzwälle aus Zynismus, Urteilen und Anschuldigungen errichtet hat. Aber was, wenn ich gebe und nichts dafür bekomme? Was, wenn ich mich entscheide, an einen übergeordneten Sinn zu glauben, und mich irre? Was, wenn das Universum nun doch ein Tohuwabohu aus blinden Kräften ist? Was, wenn ich mich öffne, und die Welt verletzt mich? Diese Ängste sorgen dafür, dass sich gewöhnlich keiner auf die neue Geschichte einlässt, solange die alte nicht auseinanderbricht. Sie ist ja nichts, was wir durch eigene Anstrengung erreicht haben, sondern wir wurden in sie hineingeboren.
Doch gerade jene wechselseitige Verbundenheit, die uns so unglaublich verletzlich macht, gibt uns auch eine immense Kraft. Vergessen Sie nicht, die Verletzlichkeit und die Kraft gehen Hand in Hand, weil wir erst den Wächter, das vereinzelte Selbst, entspannen müssen, bevor wir die Kraft anzapfen können, die jenseits seines Horizonts liegt. Erst dann können wir Dinge vollbringen, die für das vereinzelte Selbst unmöglich sind. Anders gesagt, werden wir dann zu Dingen fähig, von denen wir nicht wissen, wie man sie »machen« kann.
Etwas geschehen machen, etwas veranlassen, das heißt Gewalt anzuwenden. Ich kann Sie bitten, mir Geld zu geben, aber was müsste ich machen, um Sie dazu zu veranlassen? Ich könnte Sie, wenn Sie schwach sind, körperlich dazu zwingen, mir Ihre Brieftasche zu geben. Oder ich könnte Ihnen eine Pistole an den Kopf setzen – jede Bedrohung Ihres Lebens ist eine Form von Gewalt. Das Leben kann aber auch ziemlich subtil bedroht werden. Juristische Gewalt zum Beispiel beruht letztendlich auch auf einer körperlichen Bedrohung: Wenn Sie die Anweisungen des Gerichts missachten, wird früher oder später ein Mann mit Handschellen und einer Pistole bei Ihnen zu Hause auftauchen. Auch ökonomische Gewalt beruht auf dem Zusammenhang zwischen Geld und Komfort, Sicherheit und dem Überleben.
Und dann gibt es noch psychische Gewalt, ein Ausdruck, der mehr als nur eine Metapher ist. Mit ihr wird über Beweggründe Druck ausgeübt, die auf ein grundlegendes Sicherheitsgefühl abzielen, besonders auf das Bedürfnis nach Anerkennung durch die Gruppe und die Eltern. Schon in der Kindheit lernen wir psychische Gewalt kennen, wenn die Eltern ihre Anerkennung oder Ablehnung an Bedingungen knüpfen. Das rührt an die vielleicht fundamentalste Furcht eines jungen Säugetiers: von der Mutter verlassen zu werden. Ein Säugetierbaby, das zu lange allein gelassen wird, ruft kläglich nach seiner Mutter, wodurch es jeden Räuber in Hörweite anlockt – ein Risiko, das immer noch dem sicheren Tod durch die Trennung von der nährenden Mutter vorzuziehen ist. Diese Todesangst zu wecken ist ebenso schlimm, wie jemandem eine Pistole an den Kopf zu halten. Viele moderne Erziehungspraktiken machen sich diese Angst zunutze: das anschuldigende »Wie konntest du nur?«, »Was ist los mit dir?«, »Was hast du dir dabei gedacht?« und vielleicht noch schädlicher das manipulative Lob: »Ich akzeptiere dich nur, wenn du das tust, was ich gutheiße«. Wir lernen, uns zu bemühen, ein »braver Junge« oder ein »braves Mädchen« zu sein, wobei das Wort »brav« hier bedeutet, dass Mama oder Papa einen so akzeptieren. Schließlich internalisieren wir die Ablehnung als Selbstablehnung – Schuld und Scham – und die an Bedingungen geknüpfte Akzeptanz als an Bedingungen geknüpfte Selbstakzeptanz. Sich selbst diese Akzeptanz zu gewähren fühlt sich zutiefst befriedigend an; sie sich zu verweigern ist äußerst unangenehm. Auf dieses Gefühl der Befriedigung bezieht sich im Kern das Wort »gut«. Es lohnt sich, das zu erforschen: Wiederholen Sie zu sich selbst: »Ich bin gut. Guter Junge. Ich bin ein guter Mensch. Manche Menschen sind schlechte Menschen, aber ich nicht – ich bin ein guter Mensch.« Wenn Sie diese Worte ernsthaft für sich denken, entdecken Sie vielleicht, dass in der Befriedigung, die sie auslösen, etwas zutiefst Kindliches liegt.
An Bedingungen geknüpfte Selbstakzeptanz und Selbstablehnung sind mächtige Mittel zur Selbstkontrolle, der Anwendung von psychischer Gewalt gegen sich selbst. Wir sind darauf stark konditioniert; das ist vielleicht die grundlegendste aller »Gewohnheiten der Separation«, wie ich sie nenne. Mit dieser Konditionierung sind wir auch jeder Autoritätsperson oder Regierung gegenüber verwundbar, die die Rolle der Eltern übernehmen könnte: Richter zu sein über Gut und Böse und Anerkennung zu gewähren oder vorzuenthalten.
Diese Konditionierung beeinflusst auch unsere Versuche, andere Menschen oder die Welt zu verändern. Wir wecken Schuldgefühle mit Sprüchen wie: »Bist du Teil des Problems oder Teil der Lösung?« Wir pochen auf die Mitschuld an der imperialistischen Verheerung durch die westliche Zivilisation, den Ökozid, den Kulturmord und den Völkermord, die jeder von uns trägt. Wir versuchen die Menschen, die wir zu einem anderem Verhalten bewegen möchten, über ihre Eitelkeit zu manipulieren: »Wenn du das machst, bist du ein guter Mensch.«
Wir wenden auch gewohnheitsmäßig Gewalt gegen Politiker und Konzerne an. Das kann die Drohung mit einer öffentlichen Demütigung sein, oder dass wir ihnen ein öffentliches Lob und damit ein positives Image in Aussicht stellen. Es kann die Drohung mit einer Klage oder einer Rückrufkampagne sein. Es kann eine finanzielle Drohung oder ein finanzieller Anreiz sein. »Verhalten Sie sich der Umwelt gegenüber verantwortungsvoll, weil Sie letztendlich selbst davon profitieren.«
Welche Weltsicht, welche Geschichte bestärken wir, wenn wir diese Taktik anwenden? Es ist die Weltsicht, nach der nur dann etwas geschieht, wenn zuerst eine Kraft ausgeübt wurde, nach dem Motto: »Ich kenne dich. Du maximierst rücksichtslos dein rationales oder genetisches Eigeninteresse.« Unter dieser Annahme versuchen wir, uns dieses Eigeninteresse zunutze zu machen, sowohl bei anderen Menschen als auch bei uns selbst.
Damit ist nicht gesagt, dass wir aufhören sollten, zu loben oder zu tadeln, oder dass wir versuchen sollten, uns vom Einfluss der Meinung der anderen zu befreien. Als im Interbeing Lebende wirft uns die Welt auf das zurück, was wir in die Welt einbringen. Es ist nicht falsch, die mutigen Entscheidungen zu feiern, die uns bewegen, oder dem Ärger oder der Trauer über schlechte Entscheidungen Luft zu machen. Es geht darum, dass sie nicht mit einer manipulativen Absicht eingesetzt werden, die aus der Weltsicht der Gewalt kommt.
Die gewohnheitsmäßige Anwendung der verschiedensten Arten von Gewalt ist tief verankert. Nach dem wissenschaftlichen Paradigma, das, obwohl veraltet, immer noch unser praktisches Denken speist, verändert sich nichts im Universum, solange nicht eine Kraft darauf ausgeübt wird. Die Macht über die materielle Wirklichkeit hat dann also der, der am meisten Kraft aufbieten kann und am umfassendsten und genauesten weiß, wo und wie diese Kraft auszuüben ist. Deswegen sind die Machthungrigen oft so besessen davon, die Informationsflüsse zu kontrollieren.
In einem Universum ohne Bewusstsein oder eigenen Willen können Dinge nie »einfach passieren«; sie passieren nur, wenn sie durch etwas verursacht werden, und »verursachen« bedeutet hier eine Kraft ausüben, Gewalt anwenden. Von diesem Universum müssen wir uns nehmen, in ihm müssen wir Kontrolle ausüben, und auf es müssen wir unsere eigenen Entwürfe projizieren, müssen uns immer mehr Kräfte zunutze machen, die wir dann mit immer größerer Präzision anwenden, um schließlich die kartesianischen Herren und Besitzer der Natur zu werden.
Ist Ihnen aufgefallen, wie das Wort »zweckmäßig« so viel von jener Mentalität einschmuggelt, die den Verwüstungen unserer Zivilisation zugrunde liegt?
Glauben Sie, dass wir je etwas anderes als noch mehr Separation schaffen, solange wir auf Basis der Weltanschauung des Zeitalters der Separation handeln?
Kontrolle verlangt nach mehr Kontrolle. Wenn wir also ein Feld mit starken Pestiziden behandeln, brauchen wir gegen die Superunkräuter und Superschädlinge, die dann auftauchen, neue und sogar noch stärkere Dosen von Pestiziden. Wenn jemand eine Diät macht und versucht, den Drang, zu essen, zu kontrollieren, explodiert irgendwann das aufgestaute Verlangen in Form eines Essanfalls, der dann weitere Versuche der Selbstkontrolle nach sich zieht. Und wenn Menschen eingepackt, überwacht, eingeplant, zugewiesen, eingestuft und verpflichtet werden, rebellieren sie auf verschiedenste Art, manchmal auch irrational oder sogar gewalttätig. Aha, denken wir, wir müssen diese Menschen unter Kontrolle bringen. Wie bei einer Sucht verbrauchen diese eskalierenden Versuche, immer noch mehr Kontrolle auszuüben, schließlich alle verfügbaren Ressourcen, die persönlichen, die sozialen oder die planetarischen. Das Resultat ist eine Krise, welche die Kontrollmechanismen immer nur hinauszögern, aber niemals lösen können. Und jedes Hinauszögern zehrt weiter an den wenigen Ressourcen, die noch zur Verfügung stehen.
Dass das »Zweckmäßige« nicht mehr so gut funktioniert wie einst, ist offensichtlich. Nicht nur deswegen, weil das, was früher zweckmäßig war, unsere heutigen Bedürfnisse nicht mehr erfüllt, sondern weil es auch in seinem ursprünglichen Bereich zunehmend wirkungslos ist: Das Zweckmäßige ist nicht mehr zweckmäßig. Ob es uns gefällt oder nicht, wir werden in eine neue Welt hineingeboren.
Dieses Buch ist ein Aufruf, das Kontrolldenken aufzugeben, damit wir Fähigkeiten entwickeln, die bei Weitem das übersteigen, was wir mit Gewalt erreichen können. Es ist eine Einladung zu einem radikal anderen Verständnis von Ursache und Wirkung und daher einer radikal anderen Vorstellung davon, was zweckmäßig ist. Wenn wir dementsprechend handeln, werden unsere Entscheidungen jenen, die nach dem alten Paradigma handeln, verrückt erscheinen: naiv, unzweckmäßig, unverantwortlich. Und so erscheinen sie auch dem Teil in uns – und ich glaube, er ist in Ihnen genauso lebendig wie in mir –, der auch noch in der alten Geschichte lebt. Sie erkennen seine Stimme wahrscheinlich: die kritische, abschätzige, zweifelnde, unterstellende. Sie möchte, dass wir klein bleiben, sicher und geschützt in unseren kleinen Seifenblasen der Kontrolle. Meine Absicht hier ist nicht, Sie zu drängen, gegen diese Stimme anzukämpfen oder sie zu unterdrücken; wenn man sie einfach als das anerkennt, was sie ist, dann beginnt ihre Macht schon zu schwinden.
Das hier soll nicht den Eindruck vermitteln, wir sollten nie Kraft ausüben oder wir sollten alle Formen der Kultur aufgeben, bei denen es darauf ankommt, von den Eltern, den Älteren oder der Gruppe akzeptiert zu werden. Das wird immer ein wichtiger Teil des menschlichen Dramas bleiben. Doch unsere tiefliegenden Ideologien haben uns blind gemacht für andere Wege, auf denen Veränderung herbeigeführt werden kann. Dieses Buch wird erkunden, wie man der Gewalt (und der Vernunft, dem linearen Denken etc.) ihren angemessenen Platz zuweisen kann.