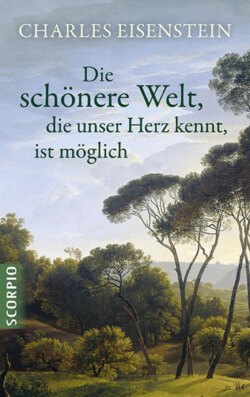Читать книгу Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich - Eisenstein Charles - Страница 14
Wissenschaft
ОглавлениеUnsere Vorstellung von »Zweckmäßigkeit« birgt eine Falle. »Zweckmäßig« steht für die Gesetze von Ursache und Wirkung, die uns die alte Welt in die Hand gegeben hat, und nichts, was wir nach diesen Gesetzen tun, kann auch nur annähernd ausreichen, um eine schönere Welt zu erschaffen oder um überhaupt nur das Schreckliche an dieser zu mildern. Die Krisen sind zu groß, die Mächtigen zu stark, und man selbst ist nur ein klitzekleines Einzelwesen. Wenn sich sogar die Mächtigsten in unserem System, die Präsidenten und Konzernchefs, eingeschränkt wähnen durch ihre Rollen und Aufgabenstellungen, Kräften ausgeliefert, die stärker sind als sie selbst, um wie viel machtloser sind dann wir?
Es ist also kein Wunder, dass so viele Aktivisten früher oder später an den Punkt kommen, wo sie mit der Verzweiflung kämpfen. Sie sagen vielleicht: »Als ich jung und idealistisch war, stürzte ich mich mit all meiner Energie auf die Probleme, aber irgendwann erkannte ich, wie groß sie tatsächlich waren und wie groß der Widerstand gegen Veränderung war. Was ich auch tue, nichts kann jemals genug sein.« Das heißt, sie haben auf der Ebene des Zweckmäßigen alle Möglichkeiten versucht und ausgeschöpft.
Die Frage, vor der wir stehen, ist also: Was machen wir, wenn im Gesamtzusammenhang das Zweckmäßige nicht mehr zweckmäßig ist? Offensichtlich werden wir Dinge tun müssen, die nach unserem üblichen Verständnis nicht zweckmäßig sind.
Das ist ein entscheidender Punkt: Unser herkömmliches Verständnis davon, was zweckmäßig ist, basiert auf einer Weltsicht, einem Mythos, der jetzt schnell an Gültigkeit verliert. Außerdem liegt genau diese veraltende Weltsicht der alten Welt zugrunde, die wir ja verändern wollen. Mit anderen Worten haben die Krise der Zivilisation und die Verzweiflung über die Krise einen gemeinsamen Ursprung.
Man könnte sagen, dass die Verzweiflung, die uns überkommt, wenn wir erkennen, dass die Techniken der Separation nicht helfen, die Krise der Separation zu überwinden, ein Zeichen ist, ein Zeichen dafür, dass das Zeitalter der Separation vollendet wird: Wir geben verzweifelt auf, und etwas Neues wird möglich. Die alte Geschichte ist endgültig ans Ende ihrer Erzählung gelangt, und es öffnet sich ein freier Raum, in dem eine neue Geschichte entstehen kann.
Das ist nicht möglich, solange in der alten Geschichte immer noch Hoffnung liegt. Solange noch irgendetwas aus Sicht der alten Welt »Zweckmäßiges« Erfolg verspricht, heißt das, dass die alte Geschichte noch immer Leben in sich hat. Deshalb haben Prophezeiungen über den nahen Weltuntergang wie die von Guy McPherson einen Wert. Unwiderlegbar innerhalb ihrer eigenen Grundannahmen, zerstören sie jede Hoffnung innerhalb dieser Grundannahmen, die für die eingeengte Perspektive auf das stehen, was im Rahmen der Geschichte der Separation möglich ist.
Jetzt schlage ich aber nicht vor, dass wir uns von allem distanzieren, was in der alten Geschichte sinnvoll ist, nur weil es zur alten Geschichte gehört. Die neue widerlegt die alte nicht, sondern schließt sie ein und hebt sie auf. Mein Standpunkt ist vielmehr, dass die Aufgabe, die vor uns liegt, unmöglich ist, wenn wir uns auf diese Dinge beschränken. Jedes Bemühen, die Welt zu verändern, scheint aussichtslos naiv für die Verzweifelten oder die, die nahe daran sind, zu verzweifeln.
Jenseits der Verzweiflung liegt ein weites Land, eine neue Geschichte von der Welt, die ein radikal anderes Verständnis von Ursache und Wirkung hervorbringt, aber dieses Land ist von der hiesigen Seite aus unsichtbar, obgleich wir gelegentlich flüchtige Blicke darauf werfen und Vorahnungen davon erhaschen. Aus dieser Perspektive ist unsere Lage ganz und gar nicht hoffnungslos.
Woher kommen unsere Vorstellungen von Zweckmäßigkeit, Realismus und Kausalität? Aus der Physik. Die Geschichte der Separation und das von ihr geschaffene Programm der Kontrolle bricht nicht nur auf der individuellen und kollektiven Ebene zusammen, weil es immer weniger Wirkung hat, weil unsere Krisen unser Vertrauen in die Welt-erschaffenden Mythen erschüttern; während all dies geschieht, zerfallen auch die wissenschaftlichen Fundamente der Separation. Diese tief greifenden Paradigmenwechsel erlauben eine andere Vorstellung über die Natur des Selbst, des Universums und daher auch darüber, wie Dinge geschehen und was zweckmäßig ist. Diese Entwicklungen auf dem neuesten Stand der Physik, Biologie und Psychologie sind immens wichtig für die Art und Weise, wie wir uns als soziale, ökonomische und politische Wesen verhalten. Das sind nicht nur interessante Kuriositäten. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass keine Bewegung, die die Welt verändern möchte, erfolgreich sein kann, wenn sie sich nicht auf diese grundlegenden Paradigmenwechsel stützt.
Das ist zuerst der Zusammenbruch der neo-darwinistischen Sichtweise, nach der genau definierte DNA-Sequenzen, genannt Gene, durch zufällige Mutation und Selektion entstanden sind, welche die Lebewesen im Wesentlichen darauf programmieren, ihr reproduktives Eigeninteresse zu maximieren. Jetzt erfahren wir, dass diese Beschreibung nur in einem engen Bereich zutrifft; Makroevolution findet nicht durch zufällige Mutation statt, sondern eher durch symbiotische Verschmelzung, durch den Erwerb fremder DNA-Sequenzen und dadurch, dass die Organismen ihre eigene DNA schneiden, spleißen und rekombinieren. Sie findet auch durch zelluläre und epigenetische Vererbung statt. Dass auf genetischer Ebene also ein atomisiertes und abgetrenntes, sein Eigeninteresse maximierendes Selbst gar nicht existiert, macht eine wichtige metaphorische Grundlage für unsere alte Geschichte vom Selbst zunichte. Das genetische Selbst hat fließende Grenzen. Es ist eine Chimäre, die im andauernden Austausch von DNA und Information mit anderen Organismen und der Umwelt steht. Nicht, dass es keine Grenzen des Selbst gäbe; aber diese Grenzen sind veränderbar, und das Selbst innerhalb dieser Grenzen ist ebenso veränderbar.
Zudem lehrt uns die Ökologie, dass sich Arten nicht nur zu ihrem eigenen genetischen Vorteil entwickeln (der an sich schwer zu definieren ist, wenn Lebewesen ihre eigenen Gene umgestalten können), sondern dass sie sich auch entwickeln, um den Bedürfnissen anderer Arten und dem Ganzen zu dienen. Das wäre keine Überraschung für naturnahe Kulturen, die wussten, dass jedes Lebewesen einzigartige und notwendige Eigenschaften hat, aber die Wissenschaft ist erst in der letzten Generation zu diesem Verständnis gekommen: beispielsweise zu der Erkenntnis, dass, wenn eine Art ausstirbt, das ganze Ökosystem um genau diesen Verlust anfälliger wird. Es ist nicht so, dass es der Rest dann besser hat, weil ein Konkurrent weniger da ist. Der Vorteil jedes Einzelnen ist der Vorteil aller.
Eine noch gravierendere Anfechtung der alten Geschichte von der Welt ist die Quantenrevolution in der Physik. Über achtzig Jahre ist sie jetzt alt, und trotzdem ist sie den wissenschaftlichen Thesen aus den vorhergehenden Jahrhunderten und unserer dominierenden Geschichte von der Welt so fremd, dass wir sie bis heute furchtbar kontraintuitiv und »schräg« finden. Ich zaudere, dieses Territorium zu betreten, weil die inflationäre Verwendung des Begriffs »Quanten-«, um damit allerlei zweifelhaften Ideen und Produkten ein wissenschaftliches Mäntelchen umzuhängen, das Wort beinahe bedeutungslos gemacht hat. Trotzdem verletzen die Quantenphänomene derartig die Basis von »Zweckmäßigkeit«, wie ich sie beschrieb, dass eine kurze Erklärung angebracht ist. Bitte seien Sie sich im Klaren, dass ich die Quantenmechanik nicht als einen Beweis für irgendeine Behauptung in diesem Buch hernehme, sondern mich vielmehr auf einer mythisch-poetischen Ebene als Quelle für Inspiration und als Metapher auf sie berufe.
Ein Grundprinzip des newtonschen Universums ist, wie oben dargelegt, dass Dinge nicht ohne eine Ursache »einfach passieren«. (Etwas muss sie verursachen.) Doch in der Quantenwelt stimmt das einfach nicht. Quantenteilchen wie Photonen oder Elektronen sind nicht vollkommen determiniert durch die Gesamtheit der Kräfte, die auf sie einwirken, sondern sie verhalten sich zufällig. In ihrer Gesamtheit kann man die Wahrscheinlichkeitsverteilung ihres Verhaltens berechnen, aber für jedes einzelne Photon reicht eine vollständige Berechnung aller physikalischen Einflüsse, die auf es einwirken, nicht aus, um sein Verhalten vorherzusagen. Das Photon A könnte durch den Spalt gehen und hier landen; das Photon B könnte dort landen – warum? Es gibt keinen Grund, keine Ursache; deswegen nennt die Physik dieses Verhalten zufällig. Hier, an der eigentlichen Basis für unsere Erklärung der physikalischen Realität, herrscht Nicht-Kausalität. Die Dinge können geschehen, ohne dass irgendeine Kraft sie verursacht.
Die obige Beschreibung steht, wenn auch entsprechend vereinfacht, außer Zweifel; die Physiker versuchten neunzig Jahre lang, den Determinismus zu retten, und sie sind gescheitert. Die Situation hat sich seit dem Protest von Einstein, Gott würfle nicht mit dem Universum, nicht gebessert. Die Physik konnte die Unbestimmtheit nicht im Ganzen beseitigen, also musste sie sich damit begnügen, sie im Mikrokosmos sicher zu verstecken: Das zufällige Verhalten der Quanten addiert sich in seiner Gesamtheit annähernd zu dem deterministischen, kausalen Verhalten der menschlichen Welt, in der wie zuvor nichts geschieht, ohne dass dafür eine Kraft verantwortlich ist.
Warum fliegt ein Photon hierhin und das andere dorthin, wenn sie nicht durch eine Kraft gezwungen werden? Warum tun Sie eine Sache eher als eine andere, wenn Sie nicht durch eine Kraft gezwungen werden? Sie entscheiden sich. Also wäre die offensichtliche intuitive Antwort, dass auch das Photon seine Flugbahn selbst wählt. Die Physik kann eine solche Antwort gewiss nicht billigen, die so weit jenseits der wissenschaftlichen Denkweise liegt, dass sie nicht einmal mehr lachhaft ist. Die Physik – und denken Sie daran, die Physik gehört zum Fundament unserer Geschichte von der Welt, zu dem, was real, was zweckmäßig ist, und wie die Dinge funktionieren – besagt stattdessen, dass das Verhalten »zufällig« ist. Damit bewahrt sie um den Preis der Nicht-Kausalität die Vorstellung von einem Universum aus austauschbaren Bausteinen ohne Bewusstsein. Denn etwas so Bescheidenem wie einem Photon oder Elektron eine Wahlmöglichkeit zuzuschreiben, würde heißen, das Universum als ein durch und durch intelligentes anzuerkennen. Das Universum bestünde dann nicht mehr nur aus Klumpen von Materie; wir könnten uns nicht mehr so ungeniert die Rolle seines Herrn und Meisters anmaßen. Das Hauptprojekt unserer Geschichte von den Menschen wäre in seinen Grundfesten erschüttert.
Machen wir hier eine kurze Pause, um festzuhalten, dass die meisten Menschen, die je auf Erden gelebt haben, kein Problem damit hätten, zu glauben, dass das Universum durch und durch intelligent ist. Die vorneuzeitlichen Menschen, die Animisten und Panentheisten schrieben allem Seienden ein Empfindungsvermögen zu, nicht nur den Pflanzen und Tieren, sondern sogar den Steinen und Wolken. In unserer eigenen Gesellschaft tendieren kleine Kinder dazu, das auch zu tun. Wir nennen das Personifizierung oder Projektion und meinen, besser zu wissen als die Kinder und Animisten, dass das Universum eigentlich überwiegend ein toter, empfindungsloser Ort ist.
Aber vielleicht ist es Ihnen nicht recht, dass Ihr Zugriff auf die erweiterte kreative Kraft davon abhängen soll, dass Sie die Idee akzeptieren, selbst Elektronen könnten empfinden. Also gut, ich will nicht darauf bestehen. Zumindest ist hier ein Bereich, wo Krafteinwirkung nicht die Ursache für Verhalten ist. Darüber hinaus stellt die moderne Physik noch eine zweite, vielleicht sogar noch schwerwiegendere Herausforderung an die Geschichte von der Separation: den Zusammenbruch der grundlegenden Unterscheidung zwischen eigen und fremd.
Wir sind an ein Universum gewöhnt, in dem sich Existenz vor dem Hintergrund eines objektiven kartesianischen Koordinatensystems aus Zeit und Raum abspielt. Wenn etwas existiert, dann nimmt es den Punkt X;Y;Z in der Zeit t ein, und diese Existenz ist unabhängig von Ihnen, mir oder sonst einem Wesen im Universum. Selbst wenn wir von der Unschärferelation oder von verschränkten Quanten wissen, ist die Annahme von Objektivität so tief in unserer Wahrnehmung verankert, dass es lächerlich wäre, sie zu bestreiten. Sagen wir, Sie gehen zu Bett, bevor die Wahlergebnisse veröffentlicht werden. Am nächsten Morgen erwachen Sie. Wer hat gewonnen? Sie wissen es zwar noch nicht, aber Sie würden nicht bestreiten, dass die Entscheidung schon gefallen ist, dass es Tatsachen gibt, die unabhängig von Ihrem Wissen existieren. Oder sagen wir, Sie untersuchen einen Verkehrsunfall. Alle am Unfall Beteiligten erzählen eine andere Version dessen, was passiert ist. Würden Sie bestreiten, dass es eine Realität gibt (das, was »wirklich« passiert ist), die unabhängig von den Darstellungen ist?
Ich würde mich keineswegs zu diesen ontologischen Spitzfindigkeiten versteigen, wäre da nicht die Tatsache (die Tatsache!), dass die alte unzutreffende Geschichte vom Sein, vom abgetrennten Selbst, das in einem ihm äußerlichen objektiven Universum treibt, ein Patentrezept für Ohnmacht und Verzweiflung ist. Abgeschnitten von der Welt kann nichts, was wir tun, wirklich viel bewirken. Im riesigen unkoordinierten Trubel der getrennten Selbste und unpersönlichen Kräfte, aus denen sich das Universum zusammensetzt, hängt unser Vermögen, den Lauf der Dinge zu ändern, davon ab, wie viel Kraft wir versammeln (oder inspirieren, wenn die anderen nur auf uns hörten. Und weil sie von uns getrennt sind, liegen ihre Entscheidungen außerhalb unserer Kontrolle – außer wir zwingen sie, uns zuzuhören. Und schon sind wir wieder bei der Anwendung von Gewalt). Diese Geschichte entwertet besonders die meisten kleinen persönlichen Gesten der Unterstützung, die wir auf der emotionalen Ebene als wichtig empfinden und die diese Welt kennzeichnen, in der wir gerne leben würden.
In der Welt der Separation wäre es zum Beispiel Zeitverschwendung, wenn Sie ehrenamtlich in einem Hospiz helfen, einen verlorenen Welpen retten oder einem Obdachlosen Essen geben, wenn Sie eigentlich die Welt verändern, die Klimaerwärmung bremsen oder Meeresschildkröten retten wollen. Diese alte Frau wird ohnehin sterben. Was spielt es für eine Rolle, wenn ihre letzten Tage ein wenig tröstlicher verlaufen? Vielleicht hätten Sie die Stunden besser damit zugebracht, junge Leute zu unterrichten, um ihnen ökologisches Bewusstsein beizubringen.
Unsere Entscheidungen auf Basis ihrer berechenbaren, messbaren Effekte zu treffen gehört an sich schon zur Geschichte von der Separation. Wir könnten das Instrumentalisierung nennen. Sie gründet auf der Vorstellung, dass die Kausalität vollkommen ist – dass wir mit ziemlicher Sicherheit alle Auswirkungen vorhersagen können. Diese Gewissheit verliert jedoch zunehmend ihre Berechtigung. Die Wissenschaft hielt diese Vorstellung zwar noch eine Zeit lang aufrecht, indem sie die Unbestimmtheit der Quanten dem Mikrokosmos zuschrieb, die volle Bedeutung der nicht-linearen Dynamik, durch welche Ordnung aus dem Chaos entsteht, ignorierte und jegliche Phänomene abstritt, die für ein intelligentes, wechselseitig verbundenes Universum sprechen, aber heute wird es immer schwieriger, dieses Gebäude aufrechtzuerhalten.
Selbst wenn das angestrebte Ziel ein hehres ist, schneidet uns eine instrumentalistische Denkart von anderen Quellen des Wissens und der Orientierung ab, die nur innerhalb einer anderen Geschichte vom Selbst und von der Welt sinnvoll sind. Und das kann monströse Folgen haben. Wer weiß, wen oder was wir »für die ›Sache‹« opfern müssen?
Orwell thematisierte das in »1984«, als O’Brien, der Parteifunktionär, vorgibt, Winston für die revolutionäre Bruderschaft gewinnen zu wollen, die »Die Partei« stürzen will:
»Sie sind bereit, Ihr Leben zu opfern?«
»Ja.«
»Sie sind bereit, einen Mord zu begehen?«
»Ja.«
»Sabotageakte zu begehen, die vielleicht den Tod von Hunderten von unschuldigen Menschen herbeiführen?«
»Ja.«
»Ihr Land an Feindmächte zu verraten?«
»Ja.«
»Sind Sie bereit, zu betrügen, zu fälschen, zu erpressen, die Gesinnung von Kindern zu verderben, süchtigmachende Rauschgifte unter die Leute zu bringen, die Prostitution zu ermutigen, Geschlechtskrankheiten zu verbreiten – alles zu tun, was dazu angetan ist, einen Verfall herbeizuführen und die Macht der Partei zu untergraben?«
»Ja.«
»Wenn es zum Beispiel irgendwie unseren Interessen dienlich sein sollte, einem Kind Schwefelsäure ins Gesicht zu schütten – sind Sie dazu bereit?«
»Ja.«
Damit zeigt Orwell, dass sich Winston in Wahrheit durch nichts von der Partei unterscheidet, wenn es darum geht, ein abstraktes und unerreichbares Ziel über alle Mittel zu stellen. Bezeichnenderweise ist die Bruderschaft ein von der Partei erfundenes Konstrukt; sie ist die Partei.
In ähnlicher Weise, nur vielleicht subtiler, sind die modernen Kämpfer für das Soziale oder die Umwelt, wenn sie menschliche Werte für ihre Sache opfern, überhaupt keine echten Revolutionäre, sondern das Gegenteil: Sie sind Stützen des Systems. Immer und immer wieder sieht man innerhalb von Umweltorganisationen oder linken politischen Gruppen, dass die Untergebenen genauso schikaniert werden, sieht man die gleichen Machtkämpfe und die gleichen egoistischen Rivalitäten wie überall sonst auch. Wenn das in unseren Organisationen geschieht, wie können wir dann hoffen, dass es nicht auch in der Welt ausgelebt werden wird, die wir schaffen, falls wir uns durchsetzen können?
Manche Gruppierungen haben das erkannt und wenden viel Zeit für Gruppenprozesse auf, um innerhalb ihrer eigenen Organisation jene egalitären, inklusiven Ziele umzusetzen, die sie in die Gesellschaft einbringen möchten. Hier besteht die Gefahr, dass sich die Gruppe nur noch um sich selbst dreht und keine nach außen gerichteten Ziele mehr erreicht. Viele Occupy-Gruppen machten diese Erfahrung, aber diese Bemühungen, neue Organisationsprinzipen und Konsensmethoden auszuarbeiten, sind ein Zeichen für die zunehmende Erkenntnis, dass innen und außen eins sind. Es geht nicht einfach darum, die eigene Tugendhaftigkeit zu demonstrieren, indem man egalitär oder einbeziehend miteinander umgeht. Wer wir sind und wie wir miteinander umgehen, ist entscheidend dafür, was wir gemeinsam schaffen – darum geht es.