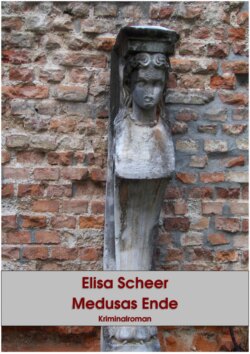Читать книгу Medusas Ende - Elisa Scheer - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 MO, 20.10.2003
ОглавлениеSobald der letzte trödelnde Neuntklässler das Zimmer verlassen hatte (Timo, wer sonst?), schloss ich die Tür ab und schleppte mich die drei Stockwerke hinauf ins Lehrerzimmer. Diese Schule war wirklich der reinste Turm, und natürlich gab es keinen Aufzug. Den hätten die Schüler auch im Handumdrehen kleingekriegt.
Sechs Stunden Unterricht und dazwischen Pausenaufsicht – ich wusste nach sechs Wochen Arbeit am Albertinum noch nicht, wer hier den Stundenplan machte, aber dass er mir nicht freundlich gesonnen war, war eindeutig. Oder er hatte sich gesagt Drücken wir´s der Neuen aufs Auge, die traut sich schon nicht, sich zu beschweren.
Recht hatte er! Ich traute mich wirklich nicht. Ich traute mich ja auch kaum, zu fragen, wenn mir ein Ablauf nicht klar war. Nach den ersten drei pampigen Antworten war schon deutlich geworden, dass die meisten Kollegen es nicht gerade schätzten, wenn jemand Neues, Junges, Unerfahrenes kam.
Nett waren hier eigentlich nur die Schüler, überlegte ich, während ich versuchte, so zu atmen, dass ich nicht dem Herzinfarkt nahe das Lehrerzimmer betreten musste. Und dieser etwas abgehobene Chef, aber der wusste wohl gar nicht, was an seiner Schule so abging. Und Frau Thiemig, die mich ab und zu angrinste. Der Rest mochte mich nicht. Scheißegal, dachte ich wütend, ich mochte die alle auch nicht. Und wenn das so blieb, würde ich eben einen Versetzungsantrag stellen.
Im Lehrerzimmer herrschte Hochbetrieb – die einen packten ein, die anderen aus, für den Nachmittagsunterricht in der Kollegstufe, und alle jammerten, wie furchtbar undiszipliniert und denkfaul die Schüler gewesen waren. Zu solchen Stunden merkte man, dass das Zimmer zu klein war – ursprünglich für fünfzig Leute ausgelegt, musste es jetzt fast siebzig beherbergen. Leute wie ich, die zu spät gekommen waren, hatten keinen Anteil am großen Tisch in der Mitte, sondern konnten froh sein, wenn ihnen ein Stuhl in der Ecke zugestanden wurde. So einen Stuhl hatte ich auch. Er wackelte, aber als Ablage für Bücher genügte er. Jetzt allerdings lagen die Bücher auf dem Boden und der Stuhl war weg. Typisch! Ich setzte mich neben die Bücher auf den Boden und begann, meine Schultasche, den Jutebeutel und die Plastiktüte so einzuräumen, dass ich im Bus damit zurechtkommen würde. „Soll das ein Sit-in werden?“, fragte mich jemand. Ich sah auf. Der blöde Wallner natürlich!
„Nein“, antwortete ich knapp.
„Warum wälzen Sie sich dann auf dem Boden herum?“
„Ich wälze mich nicht, ich hatte nur nach sechs Stunden Unterricht das Bedürfnis, mich einen Moment hinzusetzen. Aber wenn das hier auch verboten ist...“ Ich stand mit betonter Leidensmiene auf und packte in gebückter Haltung weiter ein.
„Seien Sie doch nicht so albern!“ Das würdigte ich keiner Antwort mehr. Der Kerl hatte doch sowieso immer was zu meckern! Frau Thiemig feixte und kam näher. „Hat man Ihnen den Stuhl geklaut?“
„Ja“, seufzte ich. „Wahrscheinlich war er heiliges Eigentum von irgendjemandem. Und auf dem Boden sitzen darf man auch nicht, das passt dem Wallner nicht. Wie man hier in einer Freistunde etwas arbeiten soll, ist mir echt ein Rätsel.“
„Mir auch. Ich hab ja auch keinen eigenen Platz, aber ich kann mich wenigstens in die Chemie-Vorbereitung verkriechen. Da stinkt es zwar fürchterlich, aber man hat wenigstens seine Ruhe.“
„Buttersäure?“, erinnerte ich mich an meine eigene Schulzeit.
„Nö, die Zigarren vom Bremml. Aber was will man gegen den Fachbetreuer schon machen!“
Von den meinen hatte ich noch nicht viel gesehen. Ich hatte sowohl in Deutsch als auch in Geschichte das Protokoll der Fachsitzung geschrieben, aber Hilfestellung hatten sie mir nicht geleistet. Nein, das war ungerecht – in Deutsch hatte ich einen hektographierten (!) Zettel bekommen, auf dem in wegrutschender Schreibmaschinenschrift stand, welche Schulaufgaben in welcher Klasse in welcher Reihenfolge geschrieben werden sollten. In Geschichte gar nichts. Da musste ich wohl auf die Anschisse warten, wenn meine ersten Arbeiten respiziert waren...
Learning by doing war hier anscheinend die Devise und Wenn wir Sie ignorieren, ist alles in Ordnung. Das erinnerte mich ein bisschen an den Mann meiner Freundin Silvia. So wie sie ihn zu beschreiben pflegte, bedeutete stummes Hineinschaufeln, dass das Essen okay war.
Vielleicht war das normal und nur ich blöde Kuh erwartete, dass man auf mich zukam, mich lobte (wofür?) und mir sagte, wie man sich freue, mich in der Mannschaft zu haben. Das war hier doch kein Volleyballspiel!
Heute Nachmittag sollte ich mal Leonie anrufen. Die war nach München versetzt worden: ob es bei ihr genauso lief? München – ein reizvoller Gedanke, aber ich hätte mir dort nie eine Wohnung leisten können, ich krebste hier ja schon am Existenzminimum herum. Vielleicht hatte Leonie nicht so viele Schulden angehäuft wie ich.
Die Übungsaufsätze der fünften Klasse passten zwar in den Jutebeutel, aber die Hefte der Neunten überforderten mich. Wieso hatte ich auch gleich über sechzig Übungsaufsätze schreiben lassen? Gleichzeitig? Geniales Timing! Sicher war es Vorschrift, aber nicht so. Eigene Blödheit. Die Hefte mussten eben noch in die Plastiktüte und die beiden Bücher in die Schultasche. Und der Bildband – den brauchte ich heute Nachmittag nicht so dringend, den konnte ich in mein Postfach stecken und beten, dass er morgen noch da war. Nein, der kriegte hier garantiert Beine, und er war ziemlich teuer gewesen, ein Nachkaufen konnte ich mir nicht leisten.
Ein Schränkchen hatte ich genauso wenig wie einen Anteil am Tisch, es gab eben auch nur fünfzig Schränkchen. Bei den Postfächern hatten sie mal einfach eine Reihe obendrauf gesetzt, man erkannte es an der unterschiedlichen Holzfarbe. Ich sah den Bildband verzweifelt an.
Frau Thiemig kam wieder zu mir. „Soll ich Ihnen eine Tüte leihen?“
„Das wäre toll“, antwortete ich erleichtert. „Ich kann den Schmöker ja nirgendwo hier lassen, also muss ich ihn mitschleppen.“
„Ich hätte auch noch Platz in meinem Fach“, bot sie mir an und ich hätte sie umarmen mögen. „Das wäre natürlich noch besser. Ich hab ja schon drei Taschen dabei.“
Frau Bernrieder kam vorbei und musterte uns missvergnügt. „Schlechte Organisation?“ Frau Thiemig bekam schmale Augen. „Wenn man Material für den Unterricht mitbringt und in dieser Bruchbude nirgendwo einen Platz hat, wo man es lassen kann, ohne dass es geklaut wird, ist das wohl keine Frage der persönlichen Organisation!“
Die Bernrieder sah uns von oben herab an. Ganz schöne Leistung, wenn man kein bisschen größer war als wir! „Alles ist eine Frage des persönlichen Missmanagements. Na, sogar Sie werden es eines Tages noch lernen, Frau Prinz.“ Damit segelte sie davon und ich starrte ihr mit offenem Mund nach. „Was heißt denn sogar Sie? Bin ich so bescheuert, dass es sogar hier noch auffällt?“ Ich schlug mir auf den Mund. „Oh, Entschuldigung – ich wollte damit nicht sagen, dass das hier weniger auffallen würde, weil - “
Die Thiemig grinste. „Keine Sorge. Die Idiotenquote ist hier wirklich auffallend hoch. Aber Sie kriegen das alles bestimmt schneller auf die Reihe als manch anderer. Wenn es Sie tröstet – die meisten sind so stinkig, weil sie Angst vor den Schülern haben und total fertig sind.“
„Ich finde, die Schüler sind die einzig netten hier“, antwortete ich verwundert und nicht gerade taktvoll, aber sie lachte bloß. „Ich auch! Kann ich Sie übrigens irgendwohin mitnehmen?“
„Ich glaube nicht“, antwortete ich voller Bedauern. „Ich wohne in Selling, und da müssen Sie garantiert nicht hin.“
„Nein, aber ich kann da vorbeifahren. Los, kommen Sie schon! Sie wollen doch nicht ernsthaft diesen ganzen Krempel zum Bus schleppen, oder?“
„Das mach ich doch jeden Tag, ich bin es schon gewöhnt.“
„In diesem Beruf braucht man ein Auto. Meinetwegen alt und klapprig, Hauptsache, es hat eine Rückbank. Jetzt kommen Sie schon!“
Ich fügte mich, gar nicht so ungern. Frau Thiemig fuhr einen nagelneuen Golf und ich konnte einen Anflug von Neid nicht unterdrücken. Einmal ein eigenes Auto haben! „Haben Sie – ach was, hast du überhaupt schon Gehalt gekriegt?“, fragte sie, als sie vom Parkplatz fuhr. „Ich heiße übrigens Nadja.“
„Eva“, antwortete ich dankbar. „Nein, aber man hat mich schon gewarnt, dass das ein Vierteljahr dauern kann.“
„Aber du hast doch eine Planstelle? Dann müsste es eigentlich schneller gehen.“ Ich seufzte. „Ich hab mal bei der Bezügestelle angerufen, aber die waren bloß ehrlich überrascht, dass ich nicht umsonst arbeiten will. Ob ich keine Rücklagen hätte? Ob meine Eltern mir nicht helfen könnten?“
Nadja schnaubte und setzte den Blinker. „Das ist so was von typisch! Schuften lassen sie einen, aber wenn man auch mal was essen will, soll man bei den Alten schnorren. Weißt du, warum die das machen?“
„Schikane?“, vermutete ich, durch Erfahrung gewitzt.
„Ja, das sowieso – aber vor allem legen die das Geld, das sie dir nicht zahlen, gut an und kassieren Zinsen. Und du zahlst für den Dispo, ohne Ende.“
„Tue ich seit Jahren“, gestand ich. „Ich hab schon das Studium nur mit Schulden hingekriegt. Eltern! Meine Mutter hat gar nicht daran gedacht, mich nach dem Abi noch durchzufüttern, und bei diesen Blödeljobs im Studium wirst du doch wirklich nicht reich.“
„Stimmt. Wenn es dich tröstet: Sobald das Gehalt mal läuft, kannst du dir durchaus ein menschenwürdiges Leben leisten. Wohnung, Auto, regelmäßige Mahlzeiten, ab und an ein Buch oder ein Duschgel. Wahrscheinlich kriegst du um Weihnachten rum einen ganzen Batzen als Abschlagszahlung und zahlst ein Vermögen an Steuern. Mach bloß im Januar gleich deine Steuererklärung, damit du die Kröten zurückkriegst! Da vorne links, oder?“
„Genau. Die Gegend haut einen nicht um, aber die Wohnung ist ganz günstig.“
„Wer schaut denn schon auf die Gegend! Bloß Leute, die sich dann in einem vornehmen Vorort langweilen. Ich finde Selling so schlecht nicht, ich hab hier selbst mal gewohnt.“
„Aber du bist weggezogen, als du genug verdient hast?“
„Ja, weil ich eine größere Wohnung haben wollte, möglichst drei Zimmer. Und hier gab´s nichts, was mir gefallen hätte. Bloß eine mit Ofenheizung, und für solchen Stress hab ich keine Zeit. Wie jetzt?“
„An der zweiten rechts, und das Möchtegern-Hochhaus ist es. Das Legohaus.“
„Da wohnst du? Wie sind da die Wohnungen?“
„Winzig. Aber ideal für arme Leute, sie sind ziemlich komplett möbliert. Geschnitten wie ein billiges Einzelzimmer im Hotel, aber mit Bett, Schrank, Tisch, Kühlschrank und Bad. Man braucht bloß noch einen Wasserkocher und die Sache ist geritzt.“ Nadja lachte. „Bescheidene Ansprüche!“
Ich zuckte die Achseln. „Sachzwänge. Aber man gewöhnt sich an alles, und für das Geld bekäme ich in München nicht mal ein Bett in der Jugendherberge.“ Vor dem Eingang ließ sich mich mit all meinen Tüten und Taschen aussteigen. „Irgendwann musst du mir die Wohnung mal zeigen. Und du kommst mich auch mal besuchen“, schlug sie zum Abschied vor.
In direkt heiterer Stimmung lief ich den Plattenweg entlang und drückte auf den Liftknopf. Hatte ich jetzt so etwas wie eine Freundin im Kollegium gefunden? Hatte sie mich sechs Wochen lang beobachtet und dann beschlossen, gnädig zu sein? Oder hatte ich ihr Leid getan, weil solche Übelkrähen wie die Bernrieder oder dieser doofe Wallner immer auf mir herumhackten?
Egal, Hauptsache, ich hatte mal Ansprache. Der Schulleiter kümmerte sich offenbar um gar nichts, und der Stellvertreter kannte zurzeit nur eine Sorge: Wo nehmen wir weitere Räume her?
Ich fuhr in den fünften Stock, trabte den Gang entlang und schloss meine Tür auf, die wie alles in diesem Stockwerk in einem unbeschreiblichen Lachsrosa prangte. Die Farbzwänge hier waren gewöhnungsbedürftig – man merkte, dass dieses Haus in den Siebzigern das Allerschickste gewesen war, bunt und pflegeleicht.
Meine Wohnung war wirklich winzig, aber geschickt geschnitten. Im Flur waren rechts zwei Schränke eingebaut, die einiges fassten. Natürlich weiß mit lachsrosa Griffen. Links ging es in ein enges, lachsrosa gekacheltes Duschbad, aber es gab immer heißes Wasser in beliebiger Menge. Wenn ich da an früher dachte, an die Klagen meiner Kommilitonen über ihre verkalkten Boiler... Geradeaus kam das Zimmerchen. Links ein schmales Bett mit angenehm harter Matratze, rechts zwei niedrige Regale und ein Schränkchen, in dem sich ein kleiner Kühlschrank verbarg. Geradeaus, unter dem Fenster mit Blick auf weitere Häuser, kahl werdende Bäume und in der Ferne den Stadtring, der Schreibtisch, jungfräulich leer.
Na, das ließ sich ändern! Ich wuchtete vierunddreißig Fünftklasshefte und einunddreißig Neuntklassmappen auf den Tisch und ärgerte mich wieder über meine schlechte Planung: Bis morgen konnte ich unmöglich fünfundsechzig Aufsätze korrigiert haben!
Vor allem, wenn mich jetzt schon wieder tiefe Lustlosigkeit überkam. Außerdem fiel mir ein, dass ich morgen in der 11 b in Geschichte unbedingt ein Ex schreiben sollte. Dann hatte ich ja noch mehr zu tun! Und die Stunden für morgen hatte ich auch noch nicht vorbereitet. Im Seminar hatte ich völlig andere Klassen gehabt, so dass ich praktisch wieder bei Null anfangen musste, was einen besonders freute, wenn man wusste, dass ein neuer Lehrplan kam und die meisten Materialien, die man bastelte, keine lange Lebensdauer haben würden.
Zwei Uhr war es jetzt. Was war am dringendsten? Ich studierte mutlos meinen Stundenplan: Wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das alles machte, hätte ich mir wenigstens andere Fächer gesucht! Drei Deutschklassen, darunter einen Grundkurs (den hatte ich auch noch nie gehabt), das war wirklich ekelhaft viel zu korrigieren. Aber morgen war ein schöner Tag, fast nur Geschichte! Dann musste ich die Neuntklassmappen heute noch gar nicht machen. Wenigstens nicht fertig machen. Okay, drei Hefte und dann würde ich über das Ex in der 11 b nachdenken. Attische Demokratie... was sollte ich fragen? Nein, erst die Hefte! Unsinn, zuerst mal was zu essen!
Ich strich mir ein Leberwurstbrot und füllte den Wasserkocher. Eine Thermoskanne voller Himbeertee war garantiert das Richtige. Und dann würde ich mit den Heften anfangen, ganz bestimmt.
Es war eine mühsame Arbeit, die allerersten Arbeiten der Fünftklässler strotzten vor Aufbaufehlern und einer mehr als kreativen Rechtschreibung. Auch der Gebrauch von Satzzeichen, den wir doch geübt hatten, war so fehlerhaft, dass ich an meiner Arbeit zu zweifeln begann. Hatte ich den Kleinen so wenig beigebracht? Lieber Himmel, wie mochte dann erst die Schulaufgabe ausfallen! Eine passende Bildergeschichte brauchte ich dafür auch noch. Erst nach den Allerheiligenferien, beruhigte ich mich und griff nach dem nächsten Heft.
Nach vier Heften hatte ich endgültig die Lust verloren und schon über eine Stunde gebraucht. Wenn das so weiter ging, musste ich morgen mit den Kindern etwas anderes machen, für die Besprechung ihrer Machwerke war ich noch nicht bereit.
Ich angelte das Geschichtsbuch und meine Unterlagen aus dem Regal neben dem Tisch und überlegte, was ich morgen fragen konnte. Sie sollten die Organe der attischen Demokratie unseren heutigen Gewalten zuordnen... nein, sie brachten die Gewalten ja doch bloß durcheinander. Gerade deshalb! Das war Grundwissen, ermahnte ich mich und schrieb die Frage auf.
Warum hatte sich die Demokratie als Staatsform langfristig nicht halten können? Das hatten wir ausführlich besprochen. Was versteht man unter Diäten? Wehe, einer schrieb Schlankheitskuren! Was sind Metöken? Und was hielten meine Elftklässler vom exklusiven attischen Bürgerrecht? Was machte ich, wenn sie das gut fanden, weil da nicht so viele Ausländer mitreden konnten? Einen Grundsatzvortrag über die Dummheit solcher Parolen halten? Es taktvoll übergehen? Das musste ich eben riskieren. Ich glaubte nicht, dass sie absichtlich Blödsinn schreiben würden, dazu hatten sie viel zu viel Angst um ihre Noten. Obwohl, so ein Ex – das zählte eigentlich nicht allzu viel. Ich schloss meinen etwas altersschwachen Laptop (vor vier Jahren aus einer Konkursmasse günstig geschossen) an, steckte den Drucker ein und fuhr alles hoch.
Als ich die Angabe getippt und nach einigen Verbesserungen so formuliert hatte, wie ich es an der Seminarschule gelernt hatte, druckte ich sie und fand sie schön. Ich verstaute sie sorgfältig in einer Plastikhülle. Hoffentlich war morgen der Kopierer nicht wieder kaputt.
Die nächsten drei Aufsätze brachten mich wieder zum Ächzen und zu der Frage, warum ich nichts Anständiges gelernt hatte, Friseuse zum Beispiel. Da würde ich doch wenigstens bezahlt! Sieben Stück geschafft, noch nicht einmal ein Viertel – und die hilflose Heftführung zu korrigieren, kostete auch Zeit. Welche Fehler die Kleinen von der Tafel abschrieben! Im Seminar kriegte man nie eine fünfte Klasse, also war man darauf auch nicht vorbereitet.
Morgen hatte ich auch noch die 9c, die 7 d und den Grundkurs in Geschichte... Ich suchte mir Material und ein paar Ideen für den Stundenaufbau über die Verfassung des Kaiserreichs zusammen, steckte die Mappe in die Tasche, quälte mich wieder durch zwei Hefte, rechnete aus, dass ich jetzt über ein Viertel korrigiert hatte, fischte eine fertige, wenn auch grottenlangweilige Stunde über die Grundherrschaft aus meinem Seminarordner, ackerte die nächsten beiden Hefte durch (elf! Mehr als zehn! Fast schon ein Drittel!), suchte nach einem Blatt über die Geschichte der SPD (auch im Kaiserreich), fand es nicht mehr und schrieb es neu, füllte eine Druckkopie mit dem aus, was sich die Kollegiaten selbständig notieren sollten und nahm mir das nächste Heft vor.
Draußen wurde es schon dämmerig, und mir knurrte bereits wieder der Magen. Toll, es war schon fast sechs Uhr, in einer Stunde wäre es dunkel. Und ich hatte gerade mal die Vorbereitungen für morgen geschafft (und das nicht einmal besonders gründlich oder originell) und zwölf Hefte durch. Zwölf von vierunddreißig war schon nicht besonders, aber zwölf von fünfundsechzig – das waren ja nicht einmal zwanzig Prozent! Ich arbeitete wirklich zu langsam, andere schafften das bestimmt in der halben Zeit. Noch vier Stunden, dann musste ich ins Bett. Ich hatte weder mein Konto kontrolliert, ob vielleicht eine freundliche Abschlagszahlung eingegangen war, noch gewaschen – und langsam hatte ich nicht mehr viel anzuziehen, vor allem nicht mehr viel Unterwäsche, weil ich das ganze Wochenende mit den Vorbereitungen für heute, mit einem langen Telefonstreit mit meiner Mutter und mit einer ziemlich notwendigen Putzaktion verbracht hatte, wenn ich nicht gerade geschlafen hatte. Wie müde einen das Unterrichten machte! Noch zwei Hefte, dann konnte ich mir einen Sack Wäsche zusammensuchen, beschloss ich.
Vierzehn! Ich kramte Unterwäsche, T-Shirts und Sweatshirts zusammen, warf auch die Handtücher dazu, in denen schon wieder Make-up-Spuren hingen, suchte mir eine Waschpulvertablette und zwei Euro heraus, quälte mich durch das Heft Nr. 15 und fuhr in den Keller, wo die Maschinen natürlich alle besetzt waren. Also trug ich mich für acht Uhr abends ein und fuhr wieder nach oben.
Frust.
Die zwei Euro würden mir anderswo sicher fehlen, aber waschen musste ich schließlich. Ich hatte noch – nein, erst Heft 16! Heft 16 wies zwar ordentliche und orthografisch korrekte Einträge auf, aber die arme kleine Annika hatte die Bildergeschichte nicht verstanden. Was sollte ich jetzt Einfühlsam-Kritisches hinschreiben, damit sie ihren Fehler erkannte, aber nicht sofort entmutigt wurde? Ich kaute am Rotstift und dachte nach, während es draußen immer dunkler wurde. Endlich hatte ich die passende Beurteilung zusammengebastelt und konnte das Heft zuklappen. Fast die Hälfte - es war aber auch schon fast sieben Uhr. Ich konnte unmöglich weiterhin fast eine Stunde pro Heft veranschlagen, dann wurde ich ja nie fertig.
Gut, noch ein oder zwei, dann durfte ich meinen Kontostand checken. Ich schaffte gerade mal ein Heft (Hurra, immerhin die Hälfte!), dann rief Silvia an.
Mit Silvia war ich zur Schule gegangen. Nach dem Abitur, während ich bei der Einschreibung in der Uni Schlange stand, hatte sie sich als Au-pair-Mädchen nach Paris verzogen. Ich hatte mich damals gewundert, weil mir nie aufgefallen war, dass sie besonders kinderlieb gewesen wäre. Aber sie schrieb glückliche Karten über ihr Leben in einer riesigen Familie in einem besseren Vorort von Paris, irgendwo am Bois de Boulogne, kam nach einem Jahr zurück und war fest entschlossen, auch eine große, glückliche Familie zu gründen. Am besten sofort. Meine Frage, wie es denn mit einer Berufsausbildung aussehe, wurde als irrelevant beiseite gewischt. Kinder, viele Kinder, das war wahre Weiblichkeit. Meine nächste Frage, nämlich wer ihr diesen Quatsch eingeredet habe, führte zu einer gewissen Entfremdung.
Mittlerweile war sie - genau wie ich – achtundzwanzig, verheiratet und Mutter von drei Kindern; Annabelle war sieben, Corinne fünf und Noel zwei. Ich fand die Namen ziemlich affig – vor allem der Kleine würde in der Schule einiges zu hören kriegen. Wie konnte man denn auch das ganze Jahr „Weihnachten“ heißen!
Silvia war auf gerade unverschämte Weise glücklich, mit dem perfekten Mann, den perfekten Kindern, dem perfekten Eigenheim mit perfektem Garten, von der perfekten Bank perfekt finanziert. Beruf hatte sie keinen gelernt, aber sie hatte ja ihren Manfred. Manfred war allerdings eine ziemlich sichere Bank; die Idee, dass dieser Langweiler eines Tages mit einer Jüngeren oder Interessanteren durchgehen konnte, war lachhaft.
Sie berichtete mir zuerst von den klugen Aussprüchen ihrer Kinder, von Annabelles Status als Klassenbeste und zugleich hübschestes Mädchen auf dem Klassenfoto, von Corinnes zahllosen kleinen Verehrern im Kindergarten und der Tatsache, dass Noel schon in ganzen Sätzen sprach. Ich bekundete die erwartete Bewunderung und fragte, wie es ihr selbst denn ging.
„Mir? Na prima natürlich. Und dir? Ist was Passendes aufgetaucht?“
Ich lachte. „Ein Mann? Glaubst du, dafür habe ich momentan Zeit und Geld? Wenn ich dich daran erinnern darf – ich habe gerade eine Planstelle angetreten!“
„Selber schuld. Ich sag dir, wenn man zu Hause bleibt, hat man das schönste Leben. Man kann sich alles selbst einteilen, kreativ sein, sich verwirklichen...“
„Wenn einen dauernd die Kinder unterbrechen?“
„Wieso, vormittags ist doch bloß der Kleine da. Und der kann sich schon sehr nett mit sich selbst beschäftigen. Da habe ich Zeit, Weihnachtsgeschenke zu basteln. Und das Haus zu dekorieren.“
Ich unterdrückte ein abfälliges Schnaufen. Grässliche Vorstellung! Aber das konnte daran liegen, dass ich an Manfred und drei kleine Manfreds dachte, und das reizte mich nun weniger.
„Dass deine Mutter dich gar nicht drängt?“, fuhr Silvia fort. „Ich meine, sie ist doch nun sicher auch in einem Alter, wo sie von Enkeln träumt.“
Göttlich! „Meine Mutter? Die ist knapp achtundvierzig, und ihr letzter einschlägiger Vortrag hatte zum Thema, dass ich mir ja nicht so wie sie mit einem Kind das Leben versauen soll.“
„Was? Großer Gott, wie herzlos! Das ist ja geradezu traumatisierend! Ihr solltet mal eine Familientherapie machen. Manfreds Eltern hab ich das auch empfohlen, und die sind jetzt wieder richtig glücklich miteinander.“
„Bei uns hilft das nichts. Ich hab kein Interesse an einer innigen Mutter-Tochter-Beziehung, und meine Mutter auch nicht. Silvia, nicht jeder steht auf Familienglück.“
„Doch. Manche geben es bloß nicht zu, weil sie das uncool finden oder glauben, dass sie ohnehin niemanden abkriegen. Eva, du siehst doch richtig nett aus! Wenn du dich ein bisschen herrichtest... und kochen kannst du doch auch... ich glaube, ich wüsste da schon den Richtigen für dich. Hartmut, ein Kollege von Manfred. Sichere Position, kinderlieb – und schaut eigentlich ganz nett aus. Ein bisschen kahl vielleicht, aber man sagt ja, dass solche Männer ihre Qualitäten haben.“ Sie kicherte anzüglich.
Ich grinste über Silvias matten Versuch, zweideutig zu werden. „Lass stecken. Ich brauch im Moment wirklich keinen Mann, ich wüsste echt nicht, wann ich für den Zeit haben sollte. Du, Silvia... hier stapeln sich die Hefte, ich muss die heute noch durchkriegen. War nett, mal wieder von dir zu hören. Wenn ich ein bisschen Luft habe, dann treffen wir uns mal wieder.“
„Unbedingt! Du hast die Kinder ja schon so lange nicht mehr gesehen, du wirst staunen!“
„Bestimmt“, heuchelte ich Begeisterung und verabschiedete mich. Danach starrte ich eine Zeitlang untätig vor mich hin. Mann und Kinder statt der Quälerei mit diesem Kollegium? In der Schule stand mir nicht einmal ein Stuhl zu, bei einem Mann hätte ich eine eigene Küche... nein, trotzdem nicht. So scharf war ich nicht auf Hausarbeit, und mit Kindern konnte ich mir auch noch etwas Zeit lassen. Erst einmal richtig in dieser Schule anerkannt sein!
Energisch machte ich mich über Heft 18 her und schaffte sogar noch Nummer 19, bevor ich mir doch meinen Kontostand anschaute. Deprimierend! Natürlich war kein müder Cent eingegangen, nur einiges abgebucht worden. Und der Kontostand lag bei 3.864 Euro und ein paar Zerquetschten. Im Minus, das verstand sich von selbst.
Noch von einer kurzen Phase nach dem ersten Examen, in der ich einen ebenso lukrativen wie anstrengenden Job in einer Werbeagentur gehabt hatte, lag mein Disporahmen bei viertausend Euro. Erstens hatte ich diese Grenze schon fast erreicht und zweitens würde es ewig dauern, das wieder abzuzahlen.
Ich nahm mir einen Zettel und rechnete herum. Schätzungsweise Ende November würde ich eine Abschlagszahlung bekommen. Gehalt für zweieinhalb Monate... vielleicht siebentausend brutto, sie würden mehr als die Hälfte als Steuern einbehalten, also vielleicht drei netto... Wenn ich, wie Nadja es mir geraten hatte, sofort im Januar meine Steuererklärung machte, bekam ich vielleicht tausend Euro im Spätsommer zurück (schließlich wollten die ja erst noch daran was verdienen). Schätzungsweise würde ich ab Dezember eineinhalb tausend Euro im Monat kriegen, oder? Als Referendarin hatte ich achthundert verdient, und eine Studienrätin musste doch etwas mehr bekommen, vermutete ich. Miete... zweihundertfünfzig. Krankenversicherung wohl genauso. Sonstige Nebenkosten vielleicht zweihundert. Dann blieben mir noch etwa achthundert übrig. Davon musste ich leben und meine Schulden bezahlen.
Im Moment kam ich ganz gut mit fünf Euro am Tag aus. Gut, zweihundert im Monat. Blieben sechshundert übrig. Fünfhundert sollte ich zur Abzahlung verwenden, dann wäre ich etwa im Juli auf Null. Und für hundert vielleicht einen Sparvertrag, einen sicheren Fonds oder so etwas.
Dann könnte ich am Schuljahrsende im Plus sein und ein Vermögen von rund dreihundert Euro besitzen. Nach dem nächsten Schuljahr hätte ich schon fünfzehnhundert. Und ich könnte etwas üppiger leben.
Ja, sehr nett, aber zum einen sollte ich jetzt endlich das nächste Heft aufschlagen, und zum anderen brauchte ich bis Ende November auch noch etwas Geld. Der Bank konnte ich keine Storys mehr erzählen, und bei der Bezügestelle wurde ich doch nur angeschnauzt, weil ich nicht kostenlos arbeiten wollte.
Ich musste etwa fünfhundert Euro auftreiben. Sparbücher besaß ich schon längst keine mehr, und andere Wertsachen? Ein bisschen Schmuck, noch von der Firmung her. Wahrscheinlich war das Zeug gar nichts wert, aber bevor ich mich an Zinsen dumm und dämlich zahlte... Irgendwo war noch der kunstvoll verzierte Zuckerlöffel von Tante Rotraut. Ich suchte im Schrank herum und fand ihn schließlich in meinem winzigen Schmuckkasten, zusammen mit einem kitschigen Kreuz, das ich ohnehin nie tragen würde, und zwei goldenen Ringen mit winzig kleinen Saphir- und Diamantsplittern.
Morgen würde ich nach der Schule mal zu diesem Gold An-und Verkauf gehen. Vielleicht war der ganze Kram doch wenigstens einen Hunderter wert? Und die beiden Bildbände über China und Brasilien... vielleicht gab es für jeden noch einen Fünfer?
Es war mittlerweile fast acht; ich packte meinen Wäschesack und fuhr nach unten. Bis die Maschine fertig war, musste ich wenigstens die nächsten drei Hefte geschafft haben, nahm ich mir vor, als ich das Zweieurostück einwarf.
Verdammt, woher konnte ich noch Geld bekommen?
Da mich diese Frage deutlich mehr beschäftigte als die Erzähltechnik meiner 5 c, brauchte ich tatsächlich die ganze Stunde, um in den Heften wenigstens bis zweiundzwanzig zu kommen. Mittlerweile war ich auch so müde, dass ich gar nicht mehr unterscheiden konnte, was im aktuellen Heft stand und was die anderen Kinder geboten hatten. Und immer wieder kehrende Fehler („er kamm“ zum Beispiel) übersah ich schon, weil ich mich daran gewöhnt hatte.
Entnervt warf ich den Rotstift hin und fuhr hinunter, die Wäsche holen. Sobald sie auf dem Gestell hing, das nun das letzte bisschen Platz in meinem Zimmer beanspruchte, riss ich mich zusammen. Los, ich hatte schon fast zwei Drittel! Und Hunger, leider. Na gut, ein schrumpeliger Apfel war noch da – man sollte ja abends nicht so schwer essen. Für schweres Essen hatte ich wirklich kein Geld – einen Vorteil hatte meine Finanznot also, ich hatte schon zwei Kilo abgenommen und war jetzt wirklich toll dünn.
Bis sechsundzwanzig kam ich noch, dann schlief ich fast am Schreibtisch ein. Zerschlagen fuhr ich aus dem Dösen wieder hoch und beschloss, ins Bett zu gehen. Vielleicht schaffte ich die übrigen acht ja noch morgen früh, schließlich hatte ich in der ersten Stunde frei. Wenn ich ganz früh aufstand und mich gleich an die Arbeit machte...