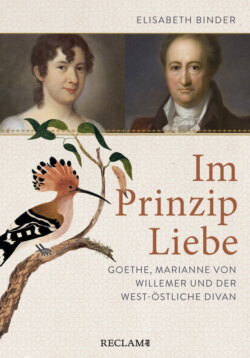Читать книгу Im Prinzip Liebe. Goethe, Marianne von Willemer und der West-östliche Divan - Elisabeth Binder - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kurz vor der Weltschöpfung
ОглавлениеDieses »deutsche Herz« war zur selben Zeit, da Hafis sich seiner bemächtigte, noch mit einem anderen »Großmeister« beschäftigt, den man nicht unbedingt mit Goethe in Beziehung bringen würde, der aber für den poetischen Schub, den die Hafis-Lektüre in ihm auslöste, bedeutungsvoll gewesen sein dürfte.
Der andere war: Johann Sebastian Bach, auch er einst, als Kapellmeister, im Dienst der Weimarer Herzöge. Seine frühen geistlichen Kantaten schrieb er für die Schlosskirche in Weimar, die sogenannte »Himmelsburg«. Dass diese Kantaten dort später noch aufgeführt wurden, ist allerdings unwahrscheinlich, zumal der Komponist sich im Unfrieden von seinen Brotgebern getrennt hatte. Goethe jedenfalls, ohnehin kein Kirchgänger, scheint Bach bis dahin kaum gekannt zu haben. Doch in diesem speziellen Frühling wurde ihm dessen Klaviermusik zu einer Offenbarung.
Es war in dem kleinen, zum Herzogtum Sachsen-Weimar gehörenden, eine Kutschenstunde von Weimar entfernten Ort Berka, nachdem man dort schwefelhaltige Quellen entdeckt hatte, zu einem mäßig frequentierten Badeort avanciert, wohin sich Goethe im Mai 1814 für mehrere Wochen zurückzog. Zusammen mit seiner Frau Christiane und deren jungen Gesellschafterin Caroline Ulrich, im Familienkreis Uli genannt, die in diesen Wochen auch als Schreiberin für ihn arbeitete. Eine Nähe, die über die gewohnte häusliche Vertrautheit hinausging, scheint bei der Zusammenarbeit und in dem sonst ereignislosen Ort entstanden zu sein.
Indessen war gerade diese Weltabgeschiedenheit in dem Augenblick genau das Richtige: »In Berka hier ist es so still und friedlich, als wenn seit hundert Jahren, und hundert Meilen weit kein Kriegsgetümmel existierte. Der Tag ist so lang, dass er manchmal langweilig wird, und dies […] ist der poetischen Erfindung sehr günstig.« So Goethe am 18. Mai 1814 an Heinrich Meyer, der aus seinem Schweizer Refugium unterdessen wieder nach Weimar zurückgekehrt war.
Doch sogar in dem verschlafenen Berka war das »Zentrum der Welt«, war Rom anwesend. Und zwar im Hotel, wo Goethe mit seiner kleinen Entourage wohnte, dem von der Ilm umspülten Edelhof: »In dem weiten Vorsaal wanderte man nach Tisch oder an Regentagen auf und ab, der große Plan von Rom [schon vor Goethes Ankunft von Christiane aus dem Wohnhaus am Frauenplan, wo er im Treppenhaus hing, hierhergebracht] bildete den einzigen Schmuck.«
Hier also, in diesem römisch bestückten Umfeld, begann Goethe, unterstützt von Uli, an der Italienischen Reise zu schematisieren und zu schreiben. Was erstaunlich ist nach so langer Zeit. Aber doch einleuchtend, da er offensichtlich nach dem Abschluss des dritten Teils von Dichtung und Wahrheit in der richtigen Stimmung war, seinen Lebensdarstellungen weiter zu folgen.
In dieser Stimmung war er nach der Rückkehr aus Italien, im Jahr 1788, nicht gewesen. Zwar dachte er noch in Italien an eine baldige Veröffentlichung seiner Reiseberichte. Doch in der missmutigen Laune nach der Rückkehr hatte er jede fruchtbare Beziehung zu seinem »Reise-Journal« verloren. So schrieb er damals an Herder nach Italien: »Die Abschrift meines Reise-Journals gäbe ich höchst ungern aus Händen; meine Absicht war, sie ins Feuer zu werfen […]. Es ist im Grunde sehr dummes Zeug, das mich jetzt anstinkt.«
Doch in diesem Frühling 1814 war er jener Person, die den Aufbruch nach Italien wie eine »Wiedergeburt« erlebte, offensichtlich wieder nahe. So schrieb er am 29. Januar 1815 an Heinrich Carl Eichstädt: »Schon seit einem halben Jahr habe ich den vierten Band [von Dichtung und Wahrheit], welcher ohngefähr bis zur Hälfte gediehen war, plötzlich liegen lassen um nicht völlig zu stocken, zehn Jahre übersprungen, wo das bisher beengte und beängstigte Natur-Kind in seiner ganzen Losheit wieder nach Luft schnappt, im September 1786 auf der Reise nach Italien.«
Zur gleichen Zeit aber, wo die italienischen Erinnerungen in ihm wieder einen gedeihlichen Boden finden, erreichten ihn beide und beinah gleichzeitig: Mohammed Schemsed-din Hafis und Johann Sebastian Bach. Ersterer, wie gesagt, ein Geschenk seines Verlegers Cotta, der ihn von der Rückreise aus Leipzig am 18. Mai in Berka auch besuchte. Dazu Goethe in den Annalen 1815:
Schon im vorigen Jahr waren mir die sämtlichen Gedichte Hafis’ in der von Hammerschen Übersetzung zugekommen, und wenn ich früher den hier und da in Zeitschriften übersetzt mitgeteilten einzelnen Stücken dieses herrlichen Poeten nichts abgewinnen konnte, so wirkten sie doch jetzt zusammen desto lebhafter auf mich ein, und ich musste mich dagegen produktiv verhalten, weil ich sonst vor der mächtigen Erscheinung nicht hätte bestehen können. Die Einwirkung war zu lebhaft […]. Alles, was dem Stoff und dem Sinne nach bei mir Ähnliches verwahrt und gehegt worden, tat sich hervor, und dies mit umso mehr Heftigkeit, als ich höchst nötig fühlte, mich aus der wirklichen Welt, die sich selbst offenbar und im Stillen bedrohte, in eine ideelle zu flüchten, an welcher vergnüglich Teil zu nehmen meiner Lust, Fähigkeit und Willen überlassen war.
Für Johann Sebastian Bach aber gab es in Berka selbst einen Experten. In der Person des Badeinspektors Schütz, auch »Sumpfkönig« genannt, der zugleich Organist war und einen schönen Hammerflügel, ein sogenanntes »Wiener Klavier« besaß. Von diesem offenbar außergewöhnlichen Klavierspieler, dem berühmten Forkel in Göttingen und ersten Bach-Biographen nur wenig nachstehend, wie es heißt, ließ sich Goethe jeden Abend eine Stunde lang »Bachische Sonaten und Fugen« (so der Ausdruck) vorspielen. Wobei gewöhnlich auch Goethes Freund, der Komponist Carl Friedrich Zelter, der ihn in Berka besuchte, zugegen war. Auch die Gespräche müssen sich anschließend öfter um Bach gedreht haben, da Zelter, mit Felix Mendelssohn zusammen, als erster die geistlichen Vokalwerke Bachs, die Passionen und Motetten, wiederentdeckte und mit seiner Berliner Sing-Akademie zur Aufführung brachte. In den Annalen bemerkte Goethe später dazu: »Musikalische Aufmunterung durch Zelters Gegenwart und durch Inspektor Schützens Vortrag der Bachischen Sonaten.«
Plastischer ist Zelters unmittelbarer Bericht: »Von dieser Fleischkuppel, woran die biegsamsten Finger hängen, lässt sich Goethe alle Abende eine Stunde lang vorspielen, legt sich jedoch vorher zu Bette, indem er behauptet: man müsse der Bachschen Musik nicht merken lassen, dass man zuhöre, da sie für sich selbst musiziere; andere Musik, meinte der seltsame Mann, setze gern Zuhörer voraus, vor denen sie erscheine, um gewisse Serviteurs und Bücklinge zu machen.«
An diese Berkaer Abende mit Johann Sebastian Bach erinnerte sich Goethe noch viele Jahre später in einem Brief an Zelter:
[…] denn dort war mir zuerst, bei vollkommener Gemütsruhe und ohne äußere Zerstreuung, ein Begriff von eurem Großmeister geworden. Ich sprach mir’s aus: als wenn die ewige Harmonie sich mit sich selbst unterhielte, wie sich’s etwa in Gottes Busen, kurz vor der Weltschöpfung, möchte zugetragen haben, so bewegte sich’s auch in meinem Innern und es war mir als wenn ich weder Ohren, am wenigsten Augen, und weiter keine übrigen Sinne besäße noch brauchte.