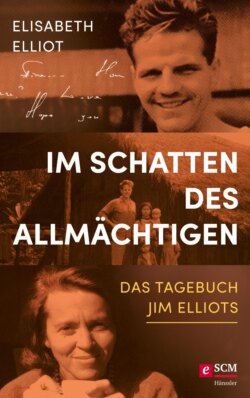Читать книгу Im Schatten des Allmächtigen - Elisabeth Elliot - Страница 10
REDNER UND ALTWARENSAMMLER
ОглавлениеAls Jim auf die Polytechnische Oberschule in Bensan kam, wählte er als Hauptfach architektonisches Zeichnen. Die Schulzeitung war durchsetzt von seinen Leitartikeln, auch von Berichten über sein Auftreten als Star in verschiedenen Schulaufführungen. Ein Lehrer, der bei einer dieser Aufführungen Regie führte, sagte: »Einen so begabten Amateurschauspieler habe ich noch nie gehabt. Nach der Aufführung haben einige der anderen Lehrer mir zugeredet, ich müsse Jim unbedingt dazu ermutigen, zum Theater zu gehen.«
Er stand auch in dem Ruf, der beste Redner von Bensan zu sein. Anlässlich von Präsident Roosevelts Tod bekam er wenige Stunden vorher die Mitteilung, er solle eine Rede vorbereiten für eine besondere Versammlung, die für den Nachmittag anberaumt war. Einer seiner Lehrer erklärte nachher: »Er hielt die beste Rede, die ich von einem Schüler je gehört habe – und eine der besten, die ich überhaupt von irgendjemandem gehört habe.«
Auch Jims Volksschulkamerad Dick Fisher war auf die Schule in Bensan gekommen. Über seine Eindrücke von Jim erzählt er Folgendes:
»Ich selbst war lang und dünn. Jim war etwas kleiner, hatte aber eine gute Figur und braunes Haar und sah gut aus – die Mädchen schauten ihn immer zweimal an. Was ich am meisten an ihm bewunderte, war sein scharfer Verstand. Er begriff äußerst rasch, sowohl im Unterricht als auch sonst, während ich immer einen Kilometer hinter ihm zurückblieb.
Er versuchte dann, mir die Dinge in ganz einfachen Ausdrücken zu erklären …
Nach der Physikstunde hatten wir Zeichnen, und das Klassenzimmer war ungefähr fünf Häuserblocks entfernt. Mitten durch die Schule zu kurven auf überfüllten Korridoren, und zwar in den fünf Minuten bis zum nächsten Schellen, war nicht einfach. Ich sehe Jim noch vor mir, wie er sich schiebend und drängend seinen Weg bahnte mit vorgestrecktem Kinn, ein Bild an Zielstrebigkeit.
Auf seinen Schulbüchern hatte er obenauf meistens eine kleine Bibel liegen, und es brauchte nur zwei oder drei Zuhörer, damit er sie aufschlug und zu reden anfing. Vor dem Mittagessen betete er immer, und er ließ keine Gelegenheit verstreichen, mit mir über Jesus Christus zu sprechen und ob ich an den Himmel, die Hölle, das künftige Leben glaube und so weiter. Wenn er für eine Zusammenkunft eine Rede vorbereiten musste, zog er mich in ein leeres Zimmer, trug mir seine Rede vor und verlangte von mir ein kritisches Urteil. Anfangs lachte ich so sehr, dass er außer sich geriet, doch im Laufe der Zeit entwickelte er die richtige Vortragsweise, wuchtig und donnernd (sehr geeignet zum Wachhalten der Hörer).
Als die Rationierungen der Kriegszeit sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuwirken begannen, gingen Jim und ich dazu über, beim Nachhauseweg von der Schule per Anhalter zu fahren. Wir sparten dadurch nicht nur täglich einen Groschen, sondern hatten auch mehr Zeit, uns zu unterhalten und die großen Dinge dieser Welt zu erörtern. Eines Abends erzählte Jim mir von seiner Absicht, Präsident zu werden – ein Gedanke, mit dem er sich eine Zeit lang ganz im Ernst befasste.
Einmal nahm mich Jim nachmittags mit nach Hause zu seiner Familie. Bei diesem ersten Besuch fiel mir vor allem auf, wie viele Pflichten Jim zu Hause hatte und wie planvoll und methodisch er die Arbeiten erledigte. Er musste Hühner, Ziegen und Kaninchen füttern, die Heizung anzuwerfen, den Hof in Ordnung bringen, die eine oder andere Besorgung machen. Im Nu hatte er mich angewiesen, einen Teil der Arbeiten zu übernehmen; Jims Führerfähigkeiten machten immer weitere Fortschritte.
Jim und Dutch (Werner Durtschi) interessierten sich für Fußball, und nach längeren Diskussionen brachten sie auch mich dazu, mitzumachen. Jim spielte als Verteidiger. Im Fußballdress, kommt mir immer vor, habe ich nie etwas derart Komisches gesehen wie ihn. Er erinnerte mich an einen großen Elch mit X-Beinen, der gerade aus dem Wasser kommt. Der einzige Ruhm, auf den er in der Mannschaft Anspruch erheben konnte, war, dass er viel mehr Dreck auf seinem Gesicht anzusammeln verstand als alle anderen.
Jim wollte unbedingt mit Dutch und mir eine Zelttour machen. Nach verschiedenen Gängen zu den Altwarenhändlern am Hafen zwecks Einkauf von Ausrüstungsgegenständen fuhren wir an einem Freitagnachmittag nach der Schule per Anhalter los. Zu dritt sah man uns dastehen, Jim, Dutch und mich, jeder mit einem Gepäcksack und einer Flinte mit einer leeren Konservenbüchse obendrauf, um den Regen abzuhalten – für jeden Autofahrer eine verwegen aussehende Gesellschaft. Wir hielten immer eine Gebetsgemeinschaft, ehe wir auf eine Campingtour gingen, und ich dachte oft: Wenn wir einen Schutzengel hatten, dann musste er bei uns recht viel auf den Beinen sein, und sehr viel Schlaf bekam er nicht.
Uns drei zusammen hätte keiner mitgenommen, deshalb versteckten zwei sich im Gebüsch, und der Dritte winkte. Einmal, als ein Wagen anhielt, liefen wir alle drei hin, und der Fahrer fragte: ›Wie viele sind es?‹, und wir sagten, dass wir nur zu dritt wären und außerdem sehr klein – wir brachten es auch fertig, uns noch hineinzuquetschen zu den vieren, die schon drinnen saßen.
Am nächsten Tag, als wir an einem Golfplatz entlanggingen, hörten wir eine Ente quaken. Wir liefen über die kurz geschnittene Rasenbahn. Jim ging vornedraus, und als er die Ente sah, jagte er ihr eine Kugel in den Steiß, aber dann versagte seine Flinte. Dutch feuerte hinter meinem Rücken, die Kugel ging über die Ente hinweg. Den nächsten Schuss gab ich ab, und ich traf das Tier im Flug, sodass es etwa fünf Meter vom Ufer im See landete. Jim nahm einen Stock und versuchte, es herauszufischen, da hörten wir von hinten einen Schrei, und als wir uns umdrehten, sahen wir eine Frau, die wie wild mit den Armen fuchtelte und etwas schrie von einer Lieblingsente. Uns wurde ziemlich mulmig, aber Jim war entschlossen, unseren Siegespreis herauszuholen, was ihm schließlich auch gelang, obwohl er dabei ziemlich nass wurde. Bis wir uns aus dem Staub machen konnten, war die Frau schon ziemlich nah herangekommen, ganz außer sich schrie sie ›Mörder‹ und heulte, und so setzten wir uns schnell in Bewegung, liefen wieder über den Rasenstreifen und auf eine schützende Hügelwelle zu. Wir kamen uns ein wenig grausam vor, aber wir hatten uns gedacht, jede Ente, die fliegen könne, sei eine Wildente und somit ein jagdbares Wild für uns; die gute Dame allerdings in ihrer Verzweiflung tat uns leid, und wir baten den Herrn, sie zu trösten. Ein anderes Mal, als wir versuchten, über einen Stacheldraht zu kommen, um einen Bussard aus der Nähe anzuschauen, den ich geschossen hatte, kam ich aus Versehen an den Abzug meiner Flinte. Der Schuss ging durch Jims Haare. Das hat uns eine Zeit lang ziemlich gedämpft.«
Jims älterer Bruder Bert betrieb ein einträgliches Geschäft als Altwarenhändler, bei dem sich Jim und Dick Fisher samstags beteiligten. Bert steuerte den Lastwagen, während die beiden Jüngeren oben auf der Ladung saßen und mit ausrangierten Neonröhren nach vorüberfliegenden Möwen schlugen oder die am Vormittag gesammelten Altwaren nach brauchbaren Dingen durchwühlten. Auf diese Weise brachten sie genügend Ziegelsteine zusammen, dass sie sich einen Bratrost im Freien bauen konnten, genügend alte Flaschen, um am Supermarkt für den Erlös eine stattliche Anzahl Fleischpasteten zu kaufen, und außerdem eine gut sortierte Kollektion von Gebrauchsgegenständen, unter anderem verschiedene Herde, ein Bett, Stühle, einen Bettvorleger aus einem kompletten Bärenfell mit Kopf und sogar eine Garnitur Leichensezierinstrumente, die Jim auf den Gedanken brachte, Unterricht im Ausstopfen zu nehmen. Unter seinen ersten ausgestopften Beutetieren befand sich eine Möwe, die er auf einer der Sammelfahrten zur Strecke gebracht hatte.
Wenn die beiden, schwer bepackt mit ganzen Ladungen von Flaschen, den Supermarkt betraten, um sie zu verkaufen, machten ihnen die, die an der Kasse Schlange standen, schleunigst Platz. Bei kaltem Wetter trug Jim eine Helmmütze mit herabbaumelnden wollenen Ohrschützern, eine Schaffelljacke mit Wollkragen, eine Überhose und alte Schuhe mit abgetretenen Hacken – und alles duftete nach der Ladung auf dem Lastwagen.
»Wir gingen meistens jeden Samstag zweimal hin«, erzählte Dick Fisher. »Die armen Mädchen an den Ständen waren nicht erfreut, wenn sie uns kommen sahen.«
»Später«, berichtete Fisher weiter, »begannen wir uns für die Frage der Sklaverei in Afrika zu interessieren. Während ich der Ansicht war, dass man Gewalt anwenden müsse, um die Sklaverei zu brechen, interessierte Jim sich mehr dafür, wie man die Frage missionarisch angehen könnte. Ich wies sofort auf die Gefahren von Kannibalensuppe hin (nach einem altmodischen Rezept besteht sie aus einem Teil Missionar auf hundert Teile Wasser); Jims Widerlegung dieses Einwandes war sein Vertrauen auf den Herrn, durch den, wie er sagte, im Laufe der Zeit viel mehr Menschen befreit worden seien als jemals durch Gewehre.
Jemand hatte Jim eine Sammlung von Gedichten geschenkt, und er fing an, Stellen aus bekannten Werken auswendig zu lernen. Immer, wenn ich in der Stadt war, ging ich ihn abends besuchen. Er saß dann an seinem Schreibtisch, und wenn ich hereinkam, fing er an mit ›Sprach der Rabe: Nimmermehr‹.
Ich hörte dann mit offenem Mund und staunend zu, wie er mit großartigem Gebärdenspiel die ganze Sache rezitierte.
Bei Frauen war Jim immer sehr auf der Hut, er fürchtete, sie seien nur darauf aus, einen Mann von seinen Zielen abzubringen. ›Männliche Wesen, die sich zähmen lassen, sind fürs Wagnis wenig brauchbar‹, sagte er warnend. Sooft eine junge Dame bei einer Geselligkeit zu freundlich wurde und ich anzubeißen schien, hörte ich eine leise Stimme neben mir: ›Nimm dich in Acht, Fisher, nimm dich in Acht!‹
Als ich von Portland fortgegangen war und in Washington im Ministerium arbeitete, schlug Jim vor, dass wir uns unsere Briefe in Gedichtform schreiben sollten, zwecks Vervollkommnung in Stil und Satzbau. Ich konnte bei Weitem nicht so gute Verse schreiben wie Jim, besaß auch keinen solchen Wortschatz, aber ich lernte von ihm so viel wie möglich. Dann beschloss ich, statt immer nur der Nehmende zu sein, ihm meinerseits auch etwas beizubringen. Ich besorgte mir ein Buch über die Sprache der Tschinuk-Ureinwohner und sandte ihm ein Exemplar. Wir fingen an und schrieben unsere Briefe in der Tschinuksprache. Auf diese Weise entgingen sie auch der Zensur.«
Während ihrer Zeit in Portland machten Fisher, Dutch und Jim gemeinsam Touren, und manchmal waren sie wochenlang unterwegs, ohne dass die Eltern wussten, wo sie steckten. Doch nicht immer ließ Jim sich überreden, diese Eskapaden mitzumachen, besonders wenn sie übers Wochenende gingen, denn er nahm seine Verantwortlichkeiten hinsichtlich des Gottesdienstes sehr ernst. Wenn sein Vater und Bert unterwegs waren, auf Evangelisationsfahrten in Arizona, fand Jim, dass er zu Hause sein sollte, um zu helfen, und dass er auch an den Sonntagsversammlungen teilnehmen sollte. Von solchen Fahrten schrieb sein Vater ihm oft Briefe; sie beeindruckten Jim sehr.
Fisher erzählt folgende Episode:
»Eines Freitagabends, als Jim und ich per Anhalter nach Hause fahren wollten, hatten wir ernste Schwierigkeiten, einen Wagen zu finden, der uns mitnahm. Da es regnete, standen wir am Eingang eines Ladens und liefen vor, sobald ein Auto ankam. An der Straßenecke war ein Stoppschild, und jeder Wagen musste anhalten. Nach einer Reihe falscher Alarme und leichter Verwirrung unsererseits kam ein älterer Herr angefahren. Während er nach links schaute, um zu prüfen, ob der Weg frei sei zum Überqueren der Hauptstraße, öffnete Jim die Wagentür – und wir saßen drinnen und hatten schon die Tür hinter uns zugemacht, bevor dem Fahrer aufging, was passiert war. Freundlich grinsend fragte Jim: ›Wie weit fahren Sie?‹ ›Sechzigste‹, stotterte der alte Herr. ›Das reicht für uns‹, sagte Jim, und wir fuhren mit bis zur Sechzigsten Straße, wo der Fahrer hielt und uns hinausließ. ›Vielen Dank für die Fahrt‹, sagte Jim, doch der alte Herr blickte drein, als ob er es sei, der mitgenommen worden war und sich zu bedanken hätte. Jim und ich konnten uns vor Lachen kaum noch halten, aber diesen Trick versuchten wir nicht wieder.«
Die Schuljungenstreiche lenkten Jim nicht von seinem Ziel ab, Gott zu dienen. Werner Durtschi, der Dritte im Bunde, erinnert sich an Folgendes:
»Eines Tages, kurz vor Jims letztem Schuljahr, sah ich ihn um den Sportplatz laufen und trainieren. Ich fragte ihn, wozu er das tue. Er sagte: ›Körperliche Übung ist für einiges nützlich.‹ Er kräftigte seinen Körper für die Strapazen des Missionarlebens.«
Ein anderer Klassenkamerad, Wayne McCroskey, erzählt:
»Jim und ich waren Mitglieder des Rednerklubs, dessen Satzung unter anderem besagte, dass man mit Ausschluss bestraft wird, wenn man eine zugewiesene rednerische Aufgabe nicht erfüllt. Der Klubvorsitzende gab uns während des Wahlkampfs Roosevelt – Dewey eine politische Rede auf, aber als Jim aufgerufen wurde, sagte er, er habe keine Rede. Der Vorsitzende machte ein besorgtes Gesicht, denn Jim war die stärkste Stütze des Klubs.
›Jim‹, sagte er, ›du kennst die Regeln. Wenn du keine Rede hältst, werde ich keine andere Wahl haben, als dich auszuschließen. Also komm schon. Vorbereitung hast du ja nicht nötig. Halt uns eine Stegreifrede über deinen Kandidaten.‹
Jim sah ihm genauso gerade in die Augen und sagte: ›Ich habe keinen bevorzugten Kandidaten, und ich halte auch keine Rede‹, und, indem er aufstand, ›es wird mir aber ein Vergnügen sein, dir die Gründe zu erklären, wenn du möchtest.‹
Dem Vorsitzenden ging mit einem Mal ein Licht auf. Jim hatte ihm von seiner Auffassung erzählt, wie er die Bibel verstehe – dass ein Jünger Jesu sich nicht an Krieg und Politik beteiligen könne. Verlegen erwiderte der Vorsitzende: ›Das ist nicht nötig, Jim. Ich glaube, wir alle verstehen deine Gründe, und ich verzichte auf die Einhaltung der Regel. Du bist entschuldigt.‹
Obwohl ich den gleichen Standpunkt vertrat wie Jim, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, meine Mitgliedschaft im Klub aufs Spiel zu setzen wegen eines so geringen Anlasses. Jims Haltung war die Haltung von Esther: ›Komme ich um, so komme ich um.‹«
Der Zweite Weltkrieg war während Jims Oberschulzeit schon im Gang, und obwohl er nie einen Stellungsbefehl bekam und daher nicht gezwungen wurde, sich offiziell als Kriegsdienstverweigerer zu bekennen, stand seine Meinung über diese Frage fest. Er war der Überzeugung, die Gemeinde Christi habe, im Gegensatz zur israelitischen Gemeinschaft in der Zeit des Alten Bundes, alle nationalen und politischen Bindungen abgelegt – in den Worten des Neuen Testaments: »Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten« (Philipper 3,20).
Jim war der Ansicht, dass der Grundsatz, den Jesus ein für alle Mal am Kreuz demonstriert habe, nämlich keinen Widerstand zu leisten, befolgt werden müsse, sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Leben.
Das Kriegsproblem gehörte zu denen, die er mit Klassenkameraden und Lehrern ausgiebig erörterte, und natürlich verringerten seine Ansichten seine Beliebtheit. Das Gleiche passierte, als er einen jungen chinesischen Prediger, Mun Hope, zu einer Schülerversammlung einlud. Der junge Chinese hielt vor dem gesamten Lehrkörper und sämtlichen Schülern eine unverfälscht biblische Predigt über Sünde und Gericht. Die beiden genannten Faktoren verdarben – nach dem Urteil von Fisher – Jims (ursprünglich beträchtliche) Chance, Klassenführer zu werden.