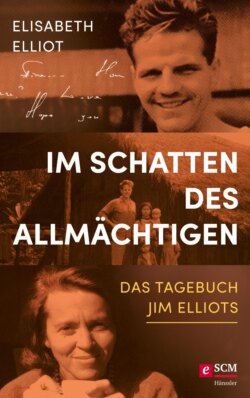Читать книгу Im Schatten des Allmächtigen - Elisabeth Elliot - Страница 12
Wheaton, Illinois 1945 –1949 AKADEMISCHER TITEL
ОглавлениеDie Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll; wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt.
1. Korinther 8,1-3
Mancher Student, der an die Universität kommt und ins College einzieht, hat keine klare Vorstellung, wozu er nun eigentlich da ist. Er soll, wie es verschwommen heißt, »Bildung erwerben«, aber das haben viele auch ohne Universitätsstudium getan, und viele sind zur Universität gegangen, ohne Bildung zu erlangen. Der Gedanke des Bildungserwerbs tritt dem neuen Studenten in einer verwirrenden Vielfalt von Formen gegenüber – Vorlesungsverzeichnis, Arbeitspläne, Aufnahmeprüfungen, feierliche Empfänge durch die Fakultät; der Wirbel der Einschreibungstage mit den Schlangen wild drängender Studenten, die sich für die ausgewählte Vorlesung eintragen wollen, bevor der Lautsprecher krächzend verkündigt, dass weitere Einschreibungen für »Einführung in die Geschichte« nicht mehr möglich sind; Lehrbücherverzeichnisse, Anmeldungen bei Professoren, die fürs Erste nur Namen sind, Pflichtfächer und Wahlfächer; die Stände der Gruppen und Organisationen; Gebühren für Sport, für chemische Laborplätze, Essensmarken, Zimmerschlüssel – all das ist in dem allgemeinen Ausdruck »Bildung« irgendwie mit eingeschlossen, und ein Student, auf dessen Werteskala die Aufnahme in die Gesellschaft und gesellschaftliches Ansehen ziemlich weit oben stehen, wird leicht in einen Strudel von außerlehrplanmäßiger Betriebsamkeit hineingezogen, von dem er oft nur mühsam wieder entkommt.
Als Jim Elliot im Herbst 1945 in das Wheaton College in Illinois einzog, lag sein Ziel klar vor ihm. Vor allem hatte er sich ganz Gott übergeben, und ihm war klar, wie viel Disziplin das unter anderem erfordern würde.
»Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat« (2. Timotheus 2,4).
Dadurch schieden viele Fragen und viele »gute Dinge« automatisch aus, um solchen, die seinen Plänen nützten, Platz zu machen. Die anderen Studenten, wenn sie kein fest umrissenes, zentrales Ziel hatten, verfolgten oft zu viele der Nebenziele, die sich anboten.
Diese Zielstrebigkeit war das, was seinen Mitstudenten besonders an ihm auffiel. Wenn manche meinten, er sei »einseitig«, weil er so offen über Christus sprach, fanden andere ihn aus dem gleichen Grund besonders »religiös« und wollten, dass er bei den Neueingetretenen »Gebetsleiter« würde. Jim ließ sich durch keine dieser Meinungen beeindrucken.
Jim war überzeugt, dass Gott ihn nach Wheaton geführt hatte. Er war nicht einfach deshalb hingegangen, weil sein Vater ihn geschickt hatte. Es gab niemand, der ihn »finanzierte«; Jim wusste nicht einmal, wo das Geld für sein Studium herkommen würde. Aber Gott belohnte dieses Vertrauen, und die nötigen Mittel kamen zusammen, teils durch einen Freund, teils durch ein Stipendium und eine Halbtagsstelle, sodass er im November schreiben konnte: »Diese Erfahrung mit dem Geld fürs Studium gehört zu denen, wofür ich Ihn unaufhörlich preisen kann für Seine ständige fürsorgliche Güte. Ihm sei Ehre und Dank.«
Seine Ernährung stellte er sorgfältig zusammen: frisches Obst und Gemüse, am liebsten roh; wenig stärkehaltige Sachen, wenig süße Nachspeisen. Er aß zwar zu schnell, aber keine großen Mengen; damit folgte er den Regeln für das Ringertraining und auch seinen eigenen Ideen zur Abhärtung des Körpers für die künftige Missionsarbeit.
Die einzigen Berichte, die wir über seine beiden ersten Studienjahre haben, stehen in seinen Briefen an die Familie. Neben sehr knappen Bemerkungen über das, was er so machte, waren sie stark durchsetzt mit Gedanken über die Ewigkeit und immer wieder auch mit guten Ratschlägen für eines der Geschwister; ein Beispiel dafür ist Folgendes, das er im Frühherbst dieses Jahres an seine Schwester Jane schrieb:
»Beginne jeden Tag mit stiller Bibellese und Gebet. Bunyan hat mit Recht gesagt: ›Entweder wird die Sünde dich von diesem Buch abhalten, oder dieses Buch wird dich von der Sünde abhalten.‹ Wenn du auf die Oberschule kommst, verteile unter denen, die du triffst, sofort biblische Traktate. Tu es ungeniert und von Anfang an, es ist leichter so, als wenn du versuchst, damit anzufangen, wenn du mit der Schule schon halb fertig bist. Lerne in der Trambahn Bibelstellen auswendig, nutze die Zeit! Sie ist kostbar, weil sie so schnell dahinfliegt. Das sind simple Wahrheiten, ziemlich abgedroschen, aber ich wünschte, jemand hätte sie auch mir gesagt, als ich damals mit der Oberschule anfing.
›Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet‹ (2. Timotheus 2,15).«
Jim stellte seinen Wecker jeden Abend so, dass er am nächsten Morgen Zeit zum Beten und zum Bibelstudium hatte. »In der Bibel«, schrieb er, »wird nie etwas zu ›altem, abgedroschenem Zeug‹, denn sie ist ja Christus in gedruckter Form, das ›lebendige Wort‹. Wir stehen morgens nie auf, ohne uns das Gesicht zu waschen, aber wir vernachlässigen oft die innere Reinigung durch das Wort des Herrn. Es weckt uns auf, damit wir unsere Verantwortung verinnerlichen.«
Eine der Früchte dieses ersten Jahres im College war eine neue Wertschätzung seines Elternhauses. Im Mai schrieb er:
»Das ist das Frühjahr meines neunzehnten Lebensjahres. Langsam ist mir die Erkenntnis gekommen, dass ich an diesem Punkt nicht angekommen bin dank meiner eigenen Anstrengungen noch durch den stetigen Lauf dieses leichtfüßigen Läufers, der ›Zeit‹, sondern durch das stille, unmerkliche Geführt-Werden von einer treuen Mutter und einem Vater-Prediger, der nicht so viel Zeit auf das Erziehen der Kinder anderer verwandt hat, dass er keine Zeit mehr gehabt hätte für seine eigenen.
In meinem Kalender steht ›Muttertag‹, und auch der ›Vatertag‹ ist nicht fern. Und so werden die Leute ein paar Stunden innehalten, um die zu ehren, für die an 365 Tagen im Jahr ›Kindertag‹ ist und die es nicht wagen, ihre liebevollen Anstrengungen um deren Ehrungen willen zu unterbrechen. In den Blumengeschäften wird großes Gewühl herrschen, ein Regen von Nelken wird niedergehen, und am Mittwoch darauf wird alles vergessen sein, bis ein weiterer Mai hereinbricht. Auch ich halte inne, wenn auch nicht mit Blumen, denn solche sind rasch welkende Gefühlsregungen, verglichen mit der unwandelbaren Treue elterlicher Fürsorge. Ich danke Euch und unserem Vater im Himmel, der uns geliebt hat mit unergründbarer Liebe.«
»Es ist ein nützliches Jahr gewesen«, schrieb er am Ende seines ersten Studienjahres, »ich bin meinem Erlöser nähergekommen und habe Schätze entdeckt in Seinem Wort. Wie wunderbar zu wissen, dass Christentum mehr ist als ein Stammplatz in der Kirche mit Kissen oder eine dämmerige Kathedrale, dass es eine wirkliche, lebendige, täglich sich erneuernde Erfahrung ist, die sich fortsetzt von Gnade zu Gnade. Und das Ziel, manchmal fern erscheinend, aber hell und unvergänglich, erstrahlt im Glanz der ›Sonne der Gerechtigkeit‹.«
Zu Beginn der Sommerferien trampte Jim nach Hause, und in einem Brief erzählte er seinem Bruder, was er dabei erlebt hatte:
»Am Montagabend, in Cedar Rapids, Iowa, tippelte ich mühsam ein längeres Stück zu Fuß, da kam ein Lastauto, ein neuer Studebaker, und gabelte mich auf. ›Wohin fahren Sie?‹, fragte ich. ›Kalifornien‹, erwiderte ein handfester Marinefeldwebel. Das Wort hatte eine gute Wirkung, es munterte mich auf und wärmte mir das Herz, und mir fiel Gottes Wort an Moses ein: ›Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen‹ (2. Mose 33,14). Amen, sagte ich im Geist. Dienstagmorgen legten wir uns im Wagen für drei Stunden schlafen, dann machten wir uns wieder auf den Weg, gondelten durch Nebraska und hatten um Mitternacht schon ein gutes Stück von Wyoming hinter uns. In Caspar, Wyoming, wohnte der verflossene Schwiegervater des Feldwebels, er hatte eine Kneipe dort. In deren Hinterzimmer schlief ich in Kleidern auf einem alten, muffigen Sofa. Zwei Eier und schwarzer Kaffee als Frühstück. Nachmittags, an der Gabelung der Straßen 30 N und 30 S, griff mich ein Kohlenlastzug auf und nahm mich bis Cokeville mit. Gottes Güte ist beständig. Bei Ihm ›ist keine Veränderung‹. Ein alter Buick hielt, der Fahrer war ein Matrose mit einer Kehle ›wie ein offenes Grab‹, wie es in Römer 3 heißt. Er war ein bisschen tattrig – das heißt, sein Wagen –, und wir mussten öfter anhalten, um zu tanken und Öl und Wasser nachzufüllen. Ich saß nachher am Steuer, als der Matrose schlief, und drei Meilen vor Boise kam von vorne plötzlich ein knirschendes Knacken. Ich weckte meinen grabkehligen Matrosen. ›Was ist das da für ein Geräusch?‹ fragte ich.
›…‹, sagte er, ›möchte ich auch wissen.‹ Wir schliefen bis um 6 Uhr morgens, dann schleppte uns ein Abschleppwagen in die Stadt. Der Matrose blieb bei seinem Wagen; ich blieb bei Straße 30. Landete in Portland um halb eins. Endergebnis:
20 Wagenwechsel, 70 Stunden Fahrzeit, 1,32 Dollar in der Tasche, und dabei war ich schneller hingekommen als per Bahn! ›Ehe sie rufen, werde ich antworten‹ (Jesaja 65,24). Bei keinem der Wagen habe ich mehr als eine Viertelstunde warten müssen. Das war eine glaubensstärkende Erfahrung.«
Den Sommer verbrachte Jim zu Hause und kehrte im September nach Wheaton zurück. In einem der ersten Briefe an die Familie schrieb er:
»Wissenschaftliche Erkenntnis (die ›Hoffart des Lebens‹) zu gewinnen ist ein mühevolles Unterfangen, und ich frage mich allmählich, ob es überhaupt der Mühe wert ist. Der Glanz, den die Wissbegier den Dingen verliehen hat, ist verblasst. Was kann der Mensch Besseres kennenlernen als die Liebe Christi, die höher ist als alle Erkenntnis? Ach, lieber schwelgen in der Erkenntnis Christi als sich suhlen im grundlosen Sumpf der Philosophie. Mein Philosophieprofessor sagt, ich dürfe nicht erwarten, dass ich in seiner Vorlesung viel lernen würde – das Einzige, was er wolle, sei, den Forschergeist in uns zu fördern, um uns dazu zu bringen, ›philosophische Fragen allgemeinster Art mit klarem, kritischem Verstand zu untersuchen‹. Hm!«
26. Oktober. »Ich bin gefragt worden, ob ich im nächsten Jahr den Posten des Geschäftsführers in der Redaktion des Tower, unserer Studentenzeitung, übernehmen will. Das würde bedeuten, dass ich sechs Ehrenpunkte und ein Jahr Hörgeldfreiheit bekäme und über ein Betriebskapital von 12 000 Dollar verfügen könnte – das hieße aber auch: zusätzliche Arbeit spätabends, weniger Vorlesungen, und noch dazu müsste ich mich an einer Menge äußerlicher Nichtigkeiten beteiligen, die ich mit meiner nicht konformistischen Haltung schwer in Einklang bringen könnte.«
Seine Ablehnung des Angebots brachte ihm Protest seitens der Familie ein, auf den er am 2. November erwiderte:
»Euer Brief kam zu spät, um mich von meinem Entschluss hinsichtlich des Redaktionspostens beim Tower abzubringen. Letztes Wochenende war ich wegen dieser ganzen Sache ziemlich durcheinander, aber nachdem ich lange Zeit gebetet hatte, wurde ich ruhig und fand Frieden, indem ich zu der Überzeugung kam, dass es nicht Sein Wille ist, dass ich den Posten annehme. Zwar kann ich für meinen Entschluss auch jetzt noch keinen Grund angeben, nur den einen, dass der Herr auch dem Psalmisten den Weg des Lebens gezeigt hat, und zwar einfach dadurch, dass der Ihn allezeit vor Augen hatte. Psalm 16,11.
Ich wartete vor Ihm, und irgendwie erhielt ich dann die Antwort – ich hoffe fest, sie kam aus Seinem Geist. ›Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt‹ (Sprüche 16,9). Mein Herz möchte Ihm dienen; Ihm muss ich den nächsten Schritt anvertrauen.«
Beim Formen einer jungen Seele, die sich so zum Dienst für Ihn verpflichtet hat, hält Gott es wohl manchmal für nötig, den Horizont des Betreffenden einzuschränken, bis sein Blick klar ausgerichtet ist. Zwar lernte Jim, noch bevor er das Studium beendete, die Erweiterung des Horizonts zu schätzen, aber während dieser beiden ersten Jahre konnte er die Aufgaben des College nicht ohne Weiteres als etwas durchaus Positives ansehen. Sein Vater, dessen Schulbildung notgedrungen hatte abgebrochen werden müssen, wollte gern, dass Jim verstand, welchen Vorteil ihm das Studium brachte, und pries in einem Brief an ihn den Wert der Bildung. Jim erwiderte:
»Du sprichst davon, dass sie ›unserem Mensch-Sein Fülle gibt‹. Sie gibt ihm Fülle, richtig, aber manchmal, fürchte ich, doch mehr in der Art von l. Korinther 8,1: ›Die Erkenntnis bläht auf.‹ ›Geisteskultur‹, Philosophie, Diskussionen, das Theater in seinen schwächeren Formen, Konzerte und Oper, Politik – alles, was den Verstand in Anspruch nehmen kann, scheint mir die Herzen vieler hier im College davon abzulenken, ein einfaches Leben in der Nachfolge des Herrn zu führen, obwohl wir gerade davon immer so gefühlvoll singen. Nein, Bildung ist gefährlich, und mir persönlich wird ihr Wert für das Leben eines Christen ziemlich fraglich. Gegen Weisheit sage ich nichts – aber die kommt von Gott, nicht durch Doktorgrade.«
Auszüge aus weiteren Briefen an seine Eltern:
6. Dezember. »Zurzeit finde ich das Arbeitspensum, das ich zu bewältigen habe, ziemlich groß; es ist fast unmöglich, vor 11 Uhr ins Bett zu kommen. Wenn Ihr für mich betet, würde ich das sehr schätzen hier, denn es ist schwierig, in der griechischen Vorlesung um 7:30 Uhr morgens nicht wegzudösen, und noch schwieriger, sich davor noch zu sammeln für ein ernsthaftes Morgengebet und Bibellektüre. Gerade das aber ist es, was Paulus meint, wenn er von den Härten spricht, die ausgehalten werden müssen, wenn man ein guter Streiter Jesu Christi sein will, bereit, Strapazen zu ertragen.«
3. Januar 1947. »Die Wirkungen Eurer Gebete habe ich in diesen letzten Wochen spüren können. Ich bin jetzt überzeugt, dass nichts einen so mächtigen Einfluss auf mein Leben gehabt hat wie Eure Gebete. Ich musste heute daran denken, Vater, wie Du uns früher aus den Sprüchen Salomos vorgelesen hast. Zwar kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was Du uns in der Frühstücksnische alles vorgelesen hast, ich merke aber, dass davon eine große Achtung und Liebe zu den Worten des alten Weisen in mir zurückgeblieben ist. Gott sei gedankt, dass Du Dir die Zeit genommen hast – der Wert solcher Dinge ist unschätzbar.«
27. Januar. »In letzter Zeit habe ich oft für die Oberschülergruppe gebetet, denn ich erkenne mehr und mehr, welche Art von Führung ich damals gebraucht hätte in jenen unbesonnenen goldenen Tagen voller Freuden und Sorgen, als jedes Problem so ungeheuer groß war und jede Kleinigkeit bedeutungsgeladen. Ich glaube, die ›problematische Jugend‹ wäre kein so schwieriges Problem, wenn wir nur mal ein paar Jahre in unsere eigene Vergangenheit zurückdenken würden, bis in die Zeit, als unsere häufigste Sorge eine zerbrochene Fensterscheibe war und unsere größte Freude eine Apfelschlacht. Ich glaube, wenn wir die verirrten Schäflein geduldig betreuen, auch durch Fürbitte, werden sie zur Herde zurückkehren. Es dauert immer einige Zeit, bis sich Ausgelassenheit zu Respekt wandelt, und man muss die Wahrheit oft wiederholen, um jugendliche Wildwässer in feste Kanäle zu lenken. Man muss aufpassen, dass das Tun des Guten nicht zu einer Last wird. Gerade ›nachdem ihr den Willen Gottes getan habt‹, ist Geduld besonders notwendig.«
Jim hatte während seines ersten Collegejahres angefangen zu ringen, weil er glaubte, dass sportliche Betätigung dazu beitrage, ihn zu einem Streiter Jesu Christi auszubilden. Wie der Apostel Paulus gesagt hatte: »Ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde« (1. Korinther 9,27).
Jim hatte keine Vorbildung im Ringen von der Oberschule her, aber er trat in seinem ersten Jahr in Wheaton in die Universitätsriege ein und galt auf der Matte als raffiniert und verwegen. Seine Biegsamkeit brachte ihm den Namen »Gummimann« ein. Oft, wenn sein Gegner überzeugt war, Jims Arm oder Bein sei nahe am Brechen, bemerkte er mit ungläubigem Staunen, dass sein Gesichtsausdruck völlig gelassen war.
»Es ist bestimmt ein gutes Gefühl«, hatte Jim an seine Mutter geschrieben, »wenn man beim Studium nicht aufgeschwemmt und schlaff ist. Ich glaube, wenn man körperlich auf Draht ist, wird die ganze menschliche Entwicklung gefördert, auch das Denken. Wie das Pferd bei Hiob kann man sich seiner Stärke freuen.«
Seine Mutter jedoch war nicht überzeugt davon und wies in ihren Briefen immer wieder warnend auf die Gefahren des Sports hin, den sie, wie die meisten Mütter, so »überflüssig« fand.
Während seines zweiten Jahres in der Mannschaft schrieb Jim:
»Die erste üble Folge dieses ›gottlosen‹ Tuns, wie es Granny (eine ältere Freundin in Wheaton) nennt, zeigte sich am Samstag. Es ist eine Schwellung der inneren Ohrränder, in der Fachsprache ›Blumenkohl‹ genannt, in Ringerkreisen gilt es nicht als sehr gefährlich. Granny fand es schrecklich, dass ich, wenn ich zu einem Ringkampf gehe, Kirchenlieder singe, und als ich ihr nachher erzählte, dass wir vor einem Kampf immer beten, kam sie fast vom Glauben ab.«
Bald wandte er sich wieder den Themen »Bildung« und »Gottes Pläne« zu.
8. Februar. »Nein, Vater, die Bücher von Darby habe ich hier nicht bekommen, und wenn, hätte ich nicht die Zeit, sie zu lesen. Das ist auch der Grund, warum ich unzufrieden bin, dass ich mich hier mit Allgemeinbildung beschäftige, denn jetzt in der Zeit, wo mein Geist noch schnell lernt, muss er sich mit Dingen befassen wie Descartes’ rationalistischer Erkenntnistheorie oder der verschwommenen Hypothese von Laplace, während ich doch viel lieber ein Studium betreiben würde, das sich um die Dinge Gottes dreht. Wie dem auch sei, der Vater im Himmel weiß am besten, was gut und richtig ist, und ich bin überzeugt, dass Er mich hierhergeführt hat; mein Auftrag ist, hier still zu arbeiten, bis die Wolkensäule sich bewegt und weiterführt, und Seine Pläne auszuführen zu der Zeit, die Er bestimmt.«
22. Februar. »Einige andere in meinem Haus und ich haben angefangen, auf unseren ›Buden‹ gemeinsam zu beten, und wie wunderbar sind diese Erlebnisse! Die ersten Früchte der Herrlichkeit. Bei diesen Treffen ist das bei Studenten so beliebte Diskutieren und Palavern durch den Geist gereinigt, und sobald wir im Gespräch auf ein Problem stoßen, das Gott beheben kann, beugen wir sofort die Knie und erzählen Ihm davon. Das sind Augenblicke meines Collegelebens, die mir noch im Gedächtnis bleiben werden, wenn die ganze Philosophie sich längst aus meinem Hirn verflüchtigt hat. Gott sitzt noch auf Seinem Thron, wir treten hin zu Seinem Fußschemel, und zwischen Ihm und uns ist nur die Länge eines Knies, wenn wir das eigene vor Ihm beugen!
Diese Woche habe ich meine Noten bekommen, sie waren, wie erwartet, schlechter als im vorigen Semester. Ich will mich nicht entschuldigen, ich gebe zu, ich habe die Arbeit etwas vernachlässigt um des Bibelstudiums willen – in diesem einen Fach möchte ich einen Titel erlangen, den Titel ›v. G. a.‹, von Gott angenommen.«
15. März. »Die Studentische Vereinigung für Äußere Mission besucht zurzeit die Gruppen der Inter-Varsity Fellowship (Christliche Studentenvereinigung in den USA und England) an allen Universitäten in unserem Gebiet. Gestern bin ich zum ersten Mal dabei gewesen. Ich wüsste nicht, wann ich jemals so viel Freude erfahren habe. Nachmittags um drei Uhr fuhr ich los, im Wagen eines Team-Mitglieds, um Viertel vor acht Uhr begann die Versammlung. Wir fuhren zu sechst, einer als Gesangsleiter, die anderen fünf, um etwa je zehn Minuten zu sprechen. Einer sprach über den dringenden Bedarf an männlichem Nachwuchs für die Außenmission; unter anderem brachte er Statistiken über Bevölkerung, Sterbeziffern, die geringe Zahl der Bewerber (ein männlicher auf 18 weibliche), und wies auf die Notwendigkeit hin, dass die Diener Gottes sich auch auf andere Länder verteilen. Ich selber sprach über den Heiligen Geist in der Missionsarbeit. Ein anderer behandelte die Methoden: Radio, Übersetzen, ärztliche Betreuung, Unterricht, Berufsleben, Filme, Benutzung von Flugzeugen, Häuserbau usw. Einer aus Afrika behandelte die praktische Seite – dass man Widerstandsfähigkeit braucht gegen Versuchung und Krankheit, dass man etwas davon verstehen muss, wie man Hütten oder sonstige Unterkünfte baut usw. Zum Schluss gab es eine Fragestunde – die Fragen waren vielfältig und anregend. Auf der Rückfahrt machten wir Station, um eine Kleinigkeit zu essen, und stießen auf eine verwirrte Kellnerin. Es zerriss mir das Herz, als ich versuchte, ihr die ›Worte des Lebens‹ zu sagen, und wenn ich an unser ganzes Land denke, wo viele ebenso verwirrt sind oder noch verwirrter, dann wird mir klar, dass der Omnibus Nr. 39 genauso ein Missionsfeld ist wie Afrika in seinen dunkelsten Zeiten.«
22. März. »Mir fehlt beim Beten die Leidenschaft, die innere Kraft, das Leben, nach denen ich mich sehne. Ich weiß, viele finden, es sei Schwärmerei, wenn sie etwas hören, das nicht im Einklang steht mit den üblichen einschläfernden Lobreden, die so oft von laodicäischen Lippen ausgehen; ich weiß aber auch, dass die gleichen Leute Sünde ruhig dulden, sowohl in ihrem eigenen Leben als auch in der Gemeinde, ohne jedes Wimpernzucken. Kalte Gebete, so wie herzenskalte Freier, kamen selten an ihr Ziel.«
29. März. »Nur noch zwei Tage und wieder wird ein Monat vorbei sein und sich den vergangenen anschließen – und indem das geschieht, möchte ich sagen: ›Gedankt sei Gott für diese 31 Tage.‹ Die letzten Wochen haben immer größere Freude gebracht, sodass ich jeden Abend sagen kann, wenn ich an die Freundlichkeit des Heilands denke: ›Sie ist heute wundervoller als gestern.‹ Jeden Abend sind wir hier zusammengekommen, und die geplante Zeit ist meistens überschritten, wenn wir wieder aufstehen und das Gefühl haben, dass wir eigentlich unsere Gesichter bedecken müssten, weil ein kleiner Abglanz der Herrlichkeit darauf liegt, die der Herr uns geschenkt hat. Das ist für mich wahres Christentum, wenn Kameraden beten und dann sehen, wie unter den Studenten Wunder geschehen. Jeder Tag wird ein Tag mit neu bewirkten Wundern.«
Aus dem letzten Brief in seinem zweiten Studienjahr: »Was für eine grausame Herrin ist die Sünde – sie nimmt unserem Leben die Freude, stiehlt Geld und Gesundheit, macht Versprechungen von kommenden Genüssen und führt einen schließlich auf die verfaulten Planken, die über der Öffnung des Höllenpfuhls liegen. Mit aufrichtigem Loben kann ich heute Abend aufsehen zu Gott und mich über Seine herzliche Güte freuen, dass Er mich erlöst hat von einem sinnlosen Leben der Enttäuschung und von den anschließenden Qualen des ewig nagenden Gewissens, des Bedauerns und der zu späten Reue.«
Es geschah im Laufe dieser beiden Collegejahre, dass Jim die unmittelbare, persönliche Bedeutung von Jesu Gebot klar wurde, hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Er kam zu der Überzeugung, dass der Befehl auch ihm gelte. Über den genauen Zeitpunkt, wann diese Überzeugung bei ihm durchbrach, gibt es keinen Bericht, aber ein kleines schwarzes Notizbuch mit auswechselbaren Blättern zeugt von seiner Sorge um die Millionen, die noch keine Möglichkeit gehabt hatten zu hören, was Gott getan hat, um den Menschen zu sich zurückzubringen. Das Notizbuch wurde nach Jims Tod am Ufer des Curaray gefunden, die Blätter lagen auf dem Sand verstreut, bei manchen war die Tinte durch das Wasser völlig ausgelöscht, andere waren schmutzig und verregnet, aber doch noch leserlich. Abgesehen von den Namen von Hunderten von Menschen, für die Jim betete, fand sich unter den Notizen auch ein Rezept, wie man Seife macht (aufgeschrieben sicherlich in der Voraussicht, dass er eines Tages ein Pionierleben auf irgendeinem Missionsfeld führen würde); außerdem Notizen für seine eigenen Predigten auf Englisch, Spanisch, Quechua; Aufzeichnungen über die Waoraniprache und statistische Zahlen über Äußere Mission, die er sich in seiner Collegezeit notiert hatte. Nachfolgend ein Auszug:
»1 700 Sprachen haben kein einziges übersetztes Wort der Bibel. 90 Prozent derer, die sich für das Missionsfeld melden, gelangen nie dorthin. Es ist mehr nötig als nur ein ›Herr, ich bin willens‹. 64 Prozent der Menschheit hat noch nie etwas von Christus gehört. In jeder Stunde sterben 5 000 Menschen. Die Bevölkerung von Indien ist so groß wie die von Nordamerika, Afrika und Südamerika zusammen. Dort kommt ein Missionar auf 91 000 Menschen. In den fremden Ländern gibt es einen Reichsgottesarbeiter auf je 50 000 Menschen, während es in den USA einen auf 500 gibt.«
Angesichts des eindeutigen Befehls Christi in Verbindung mit diesen erschütternden Fakten glaubte Jim, dass er, wenn er in den Staaten bliebe, nachweisen müsse, dass sein Bleiben gerechtfertigt sei.
Er fasste den Plan, in die Äußere Mission zu gehen, wo immer Gott ihn hinführen würde, und unternahm die ersten praktischen Schritte in diese Richtung im Sommer 1947, indem er per Anhalter nach Mexiko fuhr, zusammen mit Ron Harris, einem Collegefreund, dessen Eltern dort als Missionare lebten. Über seine ersten Eindrücke schrieb er seinen Eltern am 23. Juni:
»Mexiko hat mein Herz gestohlen. Wir sind jetzt vierzehn Tage hier bei Rons Familie, und sie haben mich eingeladen, so lange dazubleiben, wie ich Lust habe. Im Augenblick wünschte ich fast, es wäre für immer … Gott hat mir sehr viel Freundlichkeit erwiesen, dass Er mich hierhergeführt und mir Gelegenheit gegeben hat, ein wenig das Arbeitsfeld zu sehen und die Sprache zu hören. Missionare sind sehr menschenfreundlich; worum man sie bittet, das tun sie. Sie selber ordnen sich ganz unten ein und wollen Ihn preisen in allem, was sie tun.«
Jim blieb sechs Wochen bei der Familie Harris. Er machte seine ersten spanischen Sprachstudien, beobachtete die Methoden seiner Gastgeber bei der Missionsarbeit, erhielt von ihnen Ratschläge und machte sich über alles, was er aufnahm, Notizen, sogar über die spanischen Namen von Vögeln, Blumen und Bergen.
Gegen Ende seines Aufenthaltes in Mexiko wurde er gebeten, in einer Versammlung für Kinder zu sprechen. Trotz seiner erst einmonatigen Sprachstudien entschloss er sich, es zu versuchen, und zwar ohne Dolmetscher.
»Das Thema war die Arche Noah und der Regenbogen der Verheißung«, erinnert sich Ron Harris. »Etwa 150 Kinder saßen aufmerksam und ruhig da, während Jim über eine halbe Stunde lang zu ihnen sprach. Hinter ihm war eine Tafel, und jedes Mal, wenn er ein Wort nicht wusste, zeichnete er auf die Tafel und fand irgendjemand, der ihm das Wort, das er brauchte, sagte. Durch seinen glühenden Eifer und indem er alles, was er lernte, bereitwillig anwandte, kam er mit dem Spanischen trotz der kurzen Zeit sehr gut voran.«
Als Jim nach Oregon zurücktrampte, gab es für ihn kaum noch einen Zweifel, dass Lateinamerika das Land war, in welches Gott ihn rief. Er wusste jetzt, dass er sich nie mit dem »Üblichen« würde begnügen können. Sein Blick war auf die gerichtet, die das Wort noch nie gehört hatten.