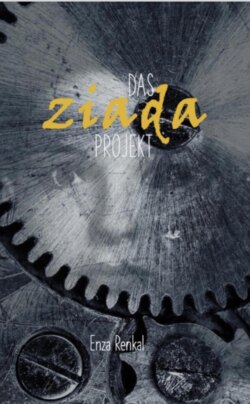Читать книгу Das Ziada Projekt - Enza Renkal - Страница 6
5.
ОглавлениеZwei Minuten konnte ich auf dem Balkon verschnaufen und mich mental auf das Gespräch vorbereiten, dann hörte ich, wie die Haustüre aufgeschlossen wurde. Ich saß auf dem einzigen Stuhl, hatte meine Beine lässig auf dem kleinen Beistelltisch vor mir abgelegt und die Sporttasche schräg über die Schulter gehängt. So würde es bei Ric hoffentlich den Eindruck erwecken, dass ich hier schon eine ganze Weile länger als nur zwei Minuten auf ihn gewartet hatte. Er öffnete die Balkontüre und brachte damit den widerlichen Geruch von Zigaretten nach draußen. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen schien er überrascht, aber doch erleichtert, mich zu sehen.
»Gut. Dann hast du ja doch mal auf meine Anweisungen gehört.«
Wenn du wüsstest, Moretti. Der Gedanke brachte mich innerlich zum Schmunzeln.
»Ich will gar nicht wissen, wie du hier rauf gekommen bist.«
»Würde ich dir auch nicht sagen. Lehmann nicht mitgebracht?«, fragte ich gelassen und war gespannt, wie viel Wahrheit mir Ric erzählen würde.
»Nein«, wich er aus. Ich suchte seinen Augenkontakt. Würde er mir ins Gesicht lügen können?
»Dann wurde er immer noch befragt?«, bohrte ich weiter.
Er brach den Augenkontakt ab. Er bereitete sich gerade vor zu lügen. Ich unterbrach ihn, bevor er überhaupt den Mund geöffnet hatte.
»Ich möchte meine zweite Frage einlösen«, entgegnete ich bestimmt und stand auf, um mit meinem Chef auf Augenhöhe zu sein. Seine Antwort würde nun entscheiden, ob er mich respektierte oder nicht. Doch etwas hinderte mich meine Frage zu stellen, denn wenn ich Ric nach der Verbindung zu Lehmann fragen würde, flog wahrscheinlich auf, dass ich ihn belauscht hatte. Was war mir wichtiger? Mein Freund oder mein Handeln im Hintergrund?
»Welche Verbindung gibt es zwischen dir und Lehmann?«, platzte ich heraus und ging zur Sicherheit auf die Seite des Balkons, an der ich herauf geklettert war, um – wenn nötig – möglichst schnell verschwinden zu können.
Ric starrte mich fassungslos an. Noch hatte ich die Möglichkeit mich bedeckt zu halten. Und die wollte ich nutzen.
»Ich frage, weil du wirklich komisch reagiert hast, als ich meinte, dass auch Lehmann eine Einladung in den Nabel bekommen hat. Ich kenne dein Temperament, aber das war selbst für deine Verhältnisse eine extreme Reaktion. Das hat mich irritiert. Also?«
Sein misstrauischer Blick musterte mich eindringlich. »Seit wann bist du hier, Vite?«
»Frage mit Gegenfrage? Uncool. Beantworte einfach meine Frage, die mir zusteht und gut ist«, wandte ich mich aus der Affäre.
Moretti roch den Braten. Er fixierte meinen Hals und ich wusste, wonach er suchte. Er wollte am Pochen meiner Halsschlagader erkennen, ob ich gerannt oder schon länger hier war. Ich war zwar nicht gerannt, aber ich spürte selbst, wie die Ader Sauerstoff pumpte nach meinem schnellen und damit kräftezehrenden Klettern über Mauern, Regenrinnen und Geländer. Der Braten musste noch weiter von ihm weg.
»Es ist etwas anstrengend, zu dir hier hoch zu kommen. Aber ich bin schon eine Weile hier. Wieso? Hätte ich beim Nabel bleiben sollen? Hätte ich dann etwas Interessantes beobachten können?«
Was ich da gerade machte, war in höchstem Maße riskant, aber meine umgedrehte Psychologie zeigte Wirkung.
»No, aber bei deinem Sturkopf weiß man nie.«
»Der Sturkopf möchte eine Antwort. Ansonsten erzähle ich dir nie wieder etwas. Und du weißt, wie oft ich gute Informationen für dich habe. Soll ich dich an meine WM-Wetthinweise erinnern? Du hast jedes Mal gewonnen. Hat übrigens mittlerweile ein paar Züge einer beginnenden Sucht.«
Es ratterte in Morettis Kopf. Seine gute Quelle wollte er nicht verlieren.
»Du bekommst deine Antwort, aber danach verschwindest du. Ich habe noch einiges vor«, gab er sich schließlich geschlagen.
Ich nickte kurz und blieb geduldig still, doch in meinem Kopf begann es jetzt schon zu rattern. So blöd würde ich nicht sein und meinen Chef aus den Augen lassen. Er würde sich garantiert nach unserem Gespräch auf die Suche nach Leander machen. Und die Chance würde ich ergreifen.
»Es gibt eine Verbindung«, begann Riccardo zu sprechen, doch dann blieb er eine Weile still, bevor er fortfuhr. Er wählte seine Worte mit Bedacht.
»Ich … kannte seine Mutter. Leander war damals erst drei Jahre alt. Er erinnert sich nicht an mich. Das ist auch gut so. Aber für mich … keine Ahnung, ich denke ich bin bei Lehmann etwas emotionaler. Ich denke, das reicht jetzt als Antwort.«
Der letzte Satz war wie eine zufallende Türe. Moretti würde kein einziges Wort mehr darüber verlieren und es war mehr als deutlich, dass die Sache zwischen uns bleiben sollte.
Ich nickte. »Gut. Wir sind quitt. Ich gehe dann mal.«
Er nickte mir stumm zu, verschwand nach drinnen und zog den Vorhang zu. Ich schwang mich über das Geländer und kletterte so schnell und gleichzeitig so sicher wie möglich nach unten. Ric hatte zur Straßenseite hin kein Fenster, ich konnte mich also ganz unauffällig in einen Wohnungseingangsbereich zwanzig Meter von seiner Hauseingangstüre positionieren. Wenn er mit seinem Auto wegfahren würde, hatte ich keine Chance. Ich hoffte also, dass er sich entweder zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Suche machte.
Das war gerade eine Premiere. Ich hatte Ric zwar das ein oder andere Mal für Lernzwecke beobachtet, aber ich war ihm nie gefolgt. Ich schielte um die Ecke, doch er war augenscheinlich noch immer in seiner Wohnung. Oder hatte er einen anderen Weg nach draußen gefunden? Mein Puls beschleunigte kurz. Was wenn er auch geklettert war? Dann könnte ich ihn von meinem Standpunkt aus nicht erkennen. Ich lehnte mich ein Stück weiter nach vorne, um einen größeren Bereich einsehen zu können, als ich einen halben Herzinfarkt bekam. Das finstere Gesicht von Riccardo Moretti blickte mir entgegen. Er packte mich am linken Oberarm und drückte mich einen Schritt nach hinten gegen die Haustüre. Wir waren nun außerhalb der Sichtweite von möglichen Passanten.
»Was soll das? Wieso stehst du hier?«, fauchte er mich mit einem bissigen Ton an, den ich noch nie bei Ric gehört hatte.
Ich blieb still und spürte seinen festen Griff um meinen Arm, der in mir ein Gefühl von Beklemmung auslöste. Ein Klingeln in meinem Kopf benebelte mich und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Was war das für ein Geräusch? Als würde ich innerliche Schmerzen haben, die um das zehnfache schlimmer waren als der brutale Griff von Ric.
»Lass mich los«, sagte ich mit einer viel zu leisen Stimme. Ich begann zu zittern. Die Sporttasche drückte sich unangenehm in meinen unteren Rücken.
Seine Finger packten noch fester zu, mit der zweiten Hand schlug er gegen die Haustüre. »Wieso beobachtest du mich, Vite?«
Das Klingeln wurde lauter. Als würde etwas in meinem Kopf explodieren. Ich wusste nicht, was gerade passierte, ich wusste nur, dass es mit Ric angefangen hat und Ric der Weg war, dass es wieder stoppte.
»Lass mich los, sonst«, wiederholte ich mich, unfähig den Satz zu vervollständigen.
Was überhaupt sonst? Ich fühlte mich wie gelähmt, wollte die Augen schließen, aber sie starrten nach vorne in das eingefrorene Gesicht von Ric. Er bewegte sich nicht mehr. Ich runzelte die Stirn. Was war denn jetzt los?! Meine Augen suchten nach einem Puls bei meinem Gegenüber, fanden ihn jedoch nicht. Als hätte jemand Pause gedrückt, mich aber vergessen. Die Zeit gehörte nur noch mir. Nur ich existierte noch und der Rest war eine Leinwand, die lediglich von mir beeinflusst werden konnte. Ich überließ mich meinen Instinkten. Meine rechte Hand schlug gezielt auf das mich festhaltende Handgelenk. Wie in Trance blickte ich dabei nur in die grauen Augen meines Chefs. Ich vernahm ein Knacken, irgendein Knochen war gebrochen. Meiner oder seiner? Egal. Der Griff auf meinem Oberarm löste sich und mit einem festen Fußtritt in seine Magengegend erweiterte ich den Abstand zwischen uns.
Endlich wurde das Klingeln in meinem Kopf leiser und die Leinwand begann sich wieder zu bewegen. Ich verwendete keinen einzigen Gedanken und Blick mehr für Riccardo und setzte mich in meinen Fluchtmodus. Ich rannte nicht wahllos durch die Straßen, ich würde mir fünf Assistenzen besorgen. Die letzte war der Autoschlüssel. Erstmal raus aus der Stadt.
Ich war noch keine zwei Minuten gerannt, als ich vor einer alten Telefonanlage zum Stehen kam. Sollte ich nicht Hilfe rufen? Ich betrachtete meine rechte Hand und testete die Beweglichkeit. Bei mir war nichts gebrochen. Dann hatte ich wohl Rics Gelenk zertrümmert. Er hatte die Möglichkeit, auf seiner Uhr den Notruf abzusetzen. Vorausgesetzt er war bei Bewusstsein. Vielleicht hätte ich doch einen kurzen Moment nach ihm sehen sollen. Ich blickte hinter mich, aber an eine Rückkehr war nicht mehr zu denken.
Ich stülpte den Ärmel meines Sweaters über meine Hand, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen und wählte den Notruf. Es dauert nicht lange, bis sich eine Frauenstimme meldete.
»Ich melde einen verletzten Mann, mittleren Alters. Turmstraße 38, möglicherweise bewusstlos.«
Ich legte auf und setzte mich wieder in Bewegung. Weitere Informationen wären Täterwissen gewesen und fürs Erste brauchte ich wirklich keine Polizei auf meinen Fersen. Sehr viel wahrscheinlicher würden stattdessen andere Sammler morgen mein Bild in der Hand halten und nach mir suchen. Sofern sie Koordinaten von mir hatten.
Mein Blick blieb an meinem linken Handgelenk hängen. Die Uhr. Mein Puls spiegelte meine Nervosität wider. Der Nabel konnte mich mit der Uhr aufspüren. In ihr war GPS verbaut. Das Problem musste sofort behoben werden. Ich durchwühlte, so unauffällig wie möglich, die nächsten Mülleimer, an denen ich vorbeikam, bis ich zerknüllte Alufolie fand. Ich wagte es nicht, die Uhr vom Handgelenk abzunehmen, da ich zu viel Angst hatte, dass ich damit irgendein Sensor auslöste, der den Nabel darüber informierte, was ich veranstaltete. Stattdessen wickelte ich die Alufolie direkt um die Uhr. Auf Dauer würde ich mir damit meine Haut verletzen, aber als erstes Provisorium musste und würde es genügen.
Die erste Assistenz, ein nur halb voller Rucksack mit einer Wolldecke, einem Erste-Hilfe-Kasten und einer Flasche Wasser, sammelte ich aus einem stillgelegten Gully. Die nächste war nicht mehr dort, wo ich sie deponiert hatte, aber das dritte und vierte Paket, jeweils zwei Dosen Essen und ein kleiner Campingkocher, packte ich zur Hälfte in den Rucksack und zur Hälfte in die Sporttasche. Meine letzte Haltestelle ließ mich noch vorsichtiger werden. Wenn der Autoschlüssel nicht mehr dort war, wo ich ihn versteckt hatte, war mein ganzer Plan hinfällig.
Ich schielte um die Hausecke, doch ich konnte nichts Verdächtiges beobachten. Während ich zielstrebig auf Hausnummer 59 zuhielt, schweiften meine Gedanken kurz ab. Hatten sie Ric bereits gefunden? War er im Krankenhaus? Hatte ich ihn ernsthaft verletzt? War der Nabel informiert? Suchte er nach mir? Sahen sie, dass sie mich nicht mehr orten konnten? Und was zum Teufel war mit mir passiert, als ich Ric angegriffen hatte? War das einfach nur eine übermäßige Ausschüttung von Adrenalin gewesen? Ich war mir darüber im Klaren, dass ich mich verteidigen konnte. Das war der Zweck der Ausbildung gewesen. Aber doch nicht so! Mein Körper hatte sich verselbstständigt. Ich war mein eigener Zuschauer gewesen. Als hätte etwas anderes die Kontrolle über mich übernommen.
Ich schob die Fragen beiseite und lehnte mich gegen die Hauswand links neben Nummer 59. Meine linke Hand ertastete den losen Ziegelstein, während ich weiter die Umgebung beobachtete. Erleichterung breitete sich in mir aus, als ich Metall spürte und den Autoschlüssel in der Hand hielt. Ich schob den Ziegel wieder zurück auf seinen rechtmäßigen Platz und verstaute den Schlüssel sicher in meiner Jackentasche. Die Kapuze über den Kopf ziehend, setzte ich mich wieder in Bewegung. Ich packte die Riemen meines Rucksacks und verfiel in einen leichten Laufschritt, der mich zügig voranbrachte, ohne dass ich zu sehr auffallen würde.
Ich hatte das Auto hinter dem zentralen Bahnhof geparkt. Dort fiel es nicht auf, wenn der Volvo länger nicht bewegt wurde. Der Bahnhof war einige Kilometer von mir entfernt. Zu Fuß würde ich erst im Dunklen ankommen. Aber ich wagte es nicht, mich öffentlich fortzubewegen; viel zu viele Überwachungskameras.
Ein Gedanke schob sich in den Vordergrund, während ich zielstrebig auf dem Weg zu meinem Auto war. Würden sie Marie aufsuchen? Und befragen? Sie würde ihnen nichts verraten können und offen mit ihr sprechen, konnten sie auch nicht. Sie konnten ihr nicht vom Nabel erzählen. Ich hatte den Wunsch ihr zu sagen, dass es mir gut ging, aber die Angst sie in Gefahr zu bringen, war sehr viel größer. Marie aufzusuchen, machte sie nur zur Zielscheibe. Ich kramte meine Kopfhörer aus der Sporttasche und stöpselte sie in mein privates Handy. Keine Ortung, keine Überwachung. Mit Musik in den Ohren war mein Weg schon deutlich angenehmer.
Die Verlockung, die Alufolie von der Uhr zu nehmen und zu schauen, ob ich eine Nachricht bekommen hatte, überkam mich nach einer knappen Stunde. Von Ric, vom Nabel, von Leander, von Irgendjemand. Aber das würde ich erst wagen, wenn ich mir sicher sein könnte, dass ich das GPS manuell ausschalten konnte. Aber dafür müsste ich an das Gehäuse und das setzte voraus, dass ich die Uhr abnahm. Ich legte sie nicht beim Duschen, Schwimmen oder Schlafen ab. Die vollkommene Überwachung. Mit den richtigen Zahlen auf dem Konto stellte man keine Fragen. Ich begann mich vor mir selbst zu ekeln und das Gefühl war schlimmer als jegliche körperlichen Schmerzen.
Ich drehte die Musik lauter und legte an Tempo zu. Es begann zu dämmern und den letzten Kilometer wollte ich joggend zurücklegen. Doch die letzten Meter rannte ich mir die Seele aus dem Körper. Das Bedürfnis etwas hinter mir zu lassen, war erdrückend. Doch das etwas war viel zu groß und schien mich an unsichtbaren Fäden zurückzuziehen. Nach Atem ringend blieb ich vor dem Volvo stehen, öffnete die Fahrertür und legte mein Gepäck neben mir auf dem Beifahrersitz ab. Ich schloss die Autotür und versuchte mich zu beruhigen. Schon zum dritten Mal an diesem Tag musste ich das Bild des Sees hervorrufen, um mich wieder wie einen real existierenden Menschen zu fühlen.
Nachdem ich den Schlüssel in das Zündschloss gesteckt hatte, schaltete ich mein Handy aus und umgriff mit beiden Händen das Lenkrad. Ich starrte mein eigenes Spiegelbild in der Windschutzscheibe an. Die Person, die heute zum ersten Mal nach fast einem Jahrzehnt seinen Kindernamen gehört hatte. Die zum ersten Mal in ihrem Leben einer 1./ begegnet war. Die in einem Verhör über Erinnerungen saß. Die ihren Chef krankenhausreif verprügelt und ihren einzigen Freund verloren hatte. Ich wandte den Blick nach unten auf das Lenkrad, um mich nicht mehr ansehen zu müssen. Die Stirn auf dem weichen Leder des Lenkrads ablegend, begann ich zu weinen. Und die Tränen taten ihren Dienst. Sie ließen die Realität vor meinem Auge verschwimmen und spülten mein Inneres sauber. Zumindest für den Moment. Es war eine Illusion zu glauben, dass es mir damit langfristig gut ging. Mit einer einzigen Frage im Kopf und in einer äußerst unbequemen Stellung schlief ich ein. Wer war ich?