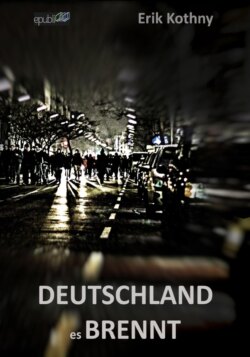Читать книгу Deutschland, es brennt - Erik Kothny - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nazikeule
ОглавлениеOft wenn jemand in einen Kommentar die Asylpolitik von Angela Merkel und ihre Folgen kritisiert, wird von „Gutmenschen“ die Nazi-Keule ausgepackt. Viele Zeitschriften unterdrücken Leserbriefe, die sich gegen die ungezügelte Asylpolitik wenden, von vornherein.
Hier stellvertretend eine der Nazi-Keulen von einem Österreicher auf einer Facebookseite.
Es geht um die Behandlung von Flüchtlingen in Ungarn, deren Verhalten László Kiss-Rigó, Bischof von Szeged-Csanád, nicht als Flucht, sondern als Invasion bezeichnet hatte, weil Flüchtlinge mit „Allahu Akhbar“-Rufen die Grenze zu Ungarn überquert hatten. 17)
Fritz Linzer 1): „Ja wir (in Österreich) winken durch, was sollten wir machen? Wir helfen und behandeln diese Menschen ordentlich nicht wie Ungarische Faschisten.“
Gefällt mir · Antworten · 13. September um 15:23
Joe Maier 1): „Öffnen Sie mal die Augen und schauen Sie genau hin, wie sich die "armen Flüchtlinge" in Ungarn verhalten. Ich sehe da sehr viel Gewalt und überwiegend ausgehend von denselben. Dürfen Polizisten & Hilfspersonal einfach angegriffen werden? Warum können (oder wollen) sich diese Leute bei der Essensausgabe nicht zivilisiert anstellen? Warum prügeln Sie sich untereinander, warum werden Frauen unter ihnen und von ihnen (systematisch?) vergewaltigt? Wahrlich eine andere "Kultur"! Gleichwohl wie, sie verhalten sich nicht wie Gäste (und Hilfsbedürftige), was das allerwenigste wäre, was zu erwarten ist.“
Gefällt mir · Antworten · 13. September um 15:55 · Bearbeitet
Fritz Linzer: „Am Wiener Westbahnhof hat (es) 7000 und in Salzburg 4000 (Flüchtlinge) gegeben ohne einen Zwischenfall; wie geht das denn???? Ihr Vorname sollte Adolf sein.“
Auch auf meiner eigenen Facebook-Seite finde ich Beschimpfungen wie Nazi, Faschist, Rassist, ja sogar mit Goebbels werde ich verglichen. Ein bewährtes Vokabular, um Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik in die Schamecke zu stellen.
Doch sind besorgte Bürger, die sich um ihre Zukunft Sorgen machen, wirklich Nazis, Faschisten, kleine Propagandaminister oder Adolfs? Durch meine journalistische Tätigkeit hatte ich mehrfach Kontakt mit Opfern des Nationalsozialismus. Alle, die die Nazi-Keule schwingen, so meine ich, schießen weit über das Ziel hinaus – und was noch schlimmer ist, sie verhöhnen mit ihren Vergleichen die Opfer des Nationalsozialismus.
Juden
„Da, was für dich, Erik“, hielt mir Barbara Harnischfeger einen Zettel hin, auf dem der Name Hein Wislicky stand und eine Telefonnummer. Barbara Harnischfeger war Studioleiterin des SWF in Koblenz. Obwohl ich noch bei der Bundeswehr war, durfte ich als freier Mitarbeiter bei dem öffentlich-rechtlichen Senders arbeiten.
Der Job beim zivilen Radio war ja auch sehr artverwandt mit meiner Aufgabe als Redaktionsoffizier beim Bundeswehrradio. Der Armeerundfunk war allerdings mit dem Nachteil behaftet, dass er nur für den Papierkorb produzieren konnten, denn eine Sendelizenz gab es für Radio Andernach nicht.
Also war ich froh über jeden Auftrag, den ich vom SWF in Koblenz erhielt, denn diese Produktionen wurden über den Sender in Waldesch bei Koblenz im nördlichen Rheinland-Pfalz ausgestrahlt. Besonders gute Beiträge gingen nach Mainz und wurden landesweit gesendet. Dass dieser Beitrag später auch noch als „Reportage des Jahres“ ausgezeichnet wurde, konnte ich nicht ahnen, als ich mich mit dem Zettel zu Hein Wislicky nach Andernach aufmachte.
Aufträge für den SWF konnte ich natürlich nur nach dem Dienst wahrnehmen, und so fuhr ich gegen Abend mit meinem Tonband Uher Report und Sennheiser Mikrophon zu Hein Wislicky. Er war nicht weit von meiner Wohnung entfernt bei Freunden untergebracht.
Hein Wislicky war Mitte November 1978 wieder mal von Israel nach Andernach gekommen. Er tat es immer in der Karnevalszeit, weil er das närrische Treiben der Andernacher Jecken liebte.
Wie er denn nach Israel gekommen sei, wollte ich wissen. Hein antwortete nicht sofort. Er machte eine Pause und schluckte, ehe er in Andernacher Platt die Episode erzählte, die sein Leben geprägt hat.
„Ich war ein junger Kerl, als Hitler in Deutschland die Macht ergriffen hatte. Für mich war das nicht von besonderer Bedeutung, denn keiner in unserer Familie hatte was mit Politik zu tun. Ich ging zur Schule wie immer und spielte Fußball wie immer; sogar in einer Jugendauswahl von Andernach. Doch eines Tages änderte sich die Welt für mich mit einem Schlag:
Es war in der Halbzeit, als mein Trainer zu mir kam und sagte: ‚Hein! Du kannst nit mehr zurück aufs Spielfeld. Der Schiedsrichter hat es verboten.‘
‚Ja, warum denn?‘
‚Weil Du ein Jud bist.‘
Da brach für mich eine Welt zusammen, ich habe Rotz und Wasser geheult.“
Daheim sagte dann sein Vater:
„Hein, du gehst nach Palästina. Hier wird es zu gefährlich für Dich.“
Hein ging nach Palästina. Das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Aber im Herzen ist er Andernacher geblieben, opponierte sogar bei seinen Besuchen in der alten Heimat gegen die Stadtverwaltung: Die hatte bei der Altstadtsanierung das im Freien stehende Leuff-Kreuz in einen Seitenflügel ins Innere der Christus-Kirche verbannt:
„Das Kreuz hat den 30-Jährigen Krieg überstanden, hat den ersten Weltkrieg überstanden, den zweiten, und jetzt kommt die Verwaltung und tut es weg.“
Das war meine erste Begegnung mit einem Zeitzeugen des Nationalsozialismus. Es sollten weitere folgen.
*
Dr. Heinz Kahn
Ich besuchte ihn in Polch bei Koblenz, wo er bis ins hohe Alter noch eine Tierarztpraxis unterhielt. Er war nierenkrank und schloss sich daheim drei Mal in der Woche selbst ans Dialysegerät an. Er starb 2014 im Alter von 91 Jahren.
Für den Privatsender TV-Mittelrhein dokumentierte ich, wie er als Kind in der Schule von seinen Mitschülern ausgegrenzt und erniedrigt worden war. In der Klasse verbannte ihn der Lehrer auf die letzte Bank, seine Arbeiten wurden nicht benotet. 1936 musste Heinz die Schule verlassen, damit sie „judenrein“ wurde.
Obwohl Vater Moritz im Ersten Weltkrieg zahlreiche Orden und Auszeichnungen erhalten hatte, wurde er zur Zwangsarbeit verpflichtet, ehe die Familie nach Ausschwitz-Birkenau deportiert wurde.
Auf der Rampe wurde Heinz von der Familie getrennt. Zum Abschied sagte sein Vater:
„Heinz, Du bekommst Arbeit, Du musst überleben.“
Es waren die letzten Worte, die Heinz von seinem Vater hörte. Die Familie wurde vernichtet. Insgesamt verlor Heinz über 100 Verwandte.
Er selbst hatte „Glück“: Wegen seiner Geschicklichkeit erhielt er im KZ als „Funktionshäftling“ Privilegien und konnte so anderen Häftlingen helfen.
Auch hatte er durch seine Position Gelegenheit, Dokumente beiseitezuschaffen, indem er sie in Marmeladeneimer einschweißte und im Wasser versenkte. Später dienten diese Belege im Frankfurter Ausschwitz Prozess als Beweismittel.
Nach dem Krieg blieb Heinz im „Land der Täter“ und wurde nimmer müde, in Vorträgen die Gräuel der Nationalsozialisten lebendig zu erhalten. Dabei trat er aber immer aktiv für die Aussöhnung zwischen Juden und Christen ein.
Wichtig war ihm auch, das durch die Nazis enteignete Mobiliar seiner Eltern wiederzuerlangen. Tische, Stühle, Bilder und Gebrauchsgegenstände von Vater und Mutter gaben ihm eine gewisse Geborgenheit zurück; vergessen machen konnten sie das zugefügte Leid aber nicht. Dennoch: Gegen Deutsche hegte er keinen Hass.
Zigeuner
Ich hatte in Koblenz unter meiner Wohnung in der Münz-Straße einen kleinen Künstlerkeller: Eriks Statt-Theater.
Ich war alleinerziehend, hatte zwei Kinder im Grundschulalter und konnte abends nicht weg. Also habe ich jeden Samstagabend die Falltür zu meinem „Theater“ geöffnet und jedem, der rein wollte, Zutritt gewährt – ohne Konsumzwang und ohne Eintrittsgeld. Die Künstler kamen meist aus dem Publikum selbst.
Zu den ersten Bands, die in den „Katakomben“ auftraten, gehörte Mike Reinhardt. Er stammte aus Koblenz und war für seinen swingenden Zigeunerjazz bundesweit bekannt. Später traten Bavo Dege oder Lullo Reinhardt auf. Es entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den Sinti und mir.
Aber: Immer wenn ich auf ihre Vergangenheit zu sprechen kam, wurden sie sehr einsilbig. Es dauerte Jahre, bis die Mutter eines Künstlers mir ein Interview vor der Kamera gab.
12 Jahre war sie alt gewesen, als die Gestapo sie aus der Schule holte und mit der Familie ins „Lager“ brachte.
Mir fiel auf, dass Zigeuner nie KZ sagten, sondern immer nur vom „Lager“ sprachen – so, als würden sie sich über das an ihnen begangene Unrecht schämen.
Nackt musste sie sich zum Appell auf dem Antreteplatz neben ihre Mutter stellen; eine unheimliche Erniedrigung für Sinti. Eltern würden sich nie nackt vor ihren Kindern zeigen.
Als die Kleine von ihrer Mutter wissen wollte, was das für Rauch sei, der am Rande des Lagers aufstieg, schärfte ihr die Mutter ein: „Da wird Brot gebacken. Hörst du? Und sage nie, nie etwas Anderes, auch wenn du etwas anderes hören solltest. Brot. Verstehst du? Brot.“
Was die Kleine nicht wusste, war, dass jeder, der vom Krematorium wusste, umgebracht wurde. Sie durfte deshalb die Wahrheit nie erfahren, solange sie im KZ war.
Zigeuner hatten es gegenüber Juden etwas einfacher im Lager. Sie wurden vom Wachpersonal besser behandelt und gerne zum Musizieren abgestellt.
So wie Daweli Reinhardt.
60 Jahre hat es gedauert, bis Daweli als 72-Jähriger das Geheimnis seines Lageraufenthaltes lüftete. Er tat sich schwer, seine Geschichte vor der Kamera zu erzählen. Wir gingen in den Stadtwald. Und erst als er sich sicher war, dass uns niemand zuhören konnte, durfte Kameramann Wolfgang Kaiser sein TV-Aufnahmegerät einschalten.
Mit 10 Jahren war er zusammen mit seiner Familie nach Ausschwitz deportiert worden. Als der Viehwaggon an der Rampe des Vernichtungslagers hielt, war die Jugend für Daweli zu Ende. Die Nazis hatten ihm bei der Registrierung den Namen genommen und ihn durch die Nummer Z 2252 ersetzt.
Z 2252 nannte ich auch meinen Film.
Wenn der Gitarrist mit seiner Band beim jährlichen Sinti-Festival auf Fort Asterstein zum Swing aufspielte, versteckte er die Z-Nummer nicht, redete aber auch nicht darüber. Sie gehörte wie selbstverständlich zu seinem Leben. Sie war Warnung und Aufforderung zugleich, dass in Deutschland nie wieder Nazis das Sagen haben dürften.
Ich erinnere mich, dass ich bei der Abnahme des Films Probleme mit einem fest angestellten Redakteur bekam.
Ich hatte die Nr. Z 2252 zu Klängen des Swings etwa 10 Sekunden freistehen lassen.
„Das ist zu lang“, sagte der Redakteur. Er war gerade von einem Lehrgang für Mediengestalter gekommen und hatte wohl noch die reine Lehre im Kopf.
„Nein!“, entgegnete ich, „in diesen 10 Sekunden gibst du dem Zuschauer Zeit, sich in das Unrecht von damals hineinzudenken.“
Es kam zu einem Patt, denn weder wollte er seine Meinung ändern noch ich meine. Ich ließ den Chefredakteur kommen.
„Wo liegt das Problem?“, fragte er, nachdem er den Streifen gesehen hatte.
Ich erklärte es ihm.
„Die Z-Nummer bleibt offen stehen“, schaute er den Festangestellten scharf an.
„Bilder wirken stärker als Worte.“
Ich empfand die Entscheidung nicht als Sieg, aber sie bestätigte mir, was ich in Hamburg gelernt hatte: „Fakten aufzeigen.“ Was sind schon 10 Sekunden Z 2252 im Bild gegenüber sieben Jahren Konzentrationslager?
Inzwischen gehören die Sinti von Koblenz zum festen Bestandteil der Kultur an Rhein und Mosel. Und auf eines war Daweli besonders stolz: Der Koblenzer Oberbürgermeister Eberhard Schulte-Wissermann hatte ihn zum „Botschafter der Stadt“ ernannt.
Nach Lullo Reinhardt gar ist ein Platz in Koblenz benannt. An Zusammenfluss von Rhein und Mosel, so scheint es, hat man die Vergangenheit bewältigt. Zigeuner sind heute anerkannter Bestandteil des öffentlichen und kulturellen Lebens.
Ein anderer Sinto hatte auf dem Asterstein eine ehemalige preußische Unterkunft als Werkstatt eingerichtet. Dort lebte Hatscha Reinhardt mit seiner Familie. Er und sein Sohn Feigeli reparierten antike Möbel nach denselben Methoden, wie sie die Hersteller vor Jahrhunderten anwandten; alles per Hand und mit den alten Werkzeugen. Das Holz dazu gewannen sie aus alten Dachstühlen. Nichts sollte daran erinnern, dass da ein Restaurator am Werk war.
Museen und Antiquitätenhändler gaben sich bei Hatscha die Klinke in die Hand.
Als ich über den Kunstschreiner ein Portrait filmte, wollte ich die ganze Familie mit einbeziehen. In der Küche sollte Zigeunerjazz gespielt werden, so wie Sinti das oft nach getaner Arbeit tun. Für die Schlusseinstellung lies ich die Kamera vor dem Haus aufstellen. Der Kameramann sollte die Band im Zimmer durch das Fenster aufnehmen und dann auf eine Mariengrotte im Garten schwenken. Mit dieser Einstellung wollte ich auf die tiefe Religiosität der Zigeuner hinweisen.
Doch als sich die Hausmusiker hinsetzten, um zu spielen, stand ein älterer Herr auf und verließ das Zimmer.
„Mein Vater“, sagte Hatscha. „Er meidet Deutsche und spricht nicht mit ihnen.“
Mir war klar, warum. Auch er war im „Lager“ gewesen. Ich musste das respektieren.
Als der Film längst gesendet war, besuchte ich nochmals die Sinti-Werkstatt wegen eines anderen Projektes. Es ging um Fußball, denn die Sippe der Reinhardts war so groß, dass sie in der Kreisklasse mit einer eigenen Fußballmannschaft antrat.
Mitten im Gespräch ging die Tür auf und der Vater von Hatscha kam auf mich zu. Er gab mir die Hand und fragte, ob ich in seine Anliegerwohnung kommen könne. Seine Frau habe etwas zum Essen vorbereitet.
Verwundert und gleichzeitig erfreut nahm ich an. Es wurde ein längerer Abend. Und ich erfuhr, dass er von meinem letzten Film sehr beeindruckt war. Ich hätte es verstanden, die Seele der Zigeuner zu lesen und sie einfühlsam wiedergegen.
Ich habe immer nur den Zaun gesehen.
Eine andere Begegnung mit dem Nationalsozialismus erfuhr ich durch Ernst Heimes. Heimes war Buchhändler, aber auch Kabarettist. Er trat öfter mal mit der Gruppe Rohr verstopft in meinem Statt-Theater auf. Einmal erzählte er mir, dass er ein Buch über ein KZ moselaufwärts schreiben wolle und er es sehr schwer habe, die Geschichte zu dokumentieren, weil die Leute mauerten.
Als er nämlich über die KZ-Außenstelle Bruttig-Treis an der Mosel recherchierte, wollte anfangs kein Bewohner mit ihm sprechen. Viele schüttelten nur den Kopf und sagten: „Ich habe immer nur den Zaun gesehen.“ Was da drinnen vorging, davon hätten sie nichts gewusst.
Für mich war das natürlich auch ein Thema. Die Landesschau gab ihr Okay zu einem 3-Minuten-Beitrag. Ich habe Heimes begleitet.
Bei meinen Dreharbeiten musste ich dann ebenfalls sehr schnell feststellen, dass die Bewohner dem Ruf ihrer Gemeinde nicht schaden wollten und „von nichts wussten“.
Ernst Heimes aber ließ nicht locker. Er wollte wissen, was die SS mit den dort arbeitenden Gefangenen gemacht hatte. Schließlich fand er heraus: Es waren keine Juden oder Zigeuner, sondern deutsche Widerstandskämpfer und Kriegsgefangene. Unter ihnen Belgier, Holländer, Luxemburger, Norweger, Russen, Polen, Ukrainer, Griechen, Italiener, Spanier und Deutsche. 18)
Später fand Heimes dann doch Zeugen, die über die extreme Brutalität der SS gegenüber den Zwangsarbeitern berichteten. So schilderten sie, dass sechs ergriffene französische Häftlinge nach einem misslungenen Fluchtversuch am Karfreitag hingerichtet wurden. Zwei von ihnen wurden an diesem Tage gekreuzigt, wobei die übrigen Gefangenen dem langsamen Sterben zusehen mussten.
Außerdem schilderten Zeugen eine Lieblingsbeschäftigung der SS, das „Baumhängen“. Dabei wurden dem Betroffenen die Hände auf dem Rücken zusammengebundenen und dann an den Armen hochgezogen.
Eine gebräuchliche Strafe, z.B. für das Essen von Gras, war die Prügelstrafe auf dem Prügelbock. Hierbei musste der Häftling die Zahl der Stockschläge selber laut mitzählen. Verzählte er sich, begann die Strafe von vorne.
Ein Niederländer wurde getötet, weil er bei der Arbeit eine Weinbergschnecke aß.
Zeugen schilderten, dass es eine beliebte Beschäftigung der SS war, Weinflaschen auf den Boden zu werfen und die Gefangenen barfuß über die Scherben laufen zu lassen.
Am Wochenende gab es im Hotel Wildburg Feiern der SS, bei denen Gefangene aus Spaß gehängt wurden. Die Schergen wollten das Verhalten der Sterbenden beobachten. In die Folterbaracke des Bruttiger Lagers wurden Gefangene mit einem Strick geschickt und dort gezwungen, sich selbst zu erhängen.
Es gibt noch viele Beispiele aus meiner journalistischen Praxis, bei denen ich mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus konfrontiert wurde.
Und die Gutmenschen von heute? Sie wissen genau: Wenn sie jemand auch nur bei der leisesten Kritik an der Flüchtlingspolitik unserer Regierung in die Nazi-Ecke stellen, wird dieser Jemand nachhaltig eingeschüchtert. Denn in diese Ecke will sich niemand stellen lassen.
Nebeneffekt: Der Nazi-Keulen-Schwinger erhebt sich dabei selbst zum vollkommenen und strahlenden Gutmenschen und wird so zum Moralimperialisten.
Wenn man diese Praxis der „Einschüchterung auf leisen Sohlen“ einmal erkannt hat, wird man dagegen immun. Heute scheren mich solche Nazi-Beschimpfungen nicht im Geringsten, ganz einfach weil ich weiß, dass ich kein Nazi bin.
Dennoch: Viele Menschen lassen sich davon beeindrucken und scheuen sich, den Mund aufzumachen.
Aber: Wer seine Meinung sachlich äußert, ohne andere zu beschimpfen, ist Demokrat und kein Nazi. Die Demokratie lebt vom Engagement. Es kostet manchmal nur ein bisschen Überwindung, aber das sollte man schaffen. Meine Schwester hat es auch geschafft und meine Tochter ebenso, obwohl beide überhaupt nicht politisch aktiv sind.