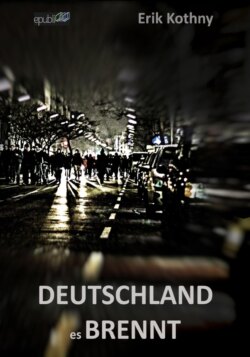Читать книгу Deutschland, es brennt - Erik Kothny - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Integration und Re-Integration
Оглавление„Entfremden Sie bitte die beiden Jungs nicht der thailändischen Kultur“, hatte mich eine Dame des thailändischen Familienministeriums ermahnt, ehe sie den Stempel zur Genehmigung der Ausreise von Somkhit und Willi in deren Reispässe drückte.
Ich habe ihr das in die Hand versprochen, ohne zu ahnen, was das für mich für Konsequenzen haben würde.
Wenn Ausländer nach Deutschland kommen, wird gerne darüber gesprochen, ob und wie sie in unsere Gesellschaft integriert werden können.
Bei zwei Jungs im Alter zwischen drei und fünf Jahren ist das kein Problem. Beide schickte ich in Oeffingen bei Stuttgart in den Kindergarten. Innerhalb eines Jahres konnten sie genauso gut Deutsch wie ihre Spielkameraden. Grundschule war ebenso wenig ein Problem wie später das Gymnasium in Koblenz.
Mit Eintritt in die höhere Schule begannen beide mit dem Fechtsport. Ihr Sportlehrer Eberhard Mehl hatte in Rom mit der deutschen Mannschaft olympische Bronze gewonnen. Jeden, den er für talentiert hielt, beorderte er in die Fecht-AG des Max-von-Laue-Gymnasiums:
„Du kommst heute um sechs in die Fecht-AG.“
Gefragt hat Mehl nicht. Er hat es im Imperativ „gewünscht“.
Beide Jungs waren äußerst talentiert, Willi einen Tick mehr als Somkhit. Im ersten Jahr wurde Willi Stadtmeister der Säbelfechter bei den Schülern, in den beiden Jahren darauf Deutscher B-Jugendmeister. Insgesamt holte Willi sieben deutsche Meistertitel.
Und nicht nur das: Willi wurde zweimal Junioren-Weltmeister: Mit der Mannschaft in Valencia/Venezuela und im Einzel im ungarischen Keszthely. Danach Europameister in Bozen. 19)
Für mich war es ergreifend, wie ein Thailänder auf dem Siegerpodest bei der Deutschen Nationalhymne feuchte Augen bekam. Zwei Bronzemedaillen bei Olympia in Sydney für Deutschland besiegelten eine gelungene Integration.
Als er dann auch noch aus der Hand von Johannes Rau das silberne Lorbeerblatt, die höchste Sportauszeichnung, die ein Deutscher Bundespräsident vergeben kann, erhielt, war er endgültig in seiner neuen Heimat angekommen.
Kurios, wenn auch nie vom Deutschen Fechterbund besonders hervorgehoben: Im deutschen Team focht mit Dennis Bauer nur ein einziger „echter“ Deutscher. Teamkollege Eero Lehmann hatte marokkanische Wurzeln und Alexander Weber wurde von seiner argentinischen Mutter angefeuert.
Alles Belege, wie Integration funktionieren kann, wenn die Verhältnisse stimmen. D.h., wenn das Umfeld so ist, dass man sich anpassen muss. Und es klappte völlig problemlos. Ich machte mir in Sachen Integration gar keine Gedanken. Ich ließ es einfach geschehen.
Dasselbe galt natürlich auch für meinen zweiten Sohn Somkhit, der allerdings sportlich nicht ähnliche Erfolge vorweisen konnte und der nicht so im Rampenlicht stand wie sein „Bruder“.20) Er tendierte mehr in Richtung Trainerausbildung und brachte mit Peter Kulasza sogar einen Deutschen B-Jugendmeister hervor.
Also Sport als Integrationsverstärker.
10 Jahre waren die Kinder schon im Haus und ich war 50 Jahre alt, als es zu einem Zwischenfall kam, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Beim Versuch, Vatikanisches Roulette zu spielen, machte ich einen Top-Gewinn: eine Tochter war unterwegs. Ungeplant, aber deshalb nicht weniger herzlich willkommen. Die Ultraschall-Untersuchung zeigte es deutlich.
Darüber musste ich meine beiden Söhne natürlich sofort informieren, ehe sie den Umstand selbst entdeckten. Ich rechnete damit, dass sie mich spöttisch auslachen würden, predigte ich ihnen doch, ja nicht ohne Kondom Dinge auszuprobieren, die man besser mit Kondom macht.
Doch kein Lachen kam. Willi stand wortlos auf und ging in sein Zimmer. Er war seltsam ruhig weggegangen. Ich ihm also nach und fand ihn auf seinem Bett, das Gesicht weinend im Kopfkissen vergraben. Ich wollte wissen, was los war. Unter Tränen meinte er:
„Jetzt, wo du ein eigenes Kind hast, brauchst du uns ja nicht mehr.“
Das wiederum ließ bei mir die Tränen kullern.
„Willi, Somkhit und du, ihr seid meine Söhne. Ich habe euch ausgesucht, weil ihr ganz liebe Kinder seid, und ihr seid mir ans Herz gewachsen wie eigene Kinder. Es wird keinen Unterschied geben zwischen Euch und dem, was da in ein paar Wochen ans Licht der Welt kommen wird.“
Willi wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Ich auch. Bei Somkhit waren erst gar keine gekommen. Dafür war er zu ökonomisch veranlagt. Er fragte nur:
„Und was erben wir jetzt?“
Der Lacher auf allen Seiten brachte uns wieder in den Alltag zurück. Und seither sprechen wir nicht mehr über Adoptivkinder oder Adoptiveltern. Wir sind alle eine einzige Familie und alle drei Kinder wuchsen wie echte Geschwister auf. Wir sind noch enger zusammengerückt: Monika, Somkhit, Willi, ich und später auch Manuela.
Als beide Jungs ins Teenager-Alter kamen, erinnerte ich mich an mein Versprechen gegenüber der Mitarbeiterin des thailändischen Familienministeriums, die Kinder nicht der thailändischen Kultur zu entfremden. Ich rief die Söhne zu mir und erklärte:
„Jungs. Ihr lebt hier bei mir in Deutschland. Ihr habt tolle Erfolge im Sport errungen, seid gut gelitten in Schule und Verein, aber bitte vergesst nicht, wo ihr herkommt, wo eure Wurzeln sind. Ihr kommt aus einer bitterarmen Familie in Kanchanaburi, die ich finanziell über Wasser halte.“
Ich erklärte ihnen das System der thailändischen Gesellschaft.
„Ganz oben thront der König. Er ist unantastbar, hat unvorstellbar viel Geld. Unter ihm steht eine kleine, aber steinreiche Führungsclique; meist ehemalige Chinesen. Vorwiegend Inder teilen sich den Handel und bilden die Mittelschicht. Und die Thais sind die Kulis, die für die oberen Schichten die Drecksarbeit machen.
Ihr beide habt sozusagen das ‚große Los‘ gezogen. Ihr bekommt von mir eine solide schulische Bildung und wenn nötig im Anschluss eine Ausbildung. Ich kann euch nicht zwingen, aber ich würde es gerne sehen, wenn ihr mit dem in Deutschland erworbenen Know-how in euer Geburtsland zurückginget. Als ehemalige Underdogs könntet ihr den Teufelskreis des hierarchischen Gesellschaftssystems in Thailand durchbrechen und in die oberen Schichten aufsteigen, damit ihr nicht mehr die Kulis seid, denen man auf der Nase herumtanzen kann. Ihr solltet zurück nach Thailand und als Manager – egal wo – euer Land positiv gestalten.“
Mein Engagement ging dabei so weit, dass ich mich mit Sohn Somkhit sogar auf die Schulbank des Landessportbundes setzte, um den Trainerschein C zu machen. Er wollte nämlich nicht. Mit mir musste er.
Ich habe nie von diesem Schein Gebrauch gemacht, aber für ihn war es der erste Schritt in eine erfolgreiche Trainerkarriere.
Durch ihren langen Aufenthalt in Deutschland hatten beide die thailändische Sprache fast verlernt. Also dachte ich: „Ich brauche einen Thai-Lehrer.“ Was lag da näher, als Onkel Keng aus Kanchanaburi nach Koblenz zu holen.
Dazu brauchte er ein Jahresvisum. Und nur, weil ich als Reporter beim Südwestfunk in der Region einen guten Namen hatte, stellte mir die Ausländerbehörde ein entsprechendes Dokument aus. Auch deshalb, weil ich begründete, Keng würde an der Handwerkskammer einen Kochkurs belegen und in einer Sprachschule Deutsch lernen.
Ich war richtig stolz auf mich: So stellt man sich schlechthin eine wirkungsvolle Entwicklungshilfe vor. Keng sollte mit seinem Wissen später in Thailand ein Restaurant für Touristen aufmachen. Das Geld dazu würde er von mir bekommen.
Doch ich hatte die Rechnung ohne den zukünftigen Wirt gemacht.
Nicht mal eine Woche blieb Keng in Koblenz. Ein einziges Mal besuchte er den Sprachunterricht, in der Handwerkskammer wurde er erst gar nicht gesehen. Und den Thai-Unterricht für meine beiden Söhne konnte ich mir auch in die Haare schmieren.
Per Telefon übermittelte mir später ein Freund, Keng sei jetzt in Frankfurt. Hier könne man ganz schnell ganz viel Geld verdienen und das sei ihm wichtiger als alles andere. Es wäre für ihn die einmalige Chance, der Armut in Thailand zu entkommen. In der Frankfurter Szene um den Hauptbahnhof sei er jetzt als Guru tätig.
Ich hatte Keng in Thailand erlebt, wo er sich unter einer Buddha-Statue in Trance tanzte, um sich dann, als er „entrückt“ war, schmerzfrei Nadeln in die Wangen zu stechen. In diesem Trancezustand, erklärte er mir einmal, könne er die Zukunft sehen.
Und darauf waren die Thai-Mädchen im Eros-Viertel in Frankfurt so richtig scharf. Und da keine Dienstleistung kostenlos ist, stellte Keng eine Schale vor sich auf den Boden und bat die Gläubigen, diese mit Geld zu füllen. Nach buddhistischer Sitte alles freiwillig. Und es kam eine Menge Geld zusammen.
Viel Geld lag auch immer auf dem Teppich, wenn sich die Thais zum Poker-Spiel trafen. Einmal, als ich Keng wegen einer Unterschrift besuchte, lagen gut und gern 50.000,– Mark im Pot. Unfassbar: mehr als mein Jahresgehalt.
Nach thailändischer Art wird immer eines der Mädchen zu Kochen abgestellt, andere schlafen auf dem Boden, bis sie sich zum Weiterspielen fit fühlen. Dann legen sich die anderen hin. Ein Zyklus, der oft über Wochen andauert.
Eine Köchin hatte ich gefragt, wie denn all diese Mädchen zu einem Visum für Deutschland kämen.
„Ganz einfach“, meine sie, „so wie ich. Ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Ich zahle ihm dafür jeden Monat 500 Mark und wenn ich dann die Daueraufenthaltsgenehmigung habe, lasse ich mich scheiden.“
„Aha, Integration a la Thai“, dachte ich mir.
Onkel Keng musste nach einem Jahr zurück nach Thailand.
Anmerkung: Ich neige ja nicht dazu, schadenfroh zu sein, aber hier war ich es. Als Keng nach Kanchanaburi zurückkehrte, klaute ihm seine Frau das Ersparte und brannte mit dem gemeinsamen Sohn durch. Erste Maßnahme des Onkels: Er griff zum Telefon und bat mich, ihm ein neues Visum zu besorgen. Ob er es verstand, glaube ich eher nicht; ich sagte ihm einfach: „Pustekuchen“.
Als ich meinem Freund Siggi davon erzählte, meinte er nur:
„Kenn ich. Abmachungen sind in solchen Ländern Schall und Rauch. Verträge auch.“
Siggi ist mit einer Chinesin verheiratet und Rentner. Die beiden machen einmal im Jahr Urlaub in Pattaya. Er war Ingenieur bei Bilfinger-Berger und baute Flugzeughallen in aller Welt: Iran, Nigeria, China.
Aus Nigeria erzählte er mir folgendes Beispiel erfolgloser Entwicklungshilfe:
Zum Bau einer Halle wurden Ortskräfte eingestellt. Die Vorarbeiter aber kamen aus Deutschland. Da dachte sich die deutsche Geschäftsleitung vor Ort, man könnte doch einen Einheimischen im Mutterhaus Frankfurt ausbilden lassen und dann in Nigeria einsetzen.
Gesagt, getan. Ein fähiger Arbeiter wurde nach Deutschland geschickt. Alle waren stolz, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen zu haben. Erstens würde ein Einheimischer weniger Geld kosten und zweitens hätte man nachhaltige Entwicklungshilfe geleistet. Aber die Geschichte ging ähnlich aus wie bei Keng.
Als der Afrikaner nach Nigeria zurückkam, ließ er als erstes Visitenkarten drucken und gab als Berufsbezeichnung „Ingenieur“ an. Von der Firma verlangte er einen Schreibtisch – er sei ja nun schließlich ein Boss – dazu ein Funkgerät und einen Assistenten, damit er seine Order an die Arbeiter weitergeben könne. Schließlich wollte er noch ein Auto und ein Haus. Als Ingenieur stünde ihm das zu.
Die Firma wollte ihn feuern, weil er das Mehrfache eines deutschen Vorarbeiters kostete; und das, ohne Leistung zu bringen.
Die Gewerkschaft stellte sich quer. Schließlich einigte man sich auf eine hohe Abfindung und ein Auto, mit dem er dann zufrieden von dannen fuhr.
Ich weiß, dass es Leser geben wird, die den Finger heben und mir „Generalisierung“ vorwerfen. Das ist es aber nicht. Was diese Gutmenschen vergessen, ist, dass in anderen Kulturen ganz andere Maßstäbe gesetzt werden. Diese an unsere anzupassen, dürfte Generationen dauern, wenn nicht gar unmöglich sein. Was es auf alle Fälle bedarf, ist Geduld, weil sich die ganze Einstellung von Grund auf ändern muss.
Mit solchen Problemen sind in der Regel nur die vertraut, die vor Ort sind, ob Projektleiter oder Entwicklungshelfer. Wenn man so etwas aber in Deutschland in die Diskussion wirft, ist man ganz schnell Hetzer oder Rassist. Die „Weltverbesserer“ sollten sich erst einmal mit Kultur und Religion fremder Menschen befassen, bevor sie blauäugig ihre Forderungen stellen.
Diese beiden Beispiele machen überdeutlich, dass Absichten und Versprechen Makulatur sind, wenn es um Geld geht. Zum Glück erfuhr im Falle von Onkel Keng die Ausländerbehörde nichts von diesem Visummissbrauch, sonst wäre ich meinen guten Ruf wohl los gewesen.
Integration von Keng gescheitert, Re-Integration meiner Söhne gescheitert. Ich suchte nach neuen Lösungen.
Meine neue Idee: Ich musste die Jungs in ihrer alten Heimat selbst re-integrieren. Den Anfang machte ich während der Schulferien.
Das war schwerer getan als gedacht, denn: Zu ihrer Verwandtschaft wollten sie nicht. Die hatte ihnen früher mal bei einem Besuch alles Geld abgeknöpft, das ich ihnen für den Notfall mitgegeben hatte.
Aber wohin? Während meiner journalistischen Ausbildung an der Akademie für Publizistik in Hamburg hatte uns ein Dozent die Aufgabe gestellt, einen Vormittag lang in der Innenstadt wildfremde Leute anzusprechen und in ein Gespräch zu verwickeln. Die Ergebnisse sollten wir festhalten und am Nachmittag vortragen.
Sehr schnell stellte sich heraus, dass es schier unmöglich war, auf jemanden zuzugehen, ihn einfach anzuquatschen und in einen Dialog zu verwickeln. Irritiert schüttelten die meisten Passanten den Kopf; einige zeigten sogar den Vogel und gingen weiter.
Eine andere Methode erwies sich als erfolgreicher. Man stellte sich an eine Busstation, schaute auf die Uhr und fragte einen ebenfalls Wartenden, ob er wüsste, wann der nächste Bus fährt. Dann beklagte man sich über die Unzuverlässigkeit der Hamburger Verkehrsbetriebe und schon war man mitten im Gespräch.
„Okay“, dachte ich mir, „ich muss für meine Söhne eine Situation herbeiführen, in der sie mit Thais konfrontiert werden, die ähnliche Interessen haben wie sie.“
Was lag da näher als Fechten? Über die Zeitung The Nation erfuhr ich, wo die thailändische Säbel-Nationalmannschaft trainiert: im National Stadium, Bangkok.
Also fuhr ich dort hin und hörte schon von weitem den scharfen metallischen Klang aufeinandertreffender Klingen. Und dann sahen wir ein gutes Dutzend thailändischer Fechter, wie sie in Freigefechten über die Bahnen hechelten, um einen Tagessieger zu ermittelten.
In einer Pause ging ich auf den ältesten Athleten zu und erzählte ihm, dass ich in Deutschland zwei thailändische Jungs großziehe, die ebenfalls fechten. Spontan wurden Willi und Somkhit aufgefordert, mit den Stars der Nationalmannschaft die Klingen zu kreuzen. Man wollte wissen, was „die Deutschen“ so draufhaben.
Die Athleten um Mannschaftskapitän Jomyuth kamen aus dem Staunen nicht heraus. Da schlug doch der B-Jugendliche Willi Kothny mit seinen 13 Jahren die gesamte thailändische Nationalmannschaft.
Er wurde eingeladen, am Wochenende darauf bei den Thai-Meisterschaften mitzumachen. Da er aber zum Deutschen Fechterbund gehörte, war das offiziell nicht möglich. Ich suchte nach einem Ausweg und ließ ihn unter seinem Geburtsnamen Klinrungroj an den Start gehen. Es kam, was kommen musste: Wiradech Klinrungroj wurde erstmals thailändischer Meister im Säbelfechten. Aber das durfte damals niemand in Deutschland erfahren. Heute ist es verjährt.
Von da an gingen die Jungs fast täglich zum Training und da Thais kaum Englisch sprechen, mussten beide zwangsläufig in ihrer Muttersprache reden. Willi und Somkhit freundeten sich schnell mit einem Fechter an und lebten sogar bei ihm in den Klongs, wo nachts die Ratten über die Bettdecke huschten. Der Freund hieß Chat. Es wurde eine Freundschaft, die bis heute Bestand hat.
Zwar wurde daraus noch keine Re-Integration, aber die Kontakte waren geknüpft, der Anfang gemacht. Da ich als Journalist eine Menge Geld verdiente, lud ich auch thailändische Fechter nach Deutschland ein und führte so die beiden Jungs wieder ihrem Kulturkreis zu.
Re-Integration also auch geglückt. Sport hier als Re-Integrations-Katalysator.
Nach Olympia 2000 gingen beide zurück nach Thailand.
Nur der Deutsche Fechterbund war mit dieser Entwicklung gar nicht einverstanden, verlor er doch in Willi das Zugpferd seiner Nationalmannschaft. Schließlich war der Vorzeigeathlet der erste „Deutsche“, der bei Olympia im Säbel eine Medaille für den Deutschen Fechterbund geholt hatte. Und Willi war Deutscher – durch und durch. Nicht äußerlich, aber mit seinem Herzen und seinem Verstand.
Warum ich das erzähle? Weil ich meine, dass man mit einer vorausschauenden Planung Integrationen und Re-Integration meistern kann:
Somkhit hat in Deutschland dann noch die Trainerscheine B und A gemacht und wurde mit nicht mal 30 Jahren thailändischer Nationaltrainer im Säbel.
Willi besuchte in Bangkok die International University und heuerte an der New International School of Thailand (NIST) als Trainer an. Er bildet dort die Jugend aus, die er später an seinen Bruder übergibt. Heute noch (Stand 2016).
Beide Jungs haben die Integration und die Re-Integration also geschafft. Sie sind äußerlich Thais geblieben, haben aber mit ihrer deutsche Disziplin und Gründlichkeit ganz schnell ihre Sportler an die Spitze der thailändischen Rangliste geführt.
„Ihr sollt keine Kulis mehr sein, sondern Manager werden und euer Land vorwärts bringen“, hatte ich ihnen gesagt. Kann man sich als Vater etwas Schöneres vorstellen, als dass so ein Plan aufgeht?
*
Nachdem ich in den Ruhestand gegangen war, machte ich in Sachen Integration auch meine eigenen, sehr persönlichen Erfahrungen und musste feststellen, dass meine Integration in Thailand gründlich danebenging. Ähnlich geht es vermutlich allen älteren Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen und bleiben wollen.
Erst einmal muss ich sagen, dass ich, ehe ich in den Ruhestand ging, 30 Jahre lang jährlich ein- bis zweimal Thailand besucht hatte und bei den Fechtturnieren meiner Söhne im Königreich mitfieberte. Man kann sagen, dass ich „Thailand-Fan“ war.
Also versuchte ich nach meiner Pensionierung erst einmal thailändisch zu lernen. Ein vergebliches Unterfangen, wenn das Gehör nicht mehr so recht mitspielt und man schon bei einer deutschen Konversation Probleme hat.
Nun ist es im Thailändischen so, dass es für ein und dasselbe Wort oft vier bis fünf verschiedene Bedeutungen gibt; je nachdem, wie man das Wort betont. Das Wort Gau/Kau zum Beispiel bedeutet je nach Sprachmelodie neun, Berg, weiß, Reise oder Knie.
Unmöglich also, diese Sprache zu erlernen, wenn man nicht ständig unter Thais lebt. Also gab ich nach einem Jahr auf, zumal die meisten Thais in den Städten sowieso ein leidliches Englisch sprechen und ich ja zudem meine Söhne als Dolmetscher hatte.
Meine Integration also fehlgeschlagen – und sicher wird es auch in Deutschland Ausländer geben, die nicht im Arbeitsprozess stehen und sich ausschließlich im Kreis ihrer Familie bewegen. Sie werden in ihrer Familie, in ihrem Klan Teil einer Parallelgesellschaft. Und das ist noch nicht mal negativ zu werten. Es ist Fakt.
Ich gehe hier in Thailand auch in deutsche oder europäische Restaurants, kaufe beim German-Thai-Metzger (GTM) meine Wurst und beim deutschen Bäcker meine Frühstücksbrötchen.
Solange man sich aber sonst anpasst und sein Geld brav abliefert, wird es auch keine Probleme zwischen Einheimischen und Farangs geben (Anmerkung: Farang leitet sich von „Franken“ ab. Franken = Faranke = Farank = Farang; und bedeutet Europäer)
Ach ja, eins noch: Jeder Farang muss sein Visum einmal im Jahr bei der Immigration erneuern und dabei 20.000 Euro auf der Bank nachweisen. Alle 90 Tage muss er sich bei der Immigration melden. Und dennoch gelten Thais nicht als fremden- oder ausländerfeindlich. Komisch. Deutsche würde man bei ähnlichem Verhalten als Nazis oder Rassisten beschimpfen.
*
Als Übergang zum nächsten Kapitel möchte ich noch einmal auf meine Schwester zurückkommen. Sie hatte beobachtet, wie in ihrem Supermarkt ein etwas dunkelhäutiger Mann eine Tafel Schokolade in seiner Jacke verschwinden ließ.
Sie machte den Geschäftsführer darauf aufmerksam, erntete aber nur ein Schulterzucken und die Bemerkung, man wolle deswegen nicht unnötig Staub aufwirbeln.
Da erinnerte ich mich an einen meiner Söhne, der im pubertären Alter im Koblenzer Globus-Kaufhaus ein Spielzeugauto für 3,50 Mark geklaut hatte und erwischt wurde. Es handelte sich dabei um eine gängige Mutprobe bei Jugendlichen, wie ich sie selbst auch erlebt hatte, als ich in Admont nach der Schule in einer Eisdiele eine Stange Waffeln klaute – beim Zuckerl-Jud, wie er im Volksmund hieß. Keine Ruhmestat, aber im pubertären Alter nicht ganz unüblich. Meine Tat blieb ungesühnt, brachte mir aber ein Pseudonym ein, das ich heute noch ab und an verwende.
Der Zuckerl-Jud konnte mich zwar nicht fassen, wohl aber meinen Freund Karli. Wie ich heiße, wollte er wissen, um sich an die Internatsleitung zu wenden.
„Ebretzberger“, meinte Karli. Keine Ahnung, wo er den ausgefallenen Namen so schnell herhatte, aber seither stehe ich unter diesem Namen auf der Fahndungsliste der österreichischen Gendarmerie. (lol)
Mein Sohn hatte weniger Glück: Mit ihm ging ich zum Geschäftsführer. Er sollte sich entschuldigen. Die Standpauke hatte ich schon vorher gehalten und ihm klar gemacht, dass nicht nur Globus, sondern wir alle die Zeche bezahlen, weil nämlich die Preiskalkulation wegen der Fehlbeträge in Schieflage kommt und die Preise teurer werden.
Die Bearbeitungsgebühr, die dem Haus entstanden war, musste mein Sohn von seinem Taschengeld bezahlen; das Auto auch. Am Ende bekam er ein Jahr Hausverbot – als erzieherische Maßnahme. Von meiner Verfehlung habe ich nichts gesagt.
Und heute? Die Angestellten einiger Discounter werden angewiesen, bei Diebstahl Stillschweigen zu wahren, einmal, um Ausländer nicht zu diskriminieren und zum anderen, um „Rechtspopulisten“ keine Munition für Vorurteile zu liefern. Fremdenfeinde würden diese Vorfälle für ihre Zwecke „instrumentalisieren“.
„Instrumentalisieren“ ist das eine Unwort, das von Menschen in den Mund genommen wird, wenn sie fürchten, der politische Gegner könnte einen Vorfall aufgreifen und für sich daraus Kapital schlagen.
Beispiel Silvesternacht Köln. Da forscht keiner der Verantwortlichen nach Ursachen und denkt über Abhilfe nach. Nein. Nein, man geht aus der Schusslinie und zeigt auf den politischen Gegner: Er könnte dies für seine politischen Zwecke instrumentalisieren und, damit bin ich beim zweiten Unwort, man könne dies nicht generalisieren. Hauptsache, die Opposition kann angegriffen werden. Diese Handlungsweise ist, wie so vieles, alternativlos. Damit will man suggerieren, es gäbe keine bessere Lösung.
Wenn nur Politiker zu solchen Worten greifen würden, könnte man das ja noch verstehen. Sie sind ja in ständigem Kampf gegen- und miteinander. Aber das Vokabular hat sich längst auch die Presse zu Eigen gemacht und generalisiert und instrumentalisiert, anstatt zu berichten und zu kritisieren. Ist eben vermutlich doch alternativlos.
Der Krieg der Worte ist in vollem Gang.
Diebstahl ist kein Diebstahl, wenn er von Ausländern begangen wird. Und wenn es nicht zu verheimlichen ist, wird im selben Atemzug auf die Gefahr von Rechts verwiesen (siehe oben).
Aber genau dieses Verschweigen ist ebenso Rassismus, wie Probleme zu verallgemeinern. So kann Integration nie gelingen.
Mein Sohn hat Hausverbot bekommen, weil er geklaut hatte. Punkt. Hätte man ihn wegen seiner asiatischen Gesichtszüge laufen lassen, hätte ich als Vater ein Problem bekommen. Wenn’s keine Sanktionen gegeben hätte, wäre er ermutigt worden, es weiter zu versuchen.
Deutsche werden für so ein Delikt zur Rechenschaft gezogen. Ausländer nicht, zumindest dann nicht, wenn man die Personalien nicht feststellen kann, „weil das zu lange dauern würde.“21)
Zweierlei Recht ist auch Rassismus.
Diebstahl bleibt Diebstahl, egal, wer ihn verübt.