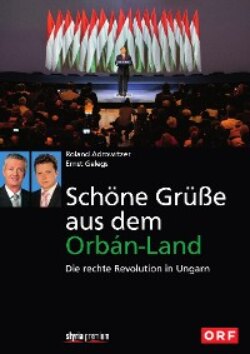Читать книгу Schöne Grüße aus dem Orbán-Land - Ernst Gelegs - Страница 9
It’s the economy, stupid!
ОглавлениеDen für Bill Clinton erfundenen Slogan im US-Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 1992 „It’s the economy, stupid!“ (Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!) musste sich nicht nur der damalige Amtsinhaber George Bush sen. an den Kopf werfen lassen, sondern gut zehn Jahre später auch Péter Medgyessy.
Nach dem Rekorddefizit im Jahr 2002 von fast zehn Prozent lässt der Regierungschef für 2003 wieder ein Defizit in der Höhe von 4,5 Prozent budgetieren. Alle Ökonomen äußern damals ihre Befürchtung, dass die Regierung die Gefahren einer derart hohen Neuverschuldung unterschätze. Und sie behalten Recht. Das Defizit im Jahr 2003 klettert letztlich auf knapp sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes.
Während der Schuldenberg Ungarns immer größer und größer wird, bleibt der Regierungschef eisern bei seiner Politik des Defict-Spending. Die ungarische Wirtschaft will er mit groß angelegten Straßen- und Autobahnbauten ankurbeln. Medgyessy verspricht seinen Landsleuten den Neubau von 800 Kilometern bis 2006. Finanziert auf Pump, wie bisher. Und auch für 2004 plant Medgyessy eine Erhöhung der Staatsausgaben um bis zu acht Prozent und er betont im ungarischen Fernsehen auch noch, dass die Bevölkerung mit keinen Einschränkungen oder gar einem Sparpaket zu rechnen habe. Der Ministerpräsident spekuliert insgeheim damit, dass der bevorstehende EU-Beitritt im Mai 2004 Förderungen der Europäischen Union in Milliardenhöhe bringen werde, schließlich sei Ungarn Nettoempfänger, wie Medgyessy oft erwähnt. Und selbstbewusst verkündet er auch noch, dass Ungarn nicht erst 2010, sondern schon 2008 den Euro als Landeswährung einführen wolle, denn der Euro bringe neue Arbeitsplätze, führe zur Senkung der Inflation und zu mehr Wirtschaftswachstum. Es ist wohl die mit Abstand größte Fehleinschätzung der knapp zweieinhalbjährigen Amtszeit von Péter Medgyessy.
Erst gegen Ende des Jahres 2003 beginnt sich innerhalb der Regierung langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass Ungarn zielsicher dem Finanzkollaps zusteuert und es so nicht länger weitergehen kann. Im Dezember werden dann doch die ersten Sparmaßnahmen beschlossen. So kürzt die Regierung beispielsweise die staatlichen Förderungen für zinsbegünstigte Wohnbaukredite. Der Ministerpräsident begründet die Ausgabenkürzung mit seinem Versprechen, die für 2004 vorgesehene Neuverschuldung von 3,8 Prozent strikt einhalten zu wollen – ein Versprechen, das er letztlich doch nicht halten kann.
Im darauffolgenden Jänner gibt es das erste Bauernopfer der Medgyessy-Regierung. Finanzminister Csaba László muss seinen Hut nehmen. Der Regierungschef wirft ihm vor, die Finanzlage des Landes falsch eingeschätzt zu haben. Offizieller Entlassungsgrund: Der Finanzminister hat das für 2003 beschlossene Budgetdefizit von 4,5 Prozent deutlich überschritten. Es beträgt fast sechs Prozent.
Der neue Mann an der Spitze des ungarischen Finanzministeriums, Tibor Draskovics, beginnt gleich mit Amtsantritt eilig zurückzurudern. Er lässt wissen, dass die geplante Euro-Einführung im Jahr 2008 doch eher unrealistisch sei. Zu kämpfen hat er auch noch mit einem Verfall der Landeswährung Forint. Die Schuldenpolitik der Regierung hat den Forint in massive Turbulenzen gestürzt. Der Wert des Forints ist seit geraumer Zeit immer geringer geworden, was den Schuldenberg des Landes zusätzlich erhöht hat. Denn die Regierung hat sich hauptsächlich in fremder Währung verschuldet. Je weniger die eigene Währung wert ist, desto teurer ist es, Schulden in fremder Währung zu begleichen, denn die eigene Währung muss ja in die fremde Währung gewechselt werden.
So nach und nach dämmert allen Regierungsmitgliedern, dass eine Sanierung des ungarischen Staatshaushalts dringend erforderlich ist und viele Jahre dauern wird.
Plötzlich ist Schluss mit lustig. Medgyessy kündigt ein hartes Sparpaket an. „Es kommen Zeiten“, erklärt der 60-Jährige wie ein mahnender Vater, „die Konsequenz, Berechenbarkeit und finanzpolitische Strenge verlangen!“ Wenig später, in seiner Rede zur Lage der Nation, räumt der Regierungschef sogar ein, Fehler gemacht zu haben. „Wir haben die Kraft unserer Wirtschaft überschätzt und die Kraft der Märkte unterschätzt“, sagt ein zerknirscht wirkender Ministerpräsident im Februar 2004.
Erstmals erkennen viele Ungarn, dass Medgyessy als Regierungschef zwar sympathisch, aber eine glatte Fehlbesetzung ist. Diese Erkenntnis ist der Anfang vom Ende Medgyessys als ungarischer Ministerpräsident.
Die EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 und die damit verbundene Feierstimmung in ganz Europa verschaffen dem angeschlagenen Ministerpräsidenten noch eine kurze Ruhephase, bevor die beiden Regierungsparteien, die sozialistische Partei Ungarns (MSZP) und der linksliberale Bund der Freien Demokraten (SZDSZ), die politische Demontage Medgyessys in Angriff nehmen.
Noch vor dem EU-Beitritt Ungarns kündigt Medgyessy eine Regierungsumbildung für den Sommer an. Offenbar hat es hinter den Kulissen heftige Streitereien über die künftige Regierungspolitik gegeben. Einige Minister wollen die von Medgyessy angeordneten Einsparungen in ihren Ressorts nicht akzeptieren, sie sehen die Umsetzung ihrer Politik in Gefahr. Andere wiederum drängen auf die Durchführung lange versprochener Steuersenkungen, schließlich hat man ja noch viele Wahlversprechen zu erfüllen. Grundsätzlich haben alle Minister Sparmaßnahmen befürwortet, nur halt nicht in ihrem Ressort.
Auch das Debakel der Sozialisten bei der Wahl zum Europaparlament löst massive Unruhe unter den Genossen aus. Jedenfalls dürften intern die Fetzen geflogen sein, denn plötzlich bietet Sportminister Ferenc Gyurcsány seinen Rücktritt an. Seinem Beispiel folgt Justizminister Péter Barandy. Beide begründen ihr Rücktrittsangebot mit einem „zunehmenden Vertrauensverlust“. Dabei drehen sie geschickt den Spieß um. Gyurcsány und Barandy sagen nicht, dass sie kein Vertrauen mehr in den Ministerpräsidenten haben, sondern sie beklagen beide weinerlich, dass der Ministerpräsident kein Vertrauen mehr in sie habe und ihnen daher nichts anderes übrig bleibe, als ihren Rücktritt anzubieten.
Die wahren Gründe des gegenseitigen Vertrauensverlustes sind bis heute nicht veröffentlicht worden. Die Journalisten sind gar nicht mehr dazugekommen, die Hintergründe zu recherchieren, weil sich die Ereignisse Mitte August 2004 regelrecht überschlagen.
Während ein sichtlich in die Enge getriebener Ministerpräsident Medgyessy vor der Presse eine Regierungskrise heftig in Abrede stellt, feuert er wenig später gleich drei seiner Regierungsmitglieder: Sportminister Ferenc Gyurcsány, Arbeitsminister Sándor Burany und Wirtschaftsminister István Csillag. Zuvor hat er noch seinen Regierungssprecher Zoltán Gál fristlos entlassen.
Doch Medgyessy macht die Rechnung ohne den Wirt. Csillag ist nämlich Angehöriger seines Koalitionspartners SZDSZ und die Parteispitze der Linksliberalen ist entschieden gegen die Entlassung „ihres Mannes“ in der Regierung. Péter Medgyessy bleibt wieder einmal nichts anderes übrig, als die Vertrauensfrage zu stellen. „Entweder Csillag oder ich“, soll er bei einer internen Sitzung mit den Linksliberalen gesagt haben.
Sein Koalitionspartner entscheidet sich für Csillag. Noch am selben Abend des 19. August 2004 tritt Péter Medgyessy zurück. Die Sozialisten, die ihn drei Jahre zuvor zu ihrem Spitzenkandidaten gemacht hatten, bemühen sich nicht einmal, ihn zu halten. Sie weinen dem „Politiker wider Willen“ – wie Medgyessy in vielen politischen Analysen und Kommentaren bezeichnet worden ist – keine Träne nach.