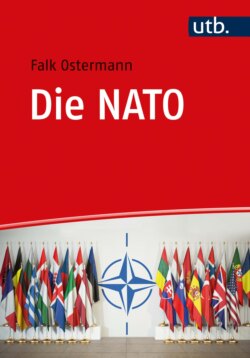Читать книгу Die NATO - Falk Ostermann - Страница 10
2.1.1 Basiskonzepte des Institutionalismus
ОглавлениеInstitutionalismus (Neoliberaler)Der InstitutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)mus teilt die Basisannahme des NeorealisRealismus (Neo-)mus, dass Staaten die primären Akteure in der globalen Ordnung sind, die grundsätzlich anarchischAnarchie, anarchisch aufgebaut ist. Das heißt, dass es keine den Staaten übergeordnete Instanz gibt, die ein bestimmtes Staatshandeln erzwingen kann. Somit agieren Staaten stets unter Bedingungen der Unsicherheit – darüber, wie andere Staaten auf das eigene Handeln reagieren, ob Kooperationsvereinbarungen Folge geleistet wird bzw. Kooperation von Dauer ist (Mearsheimer 2001, 3; Wallander et al. 1999, 3; Waltz 1979, Kap. 6, 8). Im Gegensatz zur neorealistischen Denkschule gehen InstitutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)t*innen jedoch davon aus, dass Kooperation verstetigt und die AnarchieAnarchie, anarchisch des internationalen Systems somit zwar nicht überwunden, aber bewältigt werden kann (mitigation logic). Dabei verändern sie zwei Grundannahmen realistischer Theorien: Zum einen ist für InstitutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)t*innen MachtMacht keine relative Größe, sondern eine absolute. In Anlehnung an liberalLiberalismuse Wirtschaftstheorie (auch Vertragstheorie) streben Staaten nach institutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)tischer Auffassung daher nicht nach relativen Gewinnen (z. B. stärker als der Nachbarstaat zu sein), sondern bevorzugen absolute Gewinne – unabhängig davon, wie der Gewinn des Kooperationspartners aussieht (Wallander 1999, 20ff.). Kooperation kann also beständig sein, solange ein absoluter Gewinn entsteht. Diesen Annahmen liegt keine Gutgläubigkeit zugrunde, dass Staaten nur harmonisch miteinander interagierten oder nie ein Sicherheitsproblem bestünde. Vielmehr bauen sie auf der Einsicht auf, dass Staaten ein Interesse daran haben, das Sicherheitsproblem zu überwinden oder zumindest zu bearbeiten und dass dazu mehr als nur militärische Mittel genutzt werden können (Wallander et al. 1999, 3ff.).
Diese Beständigkeit von Kooperation kann durch verschiedene Wirkmechanismen erreicht werden. Der einfachste davon ist Informationsgewinn. Durch das Einrichten einer gemeinsamen Institution – z. B. eines Vertrags mit Konsultationsmechanismus – treffen Akteure zusammen und können so Informationen über Motivationen, Politiken etc. der anderen Seite erhalten. Unsicherheit wird so teilweise reduziert – teilweise, weil die Möglichkeit der Nichterfüllung der Kooperationsabsicht bestehen bleibt. Verschiedene andere Mechanismen sind jedoch in der Lage, auch dieses Problem des Betrugs oder der Untreue – in spieltheoretischer Sprache (game theorygame theorySpieltheorie) cheatingcheatingSpieltheorie genannt – zu bewältigen. So fand Robert Axelrod (1984, Kap. 1) heraus, dass der so genannte shadow of the futureshadow of the future die Wahrscheinlichkeit von cheating verringert. Da bei wiederholtem Handeln die Wahrscheinlichkeit besteht, erneut auf dieselben Akteure zu treffen, würde unnötiges cheating zu einer Belastung zukünftiger Interaktionen führen, deren Kosten erhöhen und somit den eigenen Interessen zuwiderlaufen.1 Ebenfalls besteht bei wiederholter Kooperation in Institutionen ein Transaktionskostenvorteil, da die Institution nicht jedes Mal wieder neu aufgebaut werden muss, wenn sie einmal geschaffen wurde – die Kosten für Zusammenarbeit sind versunken („sunk costssunk costs“, Stinchcombe zitiert nach Keohane 1984, 102). Somit haben Institutionen langfristig das Potential, Kosten-Nutzen-Kalkulationen der in ihr organisierten Akteure zu verändern. Mehr noch: Durch wiederholte Kooperation kann sich auch eine Kooperationsnorm entwickeln, die wiederum normkonformes Verhalten der Akteure fördert und nicht-normkonformes Verhalten sozial bestraft. Langfristig ist es so also denkbar, dass Staaten ihre Interessen zunehmend so formulieren, dass sie von vornherein kooperationskompatibel sind (Wallander et al. 1999, 9f.). Gerade mit Bezug zur deutschen Außenpolitik wurde eine derartige Erklärung ihres kooperativen und multilateral-integrativen Impetus über die vergangenen Jahrzehnte immer wieder vorgebracht (Hellmann 2007; Wallander 1999, 148ff.).