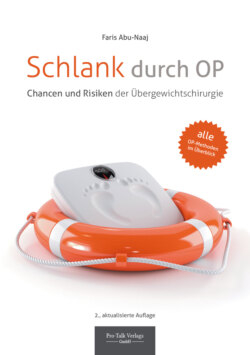Читать книгу Schlank durch OP - Faris Abu-Naaj - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Body-Mass-Index
Das Maß aller Dinge?
Fachbeitrag von Chefarzt Prof. Dr. med. Andreas Türler und leitenden Oberarzt Dr. med. Min-Seop Son vom Kompetenzzentrum für Adipositaschirurgie der Evangelischen Kliniken Bonn GmbH, Johanniter-Krankenhaus
In diesem Buch ist häufig die Rede vom Body-Mass-Index. Aus diesem Grund möchten wir Sie in diesem Kapitel ausführlich über diese »Größe« informieren. Der Body-Mass-Index (BMI) wurde 1835 von dem belgischen Mathematiker und Astronomen Adolphe Quetelet entwickelt. Im Rahmen seiner anthropometrischen Studien versuchte er, den »mittleren Menschen« (französisch: »homme moyen«) mit einer mathematischen Formel zu erfassen. Zu diesem Zweck setzte er das Körpergewicht in Relation zum Quadrat der Körpergröße.
In der Annahme, dass ein Abweichen von der Norm mit einem höheren Erkrankungsrisiko einhergeht, nahmen amerikanische Versicherungen Mitte des letzten Jahrhunderts den BMI zur Berechnung der Beitragshöhe ihrer Policen zu Hilfe. Auch in Deutschland spielt der BMI im Rahmen der Gesundheitsprüfung für die Verbeamtung eine wichtige Rolle. Zudem wendet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den BMI seit 1995 in einer international gültigen Gewichtsklassifikation an.
| Klassifikation | BMI (kg/m2) |
| Untergewicht | < 18,50 |
| Normalgewicht | 18,50 – 24,99 |
| Übergewicht | 25,00 – 29,99 |
| Adipositas | ≥ 30,00 |
| Adipositas-Grad 1 | 30,00 – 34,99 |
| Adipositas-Grad | 2 35,00 – 39,99 |
| Adipositas-Grad 3 | ≥ 40,00 |
BMI-Klassifikation nach WHO-Standard
Der Vorteil des BMI liegt in der einfachen Anwendbarkeit. Insbesondere im Rahmen von Studien gewährleistet der BMI eine sichere Vergleichbarkeit von Ergebnissen.
Der große Kritikpunkt ist allerdings, dass der BMI die individuelle »Körperkomposition« unberücksichtigt lässt. Tatsächlich wird die unterschiedliche Gewebemasse von Muskulatur oder Fettgewebe nicht bewertet. So geht ein hoher Körperfettanteil mit einem entsprechend hohen BMI einher. Umgekehrt ist auch ein leicht erhöhter BMI bei muskulösen Sportlern zu beobachten, da das Muskelgewebe schwerer ist als das Fettgewebe. Ferner unberücksichtigt bleiben Alter, Geschlecht und Fettverteilung.
In diesem Zusammenhang ist auch das sogenannte »Adipositasparadoxon« zu nennen. Unter diesem Begriff wird die Tatsache zusammengefasst, dass Übergewichtige bei bestimmten Erkrankungen eine bessere Prognose haben als normalgewichtige Menschen. Somit scheint der BMI ein ungenauer Faktor zu sein, um die Gesundheit eines Menschen zu bewerten.
Verschiedene Studien haben außerdem belegt, dass gerade die geschlechtsspezifische Fettverteilung einen erheblichen Einfluss auf die Ausbildung von Begleiterkrankungen hat. Während Frauen eher unter einer bein- und gesäßbetonten Fettverteilung (»Birnentyp«) leiden, liegt der Hauptspeicherort des Fettes bei Männern meist im Bauchbereich (»Apfeltyp«).
Insbesondere das sogenannte »viszerale Fett« (Bauchfett) ist mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko verbunden. So setzt dieses Fett große Mengen an Proteinen (Adipokine) frei, die wiederum Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper nachhaltig beeinflussen. Mehrere Studien sehen eine erhöhte Rate an Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- und Krebserkrankungen als Folge dieser Fetteinlagerung an. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, den Bauchumfang auszumessen, der zwischen dem höchsten Punkt des Beckenkammes und dem unteren Rippenbogen bei mittlerer Atemlage liegt. Der Bauchnabel selbst ist hierfür ein ungeeigneter Orientierungspunkt, da er sich bei stark übergewichtigen Menschen in seiner Position verschiebt und somit stärkeren Schwankungen unterworfen ist. Dabei liegt bei Frauen ein geringes Erkrankungsrisiko ab einem Umfang von 80 cm und ein erhöhtes Risiko ab einem Umfang von 88 cm vor. Bei Männern liegen diese Grenzen bei 94 und 102 cm.
Um das individuelle, körpergewichtsabhängige Erkrankungsrisiko besser einschätzen zu können, suchte man nach Alternativen zum BMI (Prädiktoren). So wird zunehmend der Taillenumfang in Relation zum Hüftumfang (Waist-to-Hip-Ratio, WHR) oder zur Körpergröße (Waist-to-Height-Ratio, WHtR) gesetzt.
Vergleichsstudien zeigen, dass der WHtR bessere Rückschlüsse auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sterblichkeit zulässt als der BMI, der WHR oder das alleinige Ausmessen des Bauchumfanges. Tatsächlich schneidet der BMI als Variable vielfach am schlechtesten ab.
In diversen Studien wird ein WHtR-Wert von 0,5 häufig als Grenze von Normal- zu Übergewicht angegeben. Der Bauchumfang sollte also höchstens die Hälfte der Körpergröße messen. Allerdings ist hierbei nicht zu vergessen, dass die Vergleichbarkeit durch unterschiedliches Ausmessen des Bauchumfanges nicht immer zuverlässig möglich ist.
Es lässt sich zusammenfassen, dass der Body-Mass-Index als Prädiktor ungeeignet ist, um Stoffwechsel-, Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankungen vorauszusagen. Tatsächlich scheint der WHtR zum heutigen Zeitpunkt die vielversprechendste Möglichkeit zu sein, Körpergewicht und Gesundheitsrisiko in Zusammenhang zu bringen. Zukünftige Aufgabe wird es sein, eine allgemeingültige Klassifikation (entsprechend dem BMI) zu etablieren. Weil der Body-Mass-Index jedoch nach wie vor von den meisten Medizinern, Behandlungszentren und Organisationen angewandt wird, werden Sie in diesem Buch immer wieder auf diese Messgröße treffen.
»BMI – nicht immer das Maß aller Dinge!«
Interviw mit Dr. med. Min-Seop Son, leitender Oberarzt des Kompetenzzentrums für Adipositaschirurgie der Evangelischen Kliniken Bonn GmbH, Johanniter-Krankenhaus
Warum konnte sich der BMI in der Medizin etablieren?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist der BMI Grundlage für eine der ältesten Gewichtsklassifizierungen, die wir kennen. Obwohl der BMI lediglich ein grober Richtwert ist, da er weder Statur und Geschlecht noch die individuelle Zusammensetzung der Körpermasse aus Fett- und Muskelgewebe eines Menschen berücksichtigt, machte ihn genau diese Einfachheit bei Wissenschaftlern so beliebt. Schließlich ermöglicht dieser Wert eine sachbezogene Gewichtsklassifizierung, die sich in Studien und Statistiken sehr einfach »verarbeiten« lässt. Sicherlich hat auch die Anwendung des BMI durch die amerikanischen Versicherungsgesellschaften zur Etablierung dieser Vergleichsgröße beigetragen. Gleiches gilt natürlich im verstärkten Maß auch für die Weltgesundheitsorganisation, die den BMI bereits seit 1980 verwendet und mit dieser Größe seit 1995 die unterschiedlichen Schweregrade der Adipositas klassifiziert.
Trotzdem gibt es mittlerweile BMI-Rechner, die sowohl Geschlecht als auch Alter in ihre Berechnung einfließen lassen.
Ja, das stimmt! Hier liegt wohl die Motivation darin, dass man die Schwächen des BMI erkannt hat und weitere Faktoren in diese Messgröße einfließen lassen möchte. Jedoch bedingt diese gesteigerte Komplexität auch eine höhere Fehleranfälligkeit in der Vergleichbarkeit.
Wird der BMI bald von genaueren Klassifizierungsgrößen abgelöst?
Wie Prof. Türler und ich bereits ausführten, existieren diese genaueren und effektiveren Klassifizierungsgrößen bereits. Nur wird es sehr schwer sein, eine weltweit etablierte Größe wie den BMI abzulösen. Funktionieren würde das auch nur dann, wenn Gesundheitsorganisationen, Mediziner, Forschungseinrichtungen und Statistiker dies bewusst initiieren. Ich will nicht sagen, das wird nie passieren, jedoch kostet es sicherlich viel Zeit, und die Notwendigkeit dafür bewertet jede Interessengruppe wahrscheinlich sehr unterschiedlich. In ganz anderen Bereichen unseres täglichen Lebens ist das übrigens ähnlich. Während beispielsweise viele Menschen Kilowatt (kW) für die geeignetere Maßeinheit halten, die Leistung eines Fahrzeuges zu berechnen, spricht der Großteil nach wie vor von der guten alten Pferdestärke (PS).
Für welche Menschen ist die Klassifizierung ihrer Gewichtssituation durch den BMI also ungeeignet?
Da Kinder und Jugendliche verschiedene Wachstumsphasen haben, lassen sie sich auch nicht immer eindeutig mit dieser Größe klassifizieren. So kann ein Jugendlicher, der mit 13 Jahren als stark übergewichtig gilt, weil seine Körpergröße im Verhältnis zum Gewicht dies aussagt, nach 12 Monaten durchaus wieder als normalgewichtig gelten, wenn er plötzlich eine starke Wachstumsphase durchläuft.
Ich bin der Ansicht, dass der BMI für eine einfache Gewichtsklassifizierung durchaus geeignet ist. Um jedoch die individuelle und spezifische Gewichtssituation genau einschätzen zu können, sind sowohl der WHtR als auch der WHR besser geeignet.