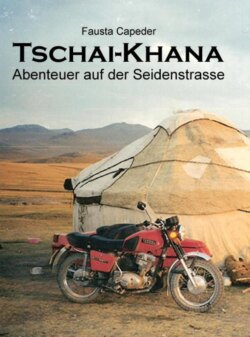Читать книгу Tschai Khana - Fausta Nicca Capeder - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Jordanien: Beduinen und Wüstenschlösser
Оглавление1Anfang März 1996. In Amman regnet es in Strömen. Trotzdem machen wir einen Spaziergang durch die Innenstadt zum römischen Amphitheater. Das Wasser läuft nirgends ab und riesige Pfützen bilden sich überall. Autos bespritzen uns von Kopf bis Fuss. Mit lautem Gehupe schleicht die Blechlawine durch die verstopften Strassen. Viele Männer haben das schwarz-weisse oder rot-weisse Arabertuch (Mandil), das mit dem schwarzen Ring (Agal) gehalten wird, um ihren Kopf geschlungen, alte Männer haben darunter noch das Dagiya genannte Moslemkäppchen aufgesetzt. Die Frauen tragen ein Kopftuch, sind aber ansonsten recht modern angezogen. Wir sehen sehr viele teure Autos, vor allem Mercedes. Von den ungefähr eineinhalb Millionen Einwohnern Ammans sind nur knapp zwei Drittel Jordanier, 600’000 sind Palästinenser. In Jordanien leben neben 500’000 Ägyptern und 170’000 Syrern auch Pakistanis, Inder und Inderinnen, Menschen aus den Philippinen, Sri Lanka, Bangladesch und andere. Diese machen vor allem die bei den Einheimischen nicht so beliebten Arbeiten und verdienen dabei trotzdem viel mehr als daheim. Der Durchschnittslohn beträgt etwa 150-200 USD pro Monat. Krankenversicherungen und Altersrenten gibt es, Arbeitslosengeld jedoch bekommt niemand. Die meisten Ausländer arbeiten sowieso illegal.
Im Hashem Restaurant, rund um die Uhr geöffnet, ist Hochbetrieb. Auch an den kleinen Fruchsaftbars steht immer eine Traube von durstigen Leuten. Kebab-Buden und andere Schnellimbiss-Stände, Souvenirshops, Kleider-, Schmuck- und sehr viele Süssigkeitenläden prägen das Strassenbild. Die Süsspeisen haben in den arabischen Ländern eine grosse Tradition. Baklawa, Harisse, Karabidsch, Ghoraybiyeh, Muhallabiyeh und wie sie sonst noch alle heissen, sind mit Rosen- und Orangenblütenwasser parfümierte, meist sirupgetränkte Teigtäschchen, Puddings, Kekse, Konfekt und öltriefendes Spritzgebäck. Kunafeh wird eine Mehlspeise aus extrem dünnem und vielschichtigem Blätterteig genannt, die in heissem Öl gebacken, mit allerlei Nüssen gefüllt und mit gerösteten Teigfäden bestreut wird.
Mit «what is your country, my friend?» oder «welcome to Jordan!» werden wir immer wieder angesprochen. Die Jordanier sind ausserordentlich freundliche Menschen, lächeln uns an und wollen immer wieder wissen, woher wir kommen. Die erste Begegnung mit der arabisch-orientalischen Welt beeindruckt mich sehr. Ich weiss nicht, wie die Syrer sind, aber die Jordanier sind mir heute schon sympathisch.
Weil es ununterbrochen regnet und noch recht kalt ist, beschliessen Thomas und ich am zweiten Tag, mit dem nächsten Bus in den Süden zu fahren. Mit einem «super-deluxe» Bus bringen wir die trostlosen, langweiligen 340 km durch die Wüste hinter uns und kommen zum Badeort Aqaba, am Golf von Aqaba, am Roten Meer.
Von unserem kleinen Hotel sind es nur hundert Meter bis zum Strand, wo man Glasbodenboote und Schnorchelausrüstung mieten kann. Die ganze Stadt strahlt eine sehr friedliche und ruhige Atmosphäre aus. Breite schöne Boulevards, von Palmen gesäumt, und Promenadenwege führen dem Sandstrand entlang. Ein paar alte Männer sitzen auf Korbstühlen in einem Strandcafé und saugen an den Nargileh, den Wasserpfeifen mit den gläsernen, wunderschön gearbeiteten Rümpfen, auf die sie die Tabakröllchen samt der glühenden Holzkohle legen. Sie sind mit kunstvoll geschmiedeten Aufsätzen aus Messing versehen und einem Mundstück, das meistens aus Meerschaum ist und aus Eskisehir in Westanatolien stammt.
Als Tabak um das Jahr 1600 im Orient aufkam, erklärten orthodoxe Korangelehrte seinen Genuss zum rituell unreinen Akt. Tabak wurde hauptsächlich von Mystikern konsumiert. Unter Sultan Murat IV., der von 1623 bis 1640 regierte, wurde sogar mit dem Tode bestraft, wer ihn dennoch rauchte. Angebaut wurde Tabak vor allem in Mazedonien, Nordgriechenland und Anatolien.
Wir gehen in das kleine Beduinen-Dörfchen und trinken mit diesen stolzen und schönen Leuten Tee. Die Verkäufer in den Souvenirläden sind nicht aufdringlich und wir lernen Elias kennen, der verschiedenfarbigen Sand in kleine Flaschen abfüllt. Auch er lädt uns zum Tee ein. Wir diskutieren lange mit ihm auf dem Trottoir und finden heraus, dass die Jordanier nach dem Motto «leben und leben lassen» in den Tag hinein leben. Man muss beim Einkaufen schon feilschen, aber hier habe ich nicht das Gefühl, über den Tisch gezogen zu werden; das Ganze findet immer mit einem Lächeln statt.
Viele kleine Restaurants servieren herrliche arabische Speisen und zum ersten Mal probiere ich Baba Khanudsch, Auberginenpüree, und Homoss, Kichererbsenpaste, mit Fladenbroten. Ich liebe die arabische Küche!
Eine Legende besagt, dass im 16. Jahrhundert in Mokha am Roten Meer ein gewisser Ali ibn Omar al-Schadhili, Scheich des kleinen Hafens, vorbeisegelnden Kaufleuten aus Portugal ein seltsames schwarzes Gebräu auftischte, das er aus gerösteten, zerstampften und in Wasser aufgekochten Bohnen zubereitet hatte. Die Kaufleute waren begeistert vom Aroma und der kräftigenden Wirkung des Getränks und nahmen angeblich sofort mehrere Säcke der grünen Bohnen an Bord ihrer Handelsschiffe. Historiker bezweifeln, dass der Kaffee tatsächlich über Portugal nach Europa gelangte. Vielmehr sollen südarabische Derwische den stimulierenden Effekt des ursprünglich aus der äthiopischen Provinz Kaffa importierten Samens als erste erkannt und dazu genutzt haben, die Ekstasen während ihrer religiösen Übungen zu verlängern. Die Derwische propagierten ihn dann im gesamten Osmanischen Reich. Erst im 17. Jahrhundert erfasste die Koffeinsucht Europa. Der Kaffee stammte damals fast ausschliesslich aus dem Hochland des Jemen auf der Arabischen Halbinsel. Und der mit Abstand wichtigste Ausfuhrhafen war Mokha. In der Zwischenzeit ist der südarabische Kaffee längst von anderen Sorten aus dem Weltmarkt verdrängt worden. Die Jordanier servieren uns arabischen Kaffee mit gemahlenem Kardamom, um ihm seine Bitterkeit zu nehmen. Ausserdem soll der Kardamom bei der Verdauung der fettigen Speisen helfen.
Das Wetter ist wunderbar warm und der blaue Himmel fast wolkenlos. Gorbatschow, den wir gestern bei Elias kennengelernt haben, holt uns ab. Er ist Taxifahrer und nennt uns keinen anderen Namen. Wir fahren dem Strand entlang nach Süden bis an die saudiarabische Grenze. Schöne Sandstrände wechseln sich ab mit grässlichen Hafenanlagen, wo irakische Tanker zum Teil seit fünf Jahren - seit dem UN-Embargo gegen den Irak - arbeitslos herumliegen. Die UNO führt einen Wirtschaftskrieg gegen das irakische Volk. Hat sie das Recht, das irakische Volk verhungern zu lassen? Gleichzeitig sagt die UNO nichts zu den UNO-Resolutionen, die Israel verletzt hat. In unserem Hotel in Amman war eine Weltkarte an die Wand geklebt, worauf das Wort «Israel» unleserlich gestrichen worden war. Kein Jordanier, mit dem wir über Politik gesprochen haben, hat sich je positiv über den Diktator Saddam Hussein geäussert, aber wir stellen eine grosse Solidarität mit dem unterdrückten irakischen Volk fest. Die Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Nationen treffen etwa 20 Millionen unschuldige Zivilisten, während sich die Elite davon sowieso nicht beirren lässt…
Vor den Stränden befinden sich wunderbare Korallenriffe. Ich habe allerdings keine Lust, zu schnorcheln; das Wasser ist mir zu kalt. Mehr als 140 verschiedene Korallen wurden hier schon identifiziert und in der Unterwasserwelt des Roten Meeres leben dutzende Korallenarten und Fische, die nirgendwo anders auf der Welt vorkommen.
Zwischen hässlichen Phosphatfabriken und parkierten Lastwagen sehen wir den Passagierterminal für die Fähren nach Ägypten. Zu unserer Linken beginnt Saudi-Arabien, wir stehen auf jordanischem Boden, vis-à-vis ist die Sinai-Halbinsel von Ägypten und dazwischen befindet sich die moderne israelische Stadt Eilat. Nachts ist sie hell erleuchtet. Wir können uns keinen israelischen Stempel im Pass erlauben, sonst lassen uns später die Iraner nicht mehr einreisen!
Nach unserem kleinen Ausflug an die Saudi-Grenze holen wir mit Gorbatschow Barbara und Hubert ab, zwei Deutsche, die wir gestern in einem der zahlreichen kleinen Strandcafés kennengelernt haben. Wir fahren zusammen in die Wüste zum Wadi Rum, dem spektakulären und geschichtsträchtigen Tal. Thomas Edward Lawrence, der von 1888 bis 1935 gelebt hat und als Entdeckungsreisender und Archäologe besser bekannt war unter dem Namen Lawrence of Arabia, «ungekrönter König von Arabien», marschierte auf seinem Feldzug gegen die Türken durch dieses Gebiet.
Leider ist diese grandiose Landschaft sehr touristisch, die Beduinen haben hier das Monopol und nützen das schamlos aus, indem sie für eine zwei- bis dreistündige Geländewagenfahrt durch diese herrliche Gegend sehr hohe Preise verlangen. Unser Fahrer ist ein 13jähriger Rowdie. So muss eine Camel-Trophy sein! Wir besichtigen 2000 Jahre alte Felsmalereien und ungewöhnliche Gesteinsformationen. Der Sonnenuntergang taucht schliesslich die ganze Landschaft und die Felsen in immer andere Farbschattierungen, bis der rote Feuerball hinter dem Horizont versinkt.
2Die rosarote Stadt Petra war die Hauptstadt eines Königreiches, das im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung von den Nabatäern gegründet wurde. Vor langer Zeit Nomaden, später mit dem Ruf, Piraten gewesen zu sein, wurden die Nabatäer Händler und Kaufleute, die auf den alten Karawanenrouten, die China, Indien und Südarabien mit dem Nahen Osten, Griechenland und Rom verbanden, mit Weihrauch, Gewürzen und Seide handelten. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht erstreckte sich das Nabatäische Königreich bis über Damaskus, Nordarabien und Teile der Sinai- und Negevwüste.
Petras wachsender Einfluss und Wohlstand wurde dem Römischen Reich ein Dorn im Auge und im Jahre 106 n. Chr. annektierte Kaiser Trajan das Königreich der Nabatäer und integrierte es in die Römische Provinz Arabien, mit Petra und später Bosra (im heutigen Syrien) als Hauptstadt. Nachdem die Römer aber die alten Handelsrouten unter ihre Kontrolle gestellt hatten und mehr Karawanen über Bosra reisten, verfiel Petra langsam. Das Christentum breitete sich über das ganze Byzantinische Reich aus und erreichte im 4. Jahrhundert auch Petra. Nabatäer wurden getauft, Petra wurde der Sitz eines Bischofs und Kirchen wurden errichtet, gefolgt von Gräbern. Vor der Eroberung der Moslems im 7. Jahrhundert zerstörten diverse Erdbeben die meisten Bauten von Petra. Die Moslems fanden die Stadt bereits fast unbewohnt. Im Mittelalter brachten die Kreuzritter etwas Leben zurück und unter Balduin I. wurden 1116 zwei Schlösser gebaut.
Die lebhaften und präzisen Beschreibungen eines gewissen Sultan Baibar, der Petra 1276 auf seinem Weg von Kairo nach Kerak besuchte, erregten das Interesse eines jungen Schweizer Reisenden namens Johann Ludwig Burckhardt (1818-1897), der zum Islam übergetreten war. Er war der erste Westler in sechs Jahrhunderten, der Petra zu sehen bekam. Die Felsenstadt war von den Europäern vergessen worden. Sie war nur von einem Stamm Beduinen und ihren Tieren bewohnt. Auf seiner Reise von Damaskus nach Kairo, auf dem Weg zur Quelle des Flusses Niger, hörte er die Legenden der sagenumwobenen Ruinenstadt Petra und verkleidete sich als Araber, gab sich als Ibrahim ibn Abdallah aus und erklärte den im Wadi Musa lebenden Beduinen, dass er auf dem Berg mit dem Grab von Aaron eine Ziege opfern wolle. Am 22. August 1812 entdeckte er zwei Gräber und schrieb in sein Tagebuch, dass diese Ruinen sehr wahrscheinlich zur verlorenen Stadt Petra gehören…
Die Busfahrt von Aqaba nach Wadi Musa bei Petra dauert nur zwei Stunden. Wir lernen Marilyn kennen, eine 50-jährige Kanadierin, die in Saudi-Arabien in einem Militär-Camp arbeitet und Krankenschwestern ausbildet. Mit ihr teilen wir nun ein Dreierzimmer im Hotel Twaissi. Von unserer Dachterrasse aus haben wir einen grandiosen Ausblick auf diese wilde Landschaft mit vielen felsigen Bergen. Weil es schon Nachmittag ist, empfiehlt uns der Rezeptionist, zuerst nach «Little Petra» zu fahren, sozusagen als Einstieg.
Wir fahren mit Marilyn in einem Taxi zu dieser kleinen Schlucht, wo die Nabatäer vor bis zu 9000 Jahren schon Räume und Höhlen in die Felsen gehauen hatten. Erst viel später kamen römisch-griechische Einflüsse hinzu, die Wände wurden mit Stuck verputzt und zum Teil bemalt. Diese Felslandschaft ist unglaublich spektakulär, dazwischen grasen malerisch die Schafe und Ziegen des Beduinenstammes, der seine schwarzen langen Zelte vor dem Eingang der Schlucht aufgeschlagen hat. Die Beduinen sind sehr gastfreundlich und laden uns zum Tee ein. Aus der Hauptstadt Petra wurden sie vertrieben. Der Staat hat ihnen neue Wohnungen mit fliessendem Wasser und Elektrizität zur Verfügung gestellt.
Am folgenden Morgen stehen wir um sechs Uhr auf und machen uns auf den Weg zu einer der interessantesten und ältesten historischen Stätten der ganzen Welt. Am unteren Ende der neuen Stadt Wadi Musa stehen wir vor dem Eingang des Siq, der ungefähr einen Kilometer langen, zum Teil nur zwei Meter breiten, aber bis zu 200 Meter tiefen Schlucht. Sie bildet den einzigen Eingang in die ehemalige Hauptstadt der Nabatäer, die sich über ein riesiges Tal erstreckt, das von Felsen und Bergen eingerahmt ist. An der Felswand erkennen wir die Furche für das Wasser, das ausserhalb der Schlucht aus einem Fluss gezapft und in die Stadt geleitet werden musste. Weil es im alten Petra keine Wasserquellen gab, war es für die Römer auch einfach gewesen, Petra einzunehmen; sie haben den Nabatäern die Wasserzufuhr unterbrochen!
Die Pauschaltouristen steigen auf die bereitstehenden Pferde, wir gehen zu Fuss. Es ist äusserst spannend. Hinter jeder Kurve erwarten wir das Al-Khazneh, ein in die Felswand gehauenes Kunstwerk aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, das das monumentale Grab für einen nabatäischen König, wahrscheinlich Aretas III., werden sollte und unzählige Touristenprospekte ziert. Endlich erreichen wir diese weltberühmte Fassade, die etwa 40 Meter hoch ist, und halten die Luft an. Mythologische Figuren und nabatäische Götter, verbunden mit dem Kult der Toten, ziehen uns in ihren Bann.
Beduinen wollen uns ihre Esel vermieten, aber wir lehnen dankend ab, weil wir zu Fuss gehen möchten. Wir sind in eine andere Welt gestossen. Wie muss sich wohl Burckhardt gefühlt haben, als er all dies entdeckte? Wir schlendern zum Amphitheater, das vor ungefähr 2000 Jahren, in der Regierungszeit von König Aretas IV., aus dem Felsen gehauen wurde und klettern auf den Ruinen herum. 40 Reihen konnten bis zu 8500 Zuschauern Platz bieten. Ich frage mich, wie wohl weibliche Hoheiten in sicher sehr eleganten Gewändern diese hohen Steinstufen rauf- und runtergekraxelt sind? Das Erdbeben von 336 hat das meiste zerstört und hinterliess ein riesiges Ruinenfeld. Dann steigen wir einen Berg hinauf und klettern über in Felsen gehauene Treppenstufen zu einem grossen Platz, der als bester noch erhaltener heiliger Opferplatz der altertümlichen Welt gilt. Wir befinden uns 1035 Meter über dem Meeresspiegel. Zwei sieben Meter hohe Steinobeliske repräsentieren Dushara und Al’ Uzza, die zwei wichtigsten nabatäischen Götter.
Als wir auf der anderen Seite wieder hinabklettern, kommen wir zum «Grab des römischen Soldaten», das nach dem Jahre 106 in die Felswand gemeisselt worden sein muss. Jetzt sehen wir das einzige freistehende Gebäude von Petra, das Quasr al-Bint, den Palast des Königs. Es sind jedoch nur Säulen erhalten geblieben. Auch die lange gerade Kolonnade ist von Säulen gesäumt. Zweitausend Jahre alte Säulen!
Hier haben die Beduinen grosse Zelte aufgestellt, um die zahlreichen Touristen zu bewirten. In der Nacht sind wir fast erfroren und weil es früh morgens immer noch sehr kalt war, haben wir uns dementsprechend warm angezogen. Jetzt scheint die Sonne wieder über dieser Wüstenstadt. Weil wir anstrengende Besichtigungstouren unternehmen, kommen wir ganz schön ins Schwitzen und geniessen die Annehmlichkeit der Getränkestände.
Es geht nun steil bergauf zum wohl allerschönsten Monument, dem Kloster Ad-Deir, Petras grösstem Monument mit einer 45 x 50 Meter grossen Fassade. Es war ein Tempel oder auch ein königliches Grab und sicher ein sehr wichtiges Pilgerziel. Seit dem 4. Jahrhundert wurde es während der christlich-byzantinischen Ära als Kloster bekannt. Hier auf dem höchsten Hügel haben sich zwei junge Beduinen in einer Höhle eingerichtet. Sie übernachten auf mitgebrachten Teppichen und verkaufen am Tag Getränke und Souvenirs an Touristen. Wir sitzen lange bei ihnen und plaudern, bevor wir uns wieder auf den Weg machen und zurück ins Hotel gehen. Wir waren mehr als 12 Stunden auf den Beinen und haben immer noch nicht alle Sehenswürdigkeiten von Petra gesehen!
Den Abend verbringen wir mit Marilyn im Ali Baba-Restaurant bei einheimischen Köstlichkeiten. In den Gasthäusern wird überall der Video «Jäger des verlorenen Schatzes» gezeigt, weil dieser Film zum Teil in Petra gedreht wurde. Ich bin sehr froh, dass die gesprächige Marilyn bei uns ist, denn Thomas ist sehr introvertiert und verschlossen. In Jordanien gibt es viel mehr Touristen, als ich mir vorgestellt habe. Es ist nicht mehr so ein «Geheimtipp». Jeden Abend sitze ich mit ein paar Gleichgesinnten aus Europa und Australien um den wärmespendenden Ofen und diskutiere. Es sind sehr interessante Leute dabei und ich lerne viel von ihnen. Ausserdem bekomme ich viele Tipps für die Länder, die ich noch vor mir habe.
Am nächsten Tag wandern wir nochmals Kilometer um Kilometer auf den Spuren von längst vergangenen Kulturen und klettern nochmals keuchend zum Kloster hinauf, um mit Qassan und Ismail Tee zu trinken. Beim Sextus Florentinus Grab, das um 130 n. Chr. für den römischen Gouverneur der Provinz Arabien von seinem Sohn gebaut wurde, bestaunen wir die Kombination von römischen und nabatäischen Architekturmotiven. Ich will hier nicht alle Monumente aufzählen, kann aber mit Sicherheit behaupten, dass wir auch nach zwei ganzen Tagen in Petra noch nicht alles gesehen haben.
Weil ich gestern Abend so lange mit Ataf, dem Hotelinhaber, geplaudert und Arrak (Anisschnaps) getrunken habe, fror ich nicht so entsetzlich in meinem Schlafsack. Ich konnte auch gleich einschlafen. In meinem Kopf drehte sich alles. Beim Frühstück wimmelt es von Holländern, Franzosen, Deutschen, Japanern und Taiwanerinnen in der Hotelhalle und ich bin froh um plaudernde Gesellschaft.
Marilyn hat uns gestern verlassen. Thomas und ich fahren mit einem Schulbus bis nach Shobak, stellen uns auf die Strasse und halten den Daumen raus. Das dritte Fahrzeug hält an. Der Fahrer des Minibusses vergewissert sich drei Mal, ob wir auch wirklich keine Juden seien und lässt uns schlussendlich einsteigen. Es handelt sich um einen Palästinenser und das erklärt wohl, wieso das für ihn so wichtig ist. Wir diskutieren wie so oft in Jordanien über Politik und er erzählt uns seine Theorie des Golfkrieges von 1990: George Bush habe sich mit Saddam Hussein verbündet und zusammen hätten sie abgemacht, dass Saddam Kuwait annektieren solle. Danach kämen die ach so hilfsbereiten Weltpolizisten aus den USA und retteten Kuwait, zögen damit auch den grossen Nachbarn Saudi-Arabien auf ihre Seite und bekämen für den Wiederaufbau aller zerstörten Städte nachher natürlich die Aufträge. Und liessen sich dabei wohlverstanden auch ihre Hilfe von Japan, Deutschland, England & Co. finanzieren. Gutes Geschäft! Das ist, wie gesagt, die Theorie unseres dabei recht laut gestikulierenden Fahrers.
Wir sind auf dem Old Kings Highway, der alten Hauptstrasse, die den Süden mit dem Norden verbindet. Im Zickzackkurs geht es über Hügel, durch kleine Dörfchen und an Beduinensiedlungen vorbei. Die Landschaft ist viel interessanter als die baumlose flache Wüste, durch die der moderne Desert Highway verläuft, auf dem wir nach Aqaba gefahren sind.
In Tafila bringt uns unser Fahrer zu einem Freund in einen Kleiderladen, weil er in diesem Städtchen ein paar Geschäfte erledigen muss. Sein Freund offeriert uns Tee und setzt sich zu uns. In einem anderen kleinen Dorf muss unser Fahrer wieder ein paar Geschäfte aufsuchen und lässt uns aussteigen. Wir setzen uns an den Strassenrand, knacken Pistazien und schauen einfach dem Treiben auf dem Dorfplatz zu. Ein paar alte Männer gesellen sich zu uns und fragen, woher wir kommen. Da halten zwei Autos an, um uns zu fragen, ob sie uns irgendwohin mitnehmen können! Das ist mir noch nie passiert, dass mich - ohne Autostopp gemacht zu haben - einer mitnehmen will!
Später erklärt uns unser Fahrer, dass er im Falle einer Autopanne in Jordanien sogar noch zu später Stunde einfach an die nächste Haustüre klopfen könne und die Bewohner dieses Hauses würden ihn wie einen Gast behandeln, ihm zu essen geben und ein Bett zum Schlafen herrichten. Das sei islamische Gastfreundschaft. Ich denke an die Schweiz und schäme mich… Dann fragt er uns schmunzelnd, ob wir eigentlich keine Angst gehabt hätten, dass er uns nicht mehr abholen würde? Unsere Rucksäcke waren ja in seinem Wageninnern zwischen den Kisten mit T-Shirts, Hemden und Blusen verstaut, die er verkaufen muss. Nein, wir haben ihm einfach vertraut.
Vier Stunden fahren wir mit ihm und er macht sogar noch einen Umweg, um uns nach Kerak zu bringen und uns vor einem Hotel abzusetzen. Als ich ihm ein Trinkgeld geben will, winkt er ab. Als ich es ihm mit den Worten «fürs Benzin» abermals hinhalte, wird er fast wütend.
3Das Kreuzritterschloss von Kerak hat Kreuzritter Balduin I. im Jahre 1136 bauen lassen. Es ist eine stattliche Bauruine. Vom vergangenen Glanz ist leider nicht viel übrig geblieben. Die ganze Burg ist etwa 300 Meter lang. Vor allem die unterirdischen Gänge und eine 150 m lange Halle sind interessant.
Am Nachmittag machen wir einen Busausflug ans Tote Meer. Dieser See befindet sich am tiefsten Ort der Erde, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. In einer Wüstenlandschaft mit Beduinenzelten, Schafherden, Bauernhöfen und bebauten Gemüsefeldern. Die Ufer des Binnenmeeres kann man nicht als schöne Strände bezeichnen. Da es keine Duschen gibt, um sich nachher das extrem salzige Wasser abzuwaschen, halten wir nur die Füsse ins Wasser. Es ist so salzig, dass ein Fisch nur eine Minute darin überleben würde. Und schmeckt scheusslich.
Mohammad und Ibrahim, zwei Brüder, die des Weges gekommen sind, machen mit herumliegendem Holz ein Feuer und wir setzen uns zu ihnen ans Lagerfeuer. Es ist so idyllisch hier, dass ich meine Schweizer Freunde von zu Hause sehr vermisse! Wie viel schöner wäre es, mit einer Freundin hier zu sitzen! Ich habe kein Heimweh nach der Schweiz, aber nach guten alten Freunden, mit denen ich mich unterhalten könnte.
Am Abend gehen wir in ein kleines Lokal mit einer gewölbten Kuppel. Der Inhaber spricht kein Englisch, öffnet aber seinen Kühlschrank und wir zeigen einfach auf die Speisen, die er für uns aufwärmen soll. Das Essen in Jordanien besteht meistens aus Poulet- oder Schaffleisch mit Reis. Die Vorspeisen sind abwechslungsreicher: Auberginen, Kichererbsen, Sesampaste, Joghurt, Knoblauch, Salate, Kräuter und Gewürze. Immer gibt es ofenwarmes frisches Fladenbrot dazu. Und zum Dessert natürlich honigsüsses Baklava.
Als wir ins Hotel zurückkommen, spielt ein junger Mann auf einer Lut, einer Art Gitarre mit elf Saiten. Mit acht anderen Touristen lauschen wir seinen wunderschönen traditionellen Liedern und tauschen Reiseerlebnisse aus.
Der irakische Kellner Ja’ad versteht kein Englisch - ich leider kein Arabisch -, aber beim Frühstück in seinem gemütlich eingerichteten Café ahme ich heute morgen ein Huhn nach, worauf sich sein Gesicht mit einem breiten Lachen überzieht und er mir prompt ein Omelett aus zwei Eiern serviert!
Die Busverbindungen auf der alten Königsstrasse sind nicht sehr gut. So chartern wir einen Minibus nach Mount Nebo bei Madaba. Von diesem Berg schaute Moses zum ersten Mal auf das heilige Land hinunter. Die alte Kirche, die auf dem Berg steht, wäre sehr schön ohne Wellblechdach. In ihrem Innern auf dem Boden sind Mosaike aus dem 5. Jahrhundert erhalten geblieben. Auch in Madaba selbst ist in einer christlichen Kirche ein uraltes Mosaik zu bestaunen. Mit einer Landkarte des Nahen Ostens, dem Staat Palästina und Jerusalem als Hauptstadt. Schön wärs! Israel ist natürlich nicht drauf, es wurde erst 1948 gegründet.
30 km weiter kommen wir nach Hammamet Ma’in. In dieser wilden Schlucht mit heissen Quellen und Wasserfällen haben die Jordanier ein Wasserplanschzentrum mit römischen Bädern, Saunas, Swimming Pools, Liegewiesen, etc. gebaut. Da heute Samstag ist, wimmelt es von einheimischen Touristen. Im Alpamare Jordaniens plantschen die Männer in Badehosen während die Frauen in langen Kleidern mit Kopftüchern daneben stehen. Die moderneren Frauen ohne Kopftuch gehen mit Jeans und T-Shirts ins Wasser. Irgendwie stimmt es mich nachdenklich und fast ein wenig traurig.
4Jerasch ist das beste Beispiel einer römischen Provinzstadt, die sehr gut erhalten geblieben ist, weil sie lange unter Sand versteckt war. Sie wurde in der Zeit von Alexander dem Grossen, im Jahre 332 vor Christus erbaut. Erst 1806 wurde sie vom Deutschen Ulrich Seetzen wiederentdeckt.
Im Jahre 63 v. Chr. nahm der römische Feldherr Pompejus diese Region ein und Jerasch wurde Teil der römischen Provinz Syrien. Die nächsten 200 Jahre wurde mit den Nabatäern Handel geführt und Jerash sehr wohlhabend. Erst nach dem 5. Jahrhundert wurde das Christentum Hauptreligion. Es folgte eine persische Invasion im Jahre 614; die Moslem fielen 636 ein. Nach einer Serie von Erdbeben um 747 wurde Jerasch unbedeutend. Im 12. Jahrhundert wüteten die Kreuzritter.
Auf den original alten Sandsteinpflasterböden spazieren wir zum Amphitheater, durch Säulenhallen, in die Kathedrale, schreiten unter Riesenportalen hindurch, über ehemalige Marktplätze… Die ganze Stätte schätze ich fast zwei Kilometer lang. Sie ist einfach überwältigend!
Ich bin frustriert über meinen Reisepartner Thomas. Er ist so introvertiert und redet fast nie. Aber Emily Eden, Anna Leonowens, Amelia Edwards, Kate Marsden, Gertrude Bell, Daisy Bates und natürlich mein Vorbild Ella Maillart, alles Reisende des letzten Jahrhunderts, sind alle entweder alleine gereist oder auch mit jemandem oder mehreren, die sie nicht besonders gerne mochten. Ich muss jetzt bescheidener sein, ich kann nicht alles haben, die Reise und den besten Reisepartner. Die Hauptsache ist, ich bin hier! Eine Freundin hat mich vor meiner Abreise noch gefragt: «Kannst du auf der Seidenstrasse eigentlich Tampons kaufen?» Sie wäre wohl auch nicht die ideale Begleitung für mich gewesen.
Ein anderer Tagesausflug von Amman aus bringt uns in die Wüste nach Osten. Wir machen die «Wüstenschlösser-Rundreise» genannte Route und besichtigen das Qasr al-Hallabat, bei dem es sich eigentlich um ein römisches Fort handelt, das zwischen 198 und 217 n. Chr. zur Verteidigung von angreifenden Wüstenstämmen gebaut wurde und im 7. Jahrhundert als Kloster diente. Man braucht eine grosse Phantasie, um in dieser Ansammlung von Steinbrocken noch so etwas wir ein Fort erkennen zu können.
Weiter kommen wir zum Qasr Azraq, einem grossen Schloss aus schwarzem Basaltgestein. Griechische und lateinische Inschriften beweisen, dass es wahrscheinlich um das dritte Jahrhundert erbaut wurde. Seine jetzige Form stammt aus dem 13. Jahrhundert. Hier kamen die Hauptkarawanenrouten zusammen, weil es in dieser Oase Wasser gab. Auch für Vögel, die zwischen Afrika und Europa unterwegs sind, ist es eine der wichtigsten Oasen. Vor rund 600 Jahren nutzten die Omaijaden dieses Schloss als Militärbasis und im 16. Jh. hatten die osmanischen Türken hier eine Garnison. 1917 machte es Lawrence of Arabia zu seinem Wüstenhauptquartier.
Das wohl schönste Wüstenschloss ist das Qasr Amra von Kalif Walid aus dem 7. Jahrhundert. Alle inneren Wände sind bemalt, die Fresken sind ziemlich gut erhalten und zeigen unter anderem Julius Cäsar. Das Qasr al-Kharanah schlussendlich wurde als Schloss für Verteidigungszwecke gebaut und diente auch als Karawanserei. Ich liebe Karawansereien und diese hier ist besonders schön, ist sie doch recht gross und steht mutterseelenallein in der flachen Wüste. Sie hat vier gleich lange Wände und keine Fenster. Durch ein Tor gelangen wir in den Innenhof und sehen die Stallungen für die Kamele im Erdgeschoss und darüber die Gästezimmer für Händler und Reisende.
Am folgenden Tag müssen wir schon um sieben Uhr aufstehen und nehmen den Bus nach Damaskus. An der Grenze bin ich total nervös. Unsere Syrien-Visa sind bereits abgelaufen, bevor wir überhaupt einreisen. Wir haben sie am 4. Dezember 1995 ausstellen lassen und sie haben eine Gültigkeit von drei Monaten. Doch heute schreiben wir den 19. März 1996… Als sich die Uniformierten am Grenzübergang unsere Pässe genauer anschauen und bemerken, dass die Visa bereits abgelaufen sind, stellen wir uns dumm und erklären, wir hätten gemeint, wir können damit drei Monate in Syrien bleiben. Der Zöllner verschwindet für ein paar Minuten. Als er wieder auftaucht, klebt er ein paar Briefmarken in unsere Pässe und verlangt nur ein lächerliches Trinkgeld für die Verlängerung unserer Visa!