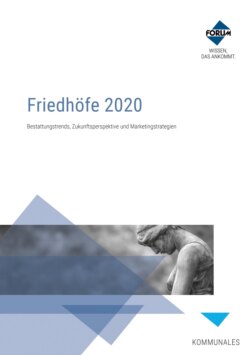Читать книгу Friedhöfe 2020 - Forum Verlag Herkert GmbH - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.4 Jüdische Bestattungen[1]
{Jüdische Bestattungen}
1.4.1 Entstehung und Entwicklung
Das Judentum ist neben dem Christentum und dem Islam mit rund 13,5 Mio. Anhängern die dritte große monotheistische Religion. Es lässt sich bis in das 2. Jahrtausend v. Chr. zurückverfolgen und war die erste Glaubenslehre, die sich weltweit verbreiten konnte. Gleichzeitig bildete die jüdische Überlieferung die Grundlage für die Entstehung des christlichen und islamischen Glaubens.
Als kulturelle und religiöse Gruppe mit historischer Verbindung zur zeitgenössischen jüdischen Kultur datiert das Judentum jedoch erst auf das Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. Zu dieser Zeit setzte sich das rabbinische Judentum als legitimer Vertreter des jüdischen Glaubens durch und begann damit, die mündliche Lehre zu reformieren und niederzuschreiben. Bereits damals gab es jüdische Gemeinden in vielen Metropolen des Orients, im gesamten Mittelmeerraum sowie in Teilen Europas, Chinas, Indiens und Afrikas. Größere jüdische Enklaven bildeten sich in Mitteleuropa jedoch erst im Mittelalter heraus.
Vielerorts konnten sich Juden unter Beibehaltung von Glauben und Tradition gut in die lokalen Gesellschaften integrieren. Dennoch wurden sie im Laufe der Geschichte oft aufgrund ihrer Religion enteignet, vertrieben oder getötet. Nach der protestantischen Reformation besserte sich die Lage, da manche Länder auf eine rechtliche Gleichstellung hinarbeiteten. Dennoch kam es immer wieder zu Pogromen, die ihren traurigen Höhepunkt in der Ermordung von Millionen Juden während des Dritten Reiches durch die Nationalsozialisten fanden.
Die meisten Menschen jüdischen Glaubens leben heutzutage in einer Vielzahl von Ländern als religiöse Minderheiten. Eine Ausnahme bildet der Staat Israel, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Nationalstaat des jüdischen Volkes gegründet wurde und dessen Staatsbürger mehrheitlich jüdischen Glaubens sind. In Deutschland leben heute etwa 90.000 Juden.
1.4.2 Glaubensinhalte und religiöse Praxis
Im Mittelpunkt der jüdischen Religion steht der Glaube an einen einzigen Gott namens „JHWH“, dessen Name aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen wird. Dieser Gott wird im orthodoxen Verständnis als Schöpfer des Universums angesehen, der auch heute noch aktiv in der Welt handelt. Der Glaube selbst hat im Judentum allerdings keinen zentralen Stellenwert, sondern wird aus der Lehre und den Geboten abgeleitet. Zentral ist dagegen die Erwartung eines göttlichen Erlösers, welcher der Welt Frieden und Gerechtigkeit bringen soll und in den Schriften angekündigt wird. Anders als im Christentum ist die jüdische Heilserwartung allerdings diesseitig und zielt auf eine göttliche Herrschaft auf Erden.
Die Juden sehen sich selbst als Nachfahren des von Gott auserwählten Volkes, welches auf einen mythologischen Stammvater namens Abraham zurückgeht. Dementsprechend richtet sich die jüdische Lehre zwar an alle Menschen, ist jedoch ausschließlich an die ethnisch-religiöse Gruppe der Juden gebunden, die sich dementsprechend stark über ihre Religion definieren. Grundsätzlich kann jeder zum Judentum konvertieren, der sich zum Glauben bekennt, nach den Grundsätzen lebt und die Sitten und Gebräuche der Gemeinschaft beachtet. Anders als Christen und Moslems missionieren Juden jedoch nicht, was u. a. für die vergleichsweise geringe Anzahl an Gläubigen verantwortlich ist.
Die mythologische Geschichte des Judentums findet sich in den fünf Büchern Mose, die sowohl in der christlichen Bibel als auch in der heiligen Schrift der Juden, der Thora, enthalten sind. Neben der schriftlichen Lehre, die in der Thora niedergeschrieben ist, existiert der Talmud als mündliche Überlieferung der Worte Gottes. Er enthält u. a. 613 Gebote und Verbote, welche von jedem Juden beachtet werden müssen und sich auf das gesamte Alltagsleben beziehen.
Zu den wichtigsten Regeln gehören das tägliche Gebet und das Studium der Thora. Der vorgeschriebene Ruhetag ist für gläubige Juden der Samstag („Sabbat“), an dem die Arbeit ruht und der ganz dem Gebet gewidmet werden soll. Strenggläubige Juden achten außerdem sehr darauf, dass ihre Speisen „koscher“ – d. h. rein – sind. Die koscheren Nahrungsvorschriften sehen eine strenge Trennung von Fleisch- und Milchprodukten schon bei der Zubereitung vor. Für beide Speisen gibt es getrenntes Ess- und Kochgeschirr, manchmal auch separate Kühlschränke oder sogar verschiedene Küchen. Generell gelten das Fleisch von nicht wiederkäuenden Tieren, insbesondere Schweinefleisch, sowie der Verzehr von bluthaltigen Tierbestandteilen als unrein.
Das Symbol der Juden ist der sechseckige Davidstern; ein weiteres der siebenarmige Leuchter, der für die Weisheit Gottes steht. Genauso wie im Islam werden Jungen, um den „Bund mit Gott“ sichtbar zu machen, nach ihrer Geburt beschnitten. Jüdische Männer tragen zudem eine runde Kopfbedeckung – die sog. Kippa – als Zeichen des Respekts vor Gott.
Das bedeutendste Heiligtum der Juden ist die Klagemauer, die vielen als ein Symbol für den ungebrochenen Bund Gottes mit dem jüdischen Volk gilt.
Die grundlegenden Schriften des Judentums beinhalten keine einheitliche Konzeption über Sterben, Tod und Jenseits. Im Mittelpunkt steht das Leben, das in Gehorsam gegenüber Gott geführt werden soll. Im alten Judentum stellte man sich vor, dass der Mensch nach seinem Tod in eine Schattenwelt eingehe und dort fern von Gott weiterlebt.
Durch griechische und persische Einflüsse kam es ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. allmählich zu einem Wandel der Jenseitsvorstellungen. Das Schattenreich entwickelte sich nun zu einem Ort der Vergeltung für die im Leben begangenen Sünden, ähnlich der christlichen Hölle. Gleichzeitig wurde die Vorstellung einer Auferstehung und eines endzeitlichen Gottesreichs aller Juden populär. Ebenfalls unter persischem und griechischem Einfluss entwickelte sich die Vorstellung, dass Körper und Seele getrennt voneinander zu betrachten seien. Heute herrscht die Überzeugung vor, dass es eine Auferstehung der Toten gebe. Insbesondere im orthodoxen Judentum gibt es allerdings auch die Idee einer Reinkarnation. Allen Auffassungen ist gemein, dass von einem Weiterleben nach dem Tod ausgegangen wird, bei dem die Gläubigen die Nähe Gottes in besonderer Weise erfahren.
1.4.3 Trauer- und Bestattungsriten
Der starke Fokus auf das Leben findet seine Entsprechung in den Bestattungs- und Trauerriten, die vorranging auf die Unterstützung der trauernden Familie und die Respekterweisung gegenüber dem Verstorbenen ausgerichteten sind. Nach Möglichkeit bereitet sich der Sterbende bereits vor seinem Ableben durch verschiedene Rituale und Gebete im Kreise seiner Familie auf den eigenen Tod vor.
Nach Eintritt des Todes werden die Augen und der Mund des Verstorbenen geschlossen, der Körper mit den Füßen in Richtung Tür auf den Boden gelegt und mit einem weißen Leintuch bedeckt. Die Angehörigen entzünden eine Kerze am Kopfende und öffnen ein Fenster, um der Seele des Verstorbenen den Übergang zu erleichtern. Familienmitglieder, Angehörige, Gemeindemitglieder oder Mitarbeiter eines Bestattungsinstituts sind während dieser Phase stets an der Seite des Verstorbenen und lesen Psalmen oder studieren Texte der Thora.
Die wesentlichen Tätigkeiten zur Bestattung des Toten werden i. d. R. von Bestattungsbruderschaften auf ehrenamtlicher Basis ausgeführt. Zunächst wird der Verstorbene gewaschen, spirituell gereinigt und angekleidet. Unabhängig von Alter oder gesellschaftlicher Stellung wird ihm ein weißes, leinenes Totenhemd angelegt, das der Kleidung hoher Priester aus dem Altertum ähnelt. Zudem wird ein Säckchen mit Erde aus Israel unter dem Kopf platziert oder in den Sarg gelegt, damit der Tote symbolisch in der Erde des für Juden heiligen Landes begraben liegt.
Die jüdische Bestattung erfolgt i. d. R. so schnell wie möglich, am besten noch am Todestag. Dahinter steht der Glaube, dass die Seele den Körper erst nach der Bestattung verlassen kann. In Israel ist das auch heute noch so üblich, in den meisten anderen Ländern ist solch eine rasche Bestattung nicht erlaubt, sodass auch jüdische Bestattungen frühestens 48 Stunden nach Eintritt des Todes durchgeführt werden.
Die Trauerfeier findet i. d. R. in einem speziellen Raum auf dem Friedhof statt. Sie wird bei einer jüdischen Bestattung von einem Rabbiner geleitet, der auch die Trauerrede sowie eine Lobrede auf den Verstorbenen hält. Während der Feier wird gebetet und gesungen, das Spielen von Musik und die Nutzung floristischer Elemente zur Dekoration ist hingegen unüblich. Von Nicht-Juden wird während der Trauerfeier meist das Tragen einer „Kippa“ erwartet.
Für orthodoxe Juden ist es die Regel, als Zeichen der Trauer bei der Beerdigung die Kleidung am Hals ein Stück weit einzureißen. Dieser alte Brauch gilt liberalen Juden hingegen als nicht mehr angemessen und wird von diesen kaum noch praktiziert. Die Eltern des Toten tragen diesen Riss als Symbol für die Wunde im Herzen und den Schmerz durch den Verlust für einen Monat zur Schau, andere Angehörige zumeist eine Woche lang. Das Sichtbarmachen der Trauer wird zudem in schwarzer oder dunkler Trauerkleidung deutlich.
Die jüdische Tradition sieht vor, dass Verstorbene in einem Leinentuch anstelle eines Sargs beerdigt werden. Dies steht in Deutschland und vielen anderen Ländern in Konflikt mit der Gesetzgebung, welche eine Sargpflicht vorschreibt. Aus diesem Grund wird dort, wo eine Bestattung im Leinentuch nicht möglich ist, ein Sarg aus weichem Holz ohne Metallverschläge genutzt, damit der Verwesungsprozess schneller einsetzen kann.
Für die Abschiedsfeier wird der Sarg fest verschlossen in erhöhter Position in den Trauerräumlichkeiten platziert, sodass er für die Gäste gut sichtbar ist. Eine Aufbahrung am offenen Sarg ist nach jüdischem Brauch hingegen unüblich und gilt als respektlos gegenüber dem Verstorbenen. Nach der Trauerfeier wird der Tote in einer stillen Zeremonie an den Ort der Beisetzung überführt und in das Grab hinabgelassen. Während des Trauerzugs zur Grabstelle gehen Familie und nahestehende Angehörige direkt hinter dem Sarg, entfernte Verwandte, Freunde sowie Kollegen reihen sich anschließend ein.
Für das Abschiednehmen am Grab wird ein Behälter mit Erde und einer kleinen Schaufel an der Grabstelle platziert, sodass die Angehörigen einige Schaufeln Erde mit ins Grab geben können. Beim Verlassen des Friedhofes formen die Trauergäste einen Durchgang, durch den die Hinterbliebenen hindurchschreiten. Dies symbolisiert den Zusammenhalt der Gemeinschaft und die Unterstützung für die trauernde Familie. Vor dem Verlassen des Friedhofs waschen sich die Trauernden die Hände, ohne diese abzutrocknen, was symbolisch für den Transfer des Gedenkens in das Alltagsleben steht.
Wenn der Verstorbene in das Grab gelegt wurde, bleibt die Grabstelle bis zum Ende des Trauermonats oder sogar bis zum Ende des Trauerjahrs nur mit Erde bedeckt. Erst danach wird ein Gedenkstein gesetzt.
Für jüdische Gräber gilt außerdem eine „ewige Ruhe“, da nach jüdischem Glauben die Toten am Ende aller Tage in körperlicher Form auferstehen werden. Deshalb werden Grabstellen nicht aufgehoben, eingeebnet oder neu belegt. Stattdessen werden Verstorbene in größeren zeitlichen Abständen in mehreren Lagen übereinander bestattet.
Die Grabfelder auf jüdischen Friedhöfen sind dabei stets nach Osten ausgerichtet, da von dort der Erlöser erwartet wird. Wie der Grabstein gestaltet wird, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und des Zeitgeistes. Das einzige Kriterium bei der Anlage eines Grabs ist das Erfordernis, es so einzurichten, dass nicht über das Grab geschritten wird. Blumenschmuck gibt es auf jüdischen Gräbern erst seit jüngerer Zeit, ansonsten ist die Grabgestaltung schlicht gehalten. Jüdische Gräber werden auch nicht im üblichen Sinn gepflegt, sondern weitgehend sich selbst und dem Lauf der Natur überlassen. Sie sind häufig von Efeu oder anderem Grün überwuchert. Als Zeichen der Erinnerung legen Besucher der Gräber einen Stein auf den Grabstein. Dieser Brauch entstand in einer Zeit, als die Grabhügel noch aus Steinen aufgeschichtet wurden, und dient als Zeichen der Ehrerbietung und als Gruß an die Toten.
Für männliche Friedhofsbesucher ist es Pflicht, das Haupt zu bedecken, von Frauen wird ein tugendhafter Kleidungsstil erwartet.
Viele kommunale Gemeinden unterhalten jüdische Abteilungen auf ihren Friedhöfen oder separate jüdische Friedhöfe; oftmals bestehen auch private jüdische Friedhöfe, die unter der Obhut der jeweiligen jüdischen Gemeinde stehen. Die Friedhofsordnungen sehen vor, dass dort nur Angehörige der jüdischen Religion begraben werden dürfen. Liberale Gemeinden lassen jedoch auch die Bestattung nichtjüdischer Familienangehöriger zu, entweder bei ihren Familien oder auf einem separaten Platz.
Erdbestattungen sind die Regel, Feuerbestattungen finden nur unter besonderen Ausnahmeregeln statt. Angesichts der millionenfachen Verbrennung in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern wird Letztere heute kaum von Juden in Anspruch genommen.
Im Judentum folgt auf die Beerdigung des Toten eine Trauerzeit. Die erste Woche – die „Schiwa“ – ist die intensivste Trauerphase. In dieser Zeit sitzen die dazu Gekommenen auf niedrigen Hockern oder – wie ursprünglich üblich – schuhlos auf dem Boden. Alle Spiegel und Bilder im Hause werden verhängt, und das Haus wird von den Trauernden nicht verlassen. Währenddessen verzichten die Angehörigen auf so viele Dinge wie möglich, um sich ganz auf die Verarbeitung des Verlusts konzentrieren zu können. So arbeiten, baden, rasieren oder schminken sie sich nicht. Auch Geschlechtsverkehr oder das Lesen in der Thora sind verboten. Die Gemeinschaft übernimmt während der Trauerwoche tägliche Aufgaben wie das Kochen von Mahlzeiten oder Reinigen der Wohnung. Als Zeichen des bevorstehenden Neubeginns werden bei der ersten Mahlzeit der Familie nach der Beerdigung hart gekochte Eier serviert. Es ist auch üblich, dass Besucher nicht an die Tür klopfen oder die Klingel betätigen, sondern sich selbst in das Haus hineinlassen.
Die trauernde Familie wird regelmäßig von Mitgliedern der Gemeinschaft besucht und erhält so Trost aus dem Umfeld. Nach Ablauf der Trauerwoche verlässt die Familie gemeinsam die Wohnung. Dieses Ritual eines Spaziergangs durch die Straßen symbolisiert die Rückkehr aus der Schiwa. Mittlerweile begrenzen viele Juden die Trauerwoche aus pragmatischen Gründen allerdings auf einen Tag.
Nach der Schiwa folgt der „Schloschim“, der Trauermonat, in dem die Trauer noch immer, aber weniger stark zelebriert wird. Am Ende dieser 30 Tage findet eine Trauerfeier am Grab des Verstorbenen statt. Für enge Angehörige folgt nun noch für elf Monate eine weitere Trauerphase, deren zentrales Element das tägliche Beten ist. Nach den offiziellen Trauerzeiten wird die Trauer nicht länger nach außen zur Schau gestellt. Dennoch werden die Toten weiterhin geehrt und nicht aus dem Gemeindealltag verbannt. So wird jedes Jahr am Todestag für 24 Stunden ein Licht für den Verstorbenen angezündet.
Verwendete Quellen
Bestatterweblog: Bestattungen in verschiedenen Religionen und Kulturkreisen – Judentum 1, 2019, online verfügbar unter https://bestatterweblog.de/bestattungen-in-verschiedenen-religionen-und-kulturkreisen-judentum/ (Stand 01.04.2019).
Bestatterweblog: Bestattungen in verschiedenen Religionen und Kulturkreisen – Judentum 2, 2019, online verfügbar unter https://bestatterweblog.de/bestattungen-in-verschiedenen-religionen-und-kulturkreisen-judentum-2/ (Stand 01.04.2019).
Grollman, Earl A.: Judaism, in: Michael Brennan (Hrsg.): The A–Z of Death and Dying, Santa Barbara et al., 2014, S. 281–284.
Lichtner, Rolf/Christoph Bläsius: Bestattung in Deutschland – Lehrbuch, Düsseldorf 2007.
Mittag, Andrea: Bestattungsriten in den verschiedenen Religionen, in: Christina Forster/Barbara Rolf (Hrsg.): Das Bestatter-Handbuch. Sofort umsetzbare Konzepte und praktische Handlungsempfehlungen für das moderne Bestattungsunternehmen, Merching 2008.
Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.: Informationsplattform Religion. Tod, Unterwelt, Auferstehung und Bestattung im Judentum, 2019, online verfügbar unter https://www.remid.de/tod-unterwelt-auferstehung-und-bestattung-im-judentum/ (Stand 01.04.2019).
Schindler, Ruben: The Jewish Way of Death, in: Clifton D. Bryant (Hrsg.): Handbook of Death and Dying, Thousand Oaks et al. 2003, S. 687–693.
Trauer.de: Jüdische Bestattungen, 2019, online verfügbar unter https://bestattungen.trauer.de/ratgeber/bestattungsrituale/juedische-bestattungen (Stand 01.04.2019).
Wikipedia: Jüdische Bestattung, 2019, online verfügbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Jüdische_Bestattung (Stand 01.04.2019).
Fußnoten:
[1]
Bei diesem Text handelt es sich um eine inhaltliche Zusammenfassung der am Ende des Beitrags angegebenen Quellen.