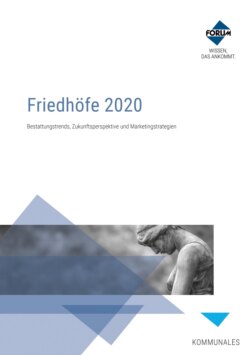Читать книгу Friedhöfe 2020 - Forum Verlag Herkert GmbH - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.2 Pflegefreie Gemeinschaftsgrabanlagen
{Pflegefreie Gemeinschaftsgrabanlagen}
{Gemeinschaftsgrabanlagen}
Gemeinschaftsgrabanlagen zählen zu den wichtigsten Trends aktueller Friedhofs- und Bestattungskultur. Der Begriff selbst ist nicht eindeutig definiert. Im weitesten Sinn meint er eine Anlage, die zusammenhängenden Gestaltungskriterien folgt und von zentraler Hand gepflegt wird. Lange Zeit wurde der Begriff allein für sog. anonyme Felder mit Rasenbestattungen ohne individuelle Kennzeichnung des Einzelgrabs verwendet. Gegenwärtig wird der Begriff jedoch v. a. für thematisch, symbolisch oder gruppenbezogen orientierte Anlagen benutzt.
Gemeinschaftsgrabanlagen können über symbolische Zugehörigkeiten geprägt und z. B. an Flora und Fauna orientiert sein: etwa durch Rosenbepflanzung hervorgehobene Grabanlagen oder sog. Schmetterlingsgräber. Daneben können auch selbstgewählte gesellschaftliche Gruppierungen Identität stiften, z. B. Fußballvereins-Fans (in manchen Publikationen taucht dafür der allerdings sonst unübliche Begriff „Clan-Friedhof“ auf). So gibt es Gemeinschaften, die sich erst nach der Bestattung finden, aber auch solche, die sich bewusst für ein spezifisches, i. d. R. jenseits der Familie liegendes Kollektiv im Gemeinschaftsgrab entscheiden.
Meist – aber nicht immer und keineswegs zwingend – handelt es sich um Aschenbeisetzungen. Sie erlauben, wie die späteren Beispiele zeigen werden, eine größere Flexibilität in der Gestaltung der Anlagen. Gründe für die Entscheidung für eine gemeinschaftliche Bestattung liegen i. d. R. in den geringeren Kosten und dem ersparten oder verringerten Aufwand für persönliche Grabpflege. Die Namensnennung der bestatteten Personen ist gewährleistet, teilweise über Gemeinschaftsdenkmäler.
1.2.1 Historische Traditionen
Historisch greifen solche Stätten auf gemeinschaftlich-genossenschaftliche Bestattungsanlagen zurück, wie sie beispielsweise von Gilden, Handwerkerzünften und anderen Berufsvereinigungen, Ordens- und Schwesterngemeinschaften sowie besonderen nationalen, kulturellen und religiösen Vereinigungen bekannt sind. Im weiteren Sinn können auch die in Europa seit dem Ersten Weltkrieg verbreiteten Soldatenfriedhöfe ebenso als vergleichbare Anlagen gelten wie die Friedhöfe der Namenlosen für unbekannte Tote an Flüssen und Meeresküsten oder die Opfer von Katastrophen. Bei diesen letzten Beispielen handelt es sich allerdings um unfreiwillige Gemeinschaften.
Aus historischen Gründen gibt es bis heute in einigen Orten komplette Friedhofsanlagen, die gemeinschaftlich betrieben werden. Ein überregional bekanntes Beispiel ist der Friedhof der sog. „Holmer Beliebung“ in Holm, einem Stadtteil von Schleswig an der Schlei. Er geht auf eine Fischergilde zurück. Rechtlich ist diese Beliebung heute ein „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“. Laut Friedhofssatzung ist die Grabstätte kostenlos und wird über eine gemeinschaftliche Kasse finanziert, in die jedes Mitglied zu Lebzeiten einzahlt.
Bild 21: Friedhof der „Holmer Beliebung“ in Schleswig an der Schlei (Quelle: Norbert Fischer)
Jenseits dieser und vergleichbarer, i. d. R. historisch begründeter Einzelfälle zeigen sich heutige Gemeinschaftsgrabanlagen als Ausdruck für den zunehmenden Bedeutungsverlust der klassischen sozialen Verbände (Familie, Kirche). Umgekehrt repräsentieren sie neuere gesellschaftliche Formationen in den eher lockeren, frei gewählten Vereinigungen der nachindustriellen Gesellschaft.
1.2.2 Beispiele unterschiedlicher Gemeinschaftsgrabanlagen
Naturlandschaftliche Anlagen
Im Folgenden geht es i. d. R. um Gemeinschaftsgrabanlagen, die Bestandteile regulärer Friedhöfe sind. Wichtigstes Merkmal ist hier die Überformung der alten räumlichen Strukturen, also der bislang als Gestaltungsprinzip dominierenden Familien- bzw. Einzelgrabstätten.
Ein neueres Beispiel für einen Friedhof mit mehreren thematisch orientierten Gemeinschaftsgrabanlagen ist der um ein Krematorium („Flamarium“) angelegte „Friedgarten Mitteldeutschland“ in Kabelsketal bei Halle/Saale. Es handelt sich um einen homogen gestalteten Natur- und Kulturraum, in den Einzel- und Gemeinschaftsgrabstätten gleichsam hineinkomponiert sind. Durch spezielle, historisch oder mythologisch verankerte Namensgebungen erhalten die einzelnen Bereiche teilweise eine spezielle Atmosphäre und Bedeutung, z. B. „Schiffssetzung“, „Röse“ und „An der Dalbe“.
Bild 22: Aschengemeinschaftsgrab im Friedgarten Mitteldeutschland (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 23: Durch Steine gekennzeichnetes Aschengemeinschaftsgrab im Friedgarten Mitteldeutschland (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 24: Bereich „Schiffsetzung“ im Friedgarten Mitteldeutschland (Quelle: Norbert Fischer)
Die Auflösung klassischer Friedhofsstrukturen gilt auch für den sog. Naturfriedhof „Garten des Friedens“ in Fürstenzell bei Passau, der ebenfalls an ein Krematorium angeschlossen ist. Abgegrenzte Grabstätten sind nicht mehr zu erkennen. Vielmehr sind vielfältig gestaltete Erinnerungsorte in eine weitgehend naturbelassene, nach geomantischen Prinzipien gestaltete Landschaft eingefügt.
Stärker ökologisch orientiert ist die 2010 im schleswig-holsteinischen Ahrensburg auf dem dortigen kirchlichen Friedhof eingeweihte „Wildblumenwiese“. Es handelt sich um ein 2 ha großes, von der evangelischen Kirchengemeinde verwaltetes Areal, das in seinen Randbereichen als Aschenbeisetzungsanlage dient.
Auf anderen Friedhöfen sind einzelne Anlagen nach naturlandschaftlichen Kriterien gestaltet. Ein frühes und bekanntes Beispiel findet sich auf dem Hauptfriedhof Karlsruhe. Dort wurden 2003 und 2007 unter dem Titel „Mein letzter Garten“ neuartige Bestattungsflächen für Aschenbeisetzungen (teils auch für Sargbeisetzungen) in einer homogen gestalteten Miniaturlandschaft geschaffen. Räumlicher Hauptbezugspunkt ist ein von Granitblöcken eingefasster Wasserfall, dem sich ein trocken gefallenes Bachbett als Symbol für das beendete Leben an-schließt. Des Weiteren prägen Felssteine, geschwungene Wege, alter Baumbestand und Rasenflächen die Beisetzungslandschaft. Die Urnengräber sind als Gemeinschaftsgrabanlagen konzipiert. Der Verstorbenen wird auf gemeinschaftlichen Erinnerungsmalen aus Stein und Holz – darunter ein künstlerisch gestalteter Eichenstamm – gedacht.
Bild 25: Aschenfeld „Mein letzter Garten“ auf dem Hauptfriedhof Karlsruhe (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 26: Aschengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof Hameln-Wehl (Quelle: Norbert Fischer)
Themenanlagen {Themenanlagen}
Auf der Bundesgartenschau 2009 in Schwerin wurden erstmals die sog. „Memoriam-Gärten“ vorgestellt – themenbezogene Miniaturfriedhöfe innerhalb regulärer Friedhöfe, die vom Bund deutscher Friedhofsgärtner betreut werden. Inzwischen gibt es zahlreiche solcher Themenanlagen, u. a. in Aachen, Berlin-Steglitz und -Zehlendorf, Duisburg-Waldfriedhof, Bonn und Saarbrücken-Dudweiler.
Ähnlich ausgerichtet sind die von Friedhofsgärtner-Genossenschaften in Kooperation mit den Friedhofsverwaltungen angelegten „Bestattungsgärten“ in Köln (siehe Kapitel „Praxisbeispiel: Gärtnergepflegte Gemeinschaftsgrabanlage“) und Bergisch-Gladbach. Auch hier handelt es sich um themenbezogene Beisetzungsflächen, die sich als Landschaftsgärten en miniature zeigen, in die die Gräber ohne feste Grenzen hineinkomponiert sind. So ist der „Garten der Lichter“ im Stil eines japanischen Gartens konzipiert und will der symbolischen Bedeutung brennender Lichter für Trauer und Erinnerung – über Allerheiligen hinaus – gerecht werden. Der Auengarten bezieht seine Gestaltung über feuchte Landschaftsflächen.
Bild 27: Urnenthemenpark Rhododendron auf dem Hauptfriedhof Saarbrücken (Quelle: Norbert Fischer)
Neueste Trends umfassen regionalspezifische Gemeinschaftsanlagen, wie Weinberg-Bestattungen (Ahrweiler und Nordheim am Main) und Deichbestattungen (Schweiburg am Jadebusen). Wie letzteres Beispiel hat die maritim gestaltete Urnengemeinschaftsanlage „Letzter Ankerplatz“ auf dem Neuen Friedhof Westerland (Insel Sylt) ebenfalls symbolischen Bezug zur Nordseeküste.
Bild 28: Deichgrab auf dem Friedhof Schweiburg (Quelle: Sonja Windmüller)
Bild 29: Urnengemeinschaftsanlage „Letzter Ankerplatz“ auf dem Neuen Friedhof Westerland (Quelle: Norbert Fischer)
Häufig spielen zwar auch christliche Motive noch eine Rolle (beispielhaft „Apostelgarten“ u. a., Südfriedhof Neumünster), aber sie werden zunehmend überformt von säkular-naturbezogener bzw. archetypisch-mythologischer Symbolik wie Schmetterlings- oder Rosengarten-Anlagen (Friedhof Hamburg-Ohlsdorf). Auch symbolische Gestaltungen in Form von Tierkreiszeichen-Anlagen sind bekannt (Hauptfriedhof Saarbrücken).
Bild 30: Paargräber auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 31: Urnenthemenpark Sternzeichen auf dem Hauptfriedhof Saarbrücken (Quelle: Norbert Fischer)
1.2.3 Kolumbarien
{Kolumbarien}
Auf dem Hauptfriedhof Saarbrücken zu finden ist eine besonders spektakuläre Variante der gemeinschaftlichen Aschenbeisetzung: die seit 2008 angebotenen Urnenpyramiden. Sie beherbergen Kammern für eine oder mehrere Urnen, auf deren Kupfertür Namen und Daten des oder der Verstorbenen verzeichnet werden. Auf einer Balustrade können Kerzen und Blumen aufgestellt werden. Nach Ende der Ruhefrist wird die Urne dann ins Pyramideninnere transloziert.
Bild 32: Bestattungspyramide auf dem Hauptfriedhof Saarbrücken (Quelle: Norbert Fischer)
Auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf wird eine ehemalige Friedhofskapelle als Urnenbeisetzungsstätte (Kolumbarium) genutzt. Generell erlebt die Kolumbariumbestattung derzeit eine Renaissance, wie die inzwischen erfolgte Umwidmung mehrerer Kirchen zu Orten der Aschenbeisetzung dokumentiert (sog. „Urnenkirchen“). Aktuell ist in Lübeck geplant, einen ehemaligen Hafenspeicher zu einem Kolumbarium umzubauen.
1.2.4 Gemeinschaftsanlagen für gesellschaftliche Gruppen
Der „Garten der Frauen“ {Gemeinschaftsanlagen, Der „Garten der Frauen“}
Das wohl deutschlandweit bekannteste Beispiel einer personen- bzw. gruppenbezogenen Gemeinschaftsgrabanlage ist der „Garten der Frauen“ auf dem Hamburg-Ohlsdorfer Friedhof. Die Anlage wird vom gleichnamigen Verein, der in der Hamburger Frauenbewegung verankert ist, betreut und über Mitgliedsbeiträge finanziert. Der Verein wurde im Jahr 2000 von drei Frauen begründet und richtete 2001 die Gemeinschaftsgrabstätte auf dem Ohlsdorfer Friedhof ein. In einem musealen Bereich der parkähnlich gestalteten Anlage wird an verdiente Frauen aus Hamburg erinnert, z. B. durch umgesetzte Grabsteine von anderweitig situierten Gräbern, deren Ruhefrist abgelaufen war. Weitere Räume dienen als Bestattungsfläche für Vereinsmitglieder. Historische Erläuterungstafeln und ein Denkmal für NS-Opfer gehören ebenfalls zur gartenarchitektonisch ansprechend gestalteten Anlage, deren Bedeutung durch ein regelmäßiges Veranstaltungsprogramm zusätzlich untermauert wird. Eine „Erinnerungsspirale“ aus Einzelsteinen ist dem Andenken jener bedeutenden Hamburger Frauen gewidmet, deren Grabstätten an einem anderen Ort geblieben ist. So bildet der „Garten der Frauen“ nicht zuletzt einen ganz besonderen Ort der Erinnerung. Damit wird er zugleich zum kulturhistorischen „Freilichtmuseum“.
Bild 33: Der „Garten der Frauen“ auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf (Quelle: Norbert Fischer)
Zur Anlage gehören Erläuterungstafeln, Ruhebänke und v. a. vielfältige gartenarchitektonisch-gestalterische Elemente, die den Begräbnisplatz als naturnah modellierte Miniaturlandschaft erscheinen lassen. In einem nahegelegenen historischen Wasserturm finden Ausstellungen und andere Veranstaltungen statt. Mit dem „Garten der Frauen“ wird zugleich der gesellschaftspolitische Aspekt von Bestattungskultur deutlich: Statt der klassischen, familien-, ehe- oder individuumsbezogenen Grabstätte entwickeln sich Anlagen, die von neuen sozialen, netzwerkartigen agierenden Gruppierungen mit einer je eigenen gesellschaftlichen Identität geprägt sind – wie hier der Frauenbewegung.
Anlage für buddhistische Gemeinschaften {Gemeinschaftsanlagen, Anlage für buddhistische Gemeinschaften}
Im März 2019 wurde erstmal eine Bestattung auf der Anlage für buddhistische Gemeinschaften des Heidefriedhofs Dresden durchgeführt. Diese Anlage, die bereits seit 2015 besteht, trägt den Namen „Ort der Rückkehr“ und ist für alle buddhistischen Strömungen offen. Im Hintergrund für die besondere Beisetzungsstätte steht die Verbundenheit mit den Vorfahren, die sich in der Anlage ausdrückt.
Die vergleichbare buddhistische Gemeinschaftsgrabstätte auf dem Zentralfriedhof Wien ist um einen zentralen Stupa oktogonal gestaltet. In Deutschland entstand das erste buddhistische Gräberfeld auf dem Friedhof Hannover-Seelhorst, weitere folgten u. a. in Hamburg, Mönchengladbach und Berlin.
Fußballfan-Anlagen {Gemeinschaftsanlagen, Fußballfan-Anlagen}
Ebenfalls einer sozialen Gruppierung zugehörig sind die in Deutschland noch wenig, im Ausland (z. B. Niederlande, Großbritannien) sehr viel stärker bekannten Fußballfan-Gemeinschaftsanlagen.
Auf dem Hauptfriedhof Hamburg-Altona in Hamburg begann man 2008 mit der Anlage des stadionähnlich gestalteten „HSV-Friedhofs“: Drei „Tribünenränge“ dienen der Aufnahme der einzelnen Gräber für Anhänger des Hamburger SV. Die Fläche, die mit Unterstützung des Vereines angelegt wurde, befindet sich nahe am HSV-Stadion.
Bild 34: Hamburger SV-Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Altona (Quelle: Lea Stalmann)
Auch der FC Schalke 04 hat in Gelsenkirchen eine eigene Bestattungsanlage eingerichtet. In anderen europäischen Staaten ist diese Praxis bereits länger bekannt: In den Niederlanden haben seit den 1990er-Jahren Fans des Fußballclubs Ajax Amsterdam die Möglichkeit, sich unter Gleichgesinnten auf dem Friedhof Westgaarde bestatten zu lassen.
AIDS-Gemeinschaftsgrabstätten {Gemeinschaftsanlagen, AIDS-Gemeinschaftsgrabstätten}
Frühe Beispiele für personenspezifische Gemeinschaftsgrabstätten bilden die seit Mitte der 1990er-Jahre eingerichteten Anlagen für Menschen, die an AIDS verstorben waren. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg wurde im Jahr 1995 auf Betreiben des Vereines Memento e. V. eine historische, denkmalgeschützte Grabstätte in Form einer sog. Patenschaft restauriert und mit dem Schriftzug „Memento“ versehen („Memento I“). Auf der Grabstätte sind jeweils die Namen der Toten aufgeführt. Die eingravierte Schleife symbolisiert Verbundenheit und Solidarität mit den Verstorbenen, die sonst möglicherweise als Sozialbestattung anonym beigesetzt worden wären. Später wurden auf demselben Friedhof weitere Gemeinschaftsgrabstätten, auch mit moderner Grabmalgestaltung, angelegt. Mit deren Einrichtung verbunden waren regelmäßige Gedenkveranstaltungen am Gemeinschaftsgrab.
Bild 35: AIDS-Gemeinschaftsgrab Hamburg-Ohlsdorf (Quelle: Norbert Fischer)
Gemeinschaftsanlagen für Obdachlose
Wie die frühen AIDS-Gemeinschaftsgrabstätten sind auch die Bestattungsplätze für Obdachlose Ergebnis einer gesellschaftlichen Stigmatisierung. Hier haben die „Interessensgemeinschaft zur Bestattung obdachloser Menschen“ der Katholischen Kirchengemeinde St. Severin in Köln wie auch die Evangelische Kirchengemeinde Heilig-Kreuz-Passion in Berlin mit ihrem „Grab mit vielen Namen“ mit zivilbürgerlichem Engagement gemeinschaftliche Bestattungsplätze geschaffen.
Gemeinschaftsanlagen für Stillgeburten {Gemeinschaftsanlagen, Stillgeburten} („Sternenkinder {Sternenkinder}“)
Unter einem anderen Vorzeichen bedeutsam für neue, gemeinschaftsbezogene Anlagen sind Begräbnis- bzw. Gedenkstätten für totgeborene Kinder (sog. Stillgeburten). In der Regel dienen sie – beispielsweise dank regelmäßiger Gedenkfeiern – auch für jene als Erinnerungsort, die dort keine Beisetzung durchgeführt haben.
Hier ging die Initiative häufig von Krankenhäusern, Klinikseelsorge oder anderen privaten Initiativen aus, die sich für eine würdevolle Beisetzung von im Mutterleib Verstorbenen engagierten. Von ihnen wurden mit Unterstützung der Friedhofsverwaltungen, aber auch außerhalb von Friedhöfen, v. a. seit Mitte der 1990er-Jahre besondere Orte von Trauer und Gedenken und teilweise auch der Bestattung geschaffen.
Zu den größten und bedeutendsten dieser Anlagen gehört der 2004 eingeweihte „Sternengarten“ auf dem Hauptfriedhof Mainz. Der Name dieser Grabanlage geht zurück auf eine Passage aus dem Roman „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry.
Bild 36: Sternengarten auf dem Hauptfriedhof Mainz (Quelle: Norbert Fischer)
Eine ähnliche, allerdings weitaus größere Bestattungs- und Erinnerungslandschaft für Kinder ist auf dem Zentralfriedhof Wien zu finden: der sog. „Babyfriedhof“. Die Inschrift auf der Hinweistafel lautet: „Hier ruhen die Babys, die viel zu kurz bei uns waren.“
Bild 37: Erinnerungskarussell Babyfriedhof Wien (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 38: Gemeinschaftsdenkmal Babyfriedhof Zentralfriedhof Wien (Quelle: Norbert Fischer)
Eine besondere Anlage zur Erinnerung an frühverstorbene Kinder ist im April 2015 in Wyk auf der nordfriesischen Insel Föhr vom Verein Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister Schleswig-Holstein e. V. eingeweiht worden: die „Himmelsbäume“. In diesem Gedenkwald wird für jedes frühverstorbene Kind zu regelmäßigen gemeinsamen Terminen ein Baum gepflanzt. Ein früher im lokalen Hafen verwendeter, nun künstlerisch gestalteter Dalben bildet den Mittelpunkt des Gedenkwalds.
Mensch-Tier-Bestattungen
Eine miniaturisierte Form des Gemeinschaftsgrabes sind die zu den neuesten Trends auf Friedhöfen zählenden gemeinsamen Mensch-Haustier-Bestattungen. Seit Mitte 2015 ist dies auf den Friedhöfen Dachsenhausen (Rheinland-Pfalz) und Essen-Fintrop (Nordrhein-Westfalen) möglich. Das Konzept unter dem Titel „Unser Hafen“ stammt von der Deutschen Friedhofsgesellschaft mbH, die in Deutschland 15 Friedhöfe betreibt. Die Bestattung von Mensch und Tier im gemeinsamen Grab erfolgt hier ausschließlich als Aschenbeisetzung.
Eine Hamburger Seebestattungs-Reederei bietet seit 2014 eine gemeinsame Seebestattung von Mensch und Tier an.
1.2.5 Rasenbestattungen
{Rasenbestattungen}
Damit zeigen die neueren Gemeinschaftsgrabanlagen ein anderes Gesicht als die des späten 20. Jahrhunderts mit ihren anonymen Rasengräbern. Diese waren eine weitere Stufe auf dem Weg zur Miniaturisierung der Grabstätten gewesen und schien vor der Jahrtausendwende zur all-gemein üblichen Bestattungsform zu werden, ist aber inzwischen von den beispielhaft erwähnten Themengräbern eingeholt werden.
Anonyme Beisetzung {Anonyme Beisetzung}
Bei der gleichwohl bis heute praktizierten anonymen Rasenbeisetzung – bei der die sog. Aschestreuwiese (Rostock, Schwerin) ein Sonderfall ist – handelt es sich um die Beisetzung in einer gemeinschaftlichen Anlage ohne individuelles Grabzeichen und ohne Möglichkeit zur individuellen Grabpflege.
Die anonyme Beisetzung ist, von Ausnahmen abgesehen, gleichzusetzen mit Aschenbeisetzung.
Dabei wird die Asche in einer zweckentsprechenden Urne unter zunächst ausgestochenen und dann wieder eingesetzten quadratischen Rasensoden beigesetzt. Der exakte Beisetzungsort der einzelnen Urne innerhalb dieser Anlage ist nur der Friedhofsverwaltung bekannt. Die Gesamtanlage ist gartenästhetisch meist ansprechend gestaltet und wird häufig von einem Gemeinschaftsdenkmal geschmückt.
Die Bezeichnungen für diese Anlagen variieren in den einzelnen Städten; geläufig sind u. a.
| • | „Urnengemeinschaftsanlage“, |
| • | „Urnenhain“, |
| • | „Anonymer Urnenhain“, |
| • | „Urnengemeinschaftshain“ |
| • | oder auch schlicht „Rasenfriedhof“. |
Am zentralen Denkmal oder in den Randbereichen besteht i. d. R. die Möglichkeit, Blumenschmuck zu hinterlegen.
Bild 39: Anonymer Urnenhain auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf (Quelle: Anna Maria Götz)
Bekannt als sog. Urnengemeinschaftsanlagen hatten sie innerhalb Deutschlands zunächst Friedhöfe auf dem Gebiet der ehemaligen DDR geprägt. Diese entsprachen den staatssozialistischen Vorstellungen von kollektiver Bestattung, die gesellschaftliche Unterschiede im Tod verschwinden lassen sollte. Gelegentlich sind auf einem Gemeinschaftsdenkmal die Namen aller Bestatteten verzeichnet, in anderen Fällen auf sog. Jahresfeldern mit einem Gedenkstein die Bestattungen eines jeden Jahres markiert. Auf dem Leipziger Südfriedhof haben sich aus einem bereits früher für Sozial- und Anatomieleichen angelegten Urnengarten seit 1960 mehrere Urnengemeinschaftsanlagen entwickelt.
In den alten Bundesländern ist ab 1970 eine signifikante Entwicklung der anonymen Bestattung als reguläre Bestattung zu beobachten: Frühe anonyme Urnenhaine in den westlichen Bundesländern entstanden beispielsweise 1970 auf dem Friedhof Hamburg-Öjendorf, 1974 in Bremen-Riensberg und 1975 auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf.
Zahlreiche Zwischenformen
Aus diesen rein namenlosen Rasenbestattungen haben sich inzwischen zahlreiche Zwischenformen mit unterschiedlichen Bezeichnungen entwickelt. Die bekanntesten Formen sind die Aufstellung von Gemeinschaftsdenkmälern, auf denen Namen und ggf. Lebensdaten der Verstorbenen verzeichnet sind. Bekannt sind auch Anlagen, auf denen in den Boden (Rasen) eingelassene Platten Namen und Lebensdaten aufnehmen.
Bild 40: Rasenbestattung mit Denkmal auf dem Friedhof Göttingen (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 41: Rasenbeisetzungen mit Denkmal auf dem Südfriedhof Kiel (Quelle: Norbert Fischer)
Bild 42: Rasenbeisetzungen auf dem Südfriedhof Leipzig (Quelle: Norbert Fischer)